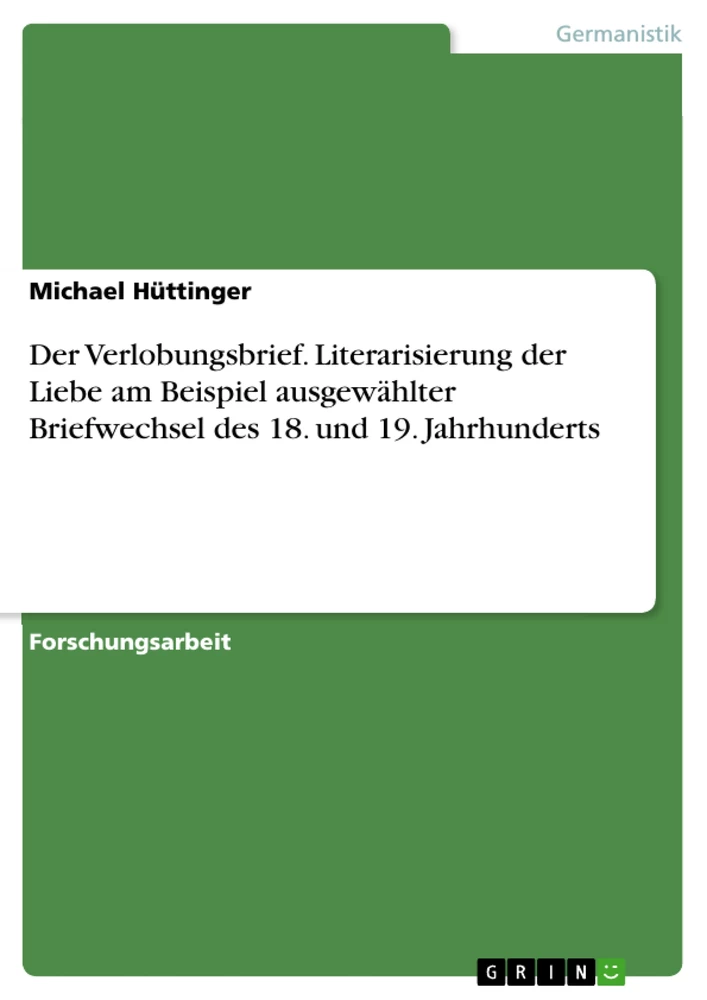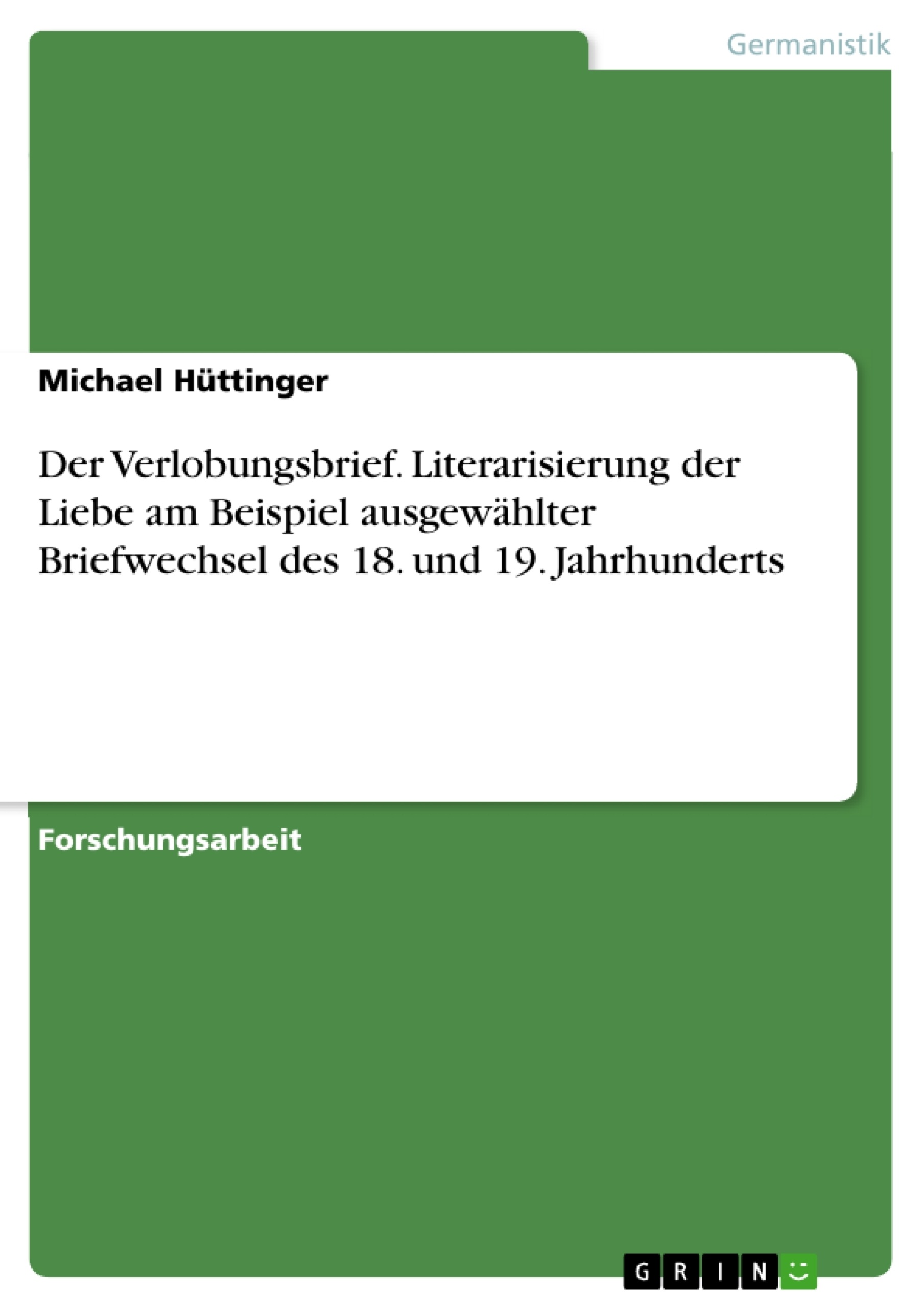„Um einen guten Liebesbrief zu schreiben, musst du anfangen, ohne zu wissen, was du sagen willst, und endigen, ohne zu wissen, was du gesagt hast.“ Jean-Jacques Rousseau beschreibt das Schreiben von Liebesbriefen sehr treffend, wenn er sagt, dass man am Anfang häufig nicht in der Lage ist, einen Liebesbrief zu starten, weil man nicht weiß, wie man sich ausdrücken sollte und eine gewisse Hemmung in sich spürt. Irgendwie fließen dann aber doch die Worte aus dem Mund und man bringt sie zu Papier. Am Ende, beim Durchlesen des Liebebriefes entziehen sich die geschriebenen Wörter und Sätze dem Verstand und man weiß nicht so recht, wie man solch eine Sprache der Liebe zu Papier bringen konnte. Es spricht eben das Herz und das bedient sich einer anderen Sprache als unser Verstand.
Genau an diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an und beschäftigt sich mit Liebesbriefen im 18. und 19. Jahrhundert. Gerade das 18. Jahrhundert wurde immer wieder als das Jahrhundert des Briefes bezeichnet. In der Gesellschaft dieser Zeit entsteht eine neue Individualität des Menschen, begründet durch eine zunehmende Naturbeherrschung und Zentrierung des Weltbildes auf den Menschen hin.
Auch in den Brieflehren werden Veränderungen sichtbar und eine neue Ästhetik des Schreibens nach Gellert wird auf den Punkt gebracht. Dieser neue, natürliche Briefstil ist geprägt von einem freieren Schreiben, weg von formalen Regeln und Normen. Genau dieser natürliche Stil ist es wiederum, der seine Vollendung im Liebesbrief findet und wodurch das Schreiben an einen geliebten Gegenüber zu einer sehr beliebten Beschäftigung wird. Der Verlobungsbrief spielt dabei eine besondere Rolle, da er auf der einen Seite als Ausdruck einer emotionalen Verbundenheit zwischen den Liebenden angesehen werden kann und daher starke kommunikative Momente und Absichten enäält, andererseits steht er aber auch für die Vorbereitung der bürgerlichen Institution der Ehe und bringt daher auch ästhetische Punkte mit.
Vor diesem Hintergrund bearbeitet die vorliegende Arbeit zunächst einige theoretische Punkte des Briefes und im speziellen des Liebesbriefes und geht dabei auf Strukturmerkmale, Grundfunktionen, Geschichte und Entwicklung sowie auf die Stellung in der Literaturwissenschaft ein. Zudem werden zwei wesentliche Briefwechsel des 18. und 19. Jahrhunderts analysiert (die Briefe von Heinrich von Kleist an Wilhelmine von Zenge und der Briefwechsel von Sigmund Freud und Martha Bernays).
Inhaltsverzeichnis
- A. Vorbemerkungen
- B. Der Verlobungsbrief - Literarisierung der Liebe am Beispiel ausgewählter Briefwechsel im 18. und 19. Jahrhundert
- 1. Theoretische und geschichtliche Grundlegung
- 1.1 Strukturmerkmale und Wesensbestimmung
- 1.2 Grundfunktionen des Briefes
- 1.3 Brieftheoretische Reflexionen und Entwicklungen
- 1.4 Der Liebesbrief
- 1.4.1 Entstehung und Entwicklung
- 1.4.2 Merkmale und Charakteristika
- 1.4.3 Stellung in der Literaturwissenschaft
- 1.4.4 Funktion und Ziel der Briefanalysen
- 2. Heinrich von Kleist an Wilhelmine von Zenge
- 2.1 Heinrich von Kleist und Wilhelmine von Zenge – Die Anfänge
- 2.2 Die Liebe und der Liebesbrief als Missverständnis
- 2.3 Erziehung vs. Verführung im Liebesbrief
- 2.4 Vom Geheimnis der Liebe zum Rätsel der Krise
- 2.5 Einzelanalysen
- 2.5.1 Brief vom 30. Mai 1800
- 2.5.2 Brief vom 10. Oktober 1800
- 2.5.3 Brief vom 20. Mai 1802
- 3. Zum Briefwechsel zwischen Sigmund Freud und Martha Bernays
- 3.1 Sigmund Freud und Martha Bernays - Die Anfänge
- 3.2 Die zwei Seiten des Sigmund Freud
- 3.2.1 Freud als Despot der Liebe
- 3.2.2 Freud als sentimentaler Mensch
- 3.2.3 Freuds Frauenbild im Brief
- 3.3 Freuds Eifersucht
- 3.4 Martha Bernays - eine starke Frau
- 3.5 Streitpunkt Religion
- 3.6 Einzelanalysen
- 3.6.1 Brief von Sigmund Freud an Martha Bernays vom 15. Juni 1882
- 3.6.2 Brief von Martha Bernays an Sigmund Freud vom 24. Juni 1882
- 3.6.3 Brief von Sigmund Freud an Martha Bernays vom 30. Juni 1883
- 3.6.4 Brief von Martha Bernays an Sigmund Freud vom 30. Juni 1883
- 4. Ein Vergleich der Briefwechsel zwischen Heinrich v. Kleist - Wilhelmine von Zenge und Sigmund Freud - Martha Bernays
- C. Abschließende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit analysiert Verlobungsbriefe des 18. und 19. Jahrhunderts, um die Literarisierung der Liebe in diesen Briefen aufzuzeigen. Sie untersucht, wie die Sprache der Liebe in den Briefen verwendet wird, um Emotionen auszudrücken, Liebesräume zu entwerfen, Rollen zu definieren und das Verhältnis der Geschlechter zu repräsentieren.
- Die theoretischen und geschichtlichen Grundlagen des Briefes und des Liebesbriefes im 18. und 19. Jahrhundert
- Die Analyse ausgewählter Briefwechsel von Heinrich von Kleist und Wilhelmine von Zenge sowie von Sigmund Freud und Martha Bernays
- Der Vergleich der beiden Briefwechsel hinsichtlich Sprache, Form und Stil sowie die Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Veränderungen
- Die Bedeutung des Briefes als Medium der Verlobung und Ehe in der bürgerlichen Gesellschaft
- Die ästhetische Funktion des Briefes und die Rolle der Imagination in der Liebeskommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer theoretischen und geschichtlichen Grundlegung, die die Strukturmerkmale, Grundfunktionen und Entwicklung des Briefes sowie die Stellung des Liebesbriefes in der Literaturwissenschaft beleuchtet. Im weiteren Verlauf analysiert die Arbeit zwei wesentliche Briefwechsel des 18. und 19. Jahrhunderts: den von Heinrich von Kleist an Wilhelmine von Zenge und den von Sigmund Freud und Martha Bernays.
Die Analyse der Briefe von Heinrich von Kleist an Wilhelmine von Zenge konzentriert sich auf die Darstellung der Liebe und des Liebesbriefes als Missverständnis, die Frage von Erziehung vs. Verführung im Liebesbrief und die Entwicklung von der Liebe zum Rätsel der Krise. Darüber hinaus werden einzelne Briefe näher betrachtet, um die Sprache der Liebe und den Entwurf von Liebesräumen in ihnen zu analysieren.
Der Briefwechsel von Sigmund Freud und Martha Bernays wird im Hinblick auf die zwei Seiten von Sigmund Freud - als Despot der Liebe und als sentimentaler Mensch - untersucht, sowie auf Freuds Frauenbild und Eifersucht. Weiterhin wird die Rolle von Martha Bernays als starke Frau und der Streitpunkt Religion in den Briefen beleuchtet. Auch hier werden einzelne Briefe analysiert, um die Sprache der Liebe und die kommunikative Funktion der Briefe aufzuzeigen.
Im abschließenden Kapitel werden die beiden Briefwechsel miteinander verglichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf Sprache, Form und Stil herausgestellt. Es wird deutlich, wie sich die Literarisierung der Liebe im Laufe des 19. Jahrhunderts verändert hat.
Schlüsselwörter
Liebesbrief, Verlobungsbrief, Literarisierung der Liebe, Briefwechsel, Heinrich von Kleist, Wilhelmine von Zenge, Sigmund Freud, Martha Bernays, Sprache der Liebe, Liebesräume, Geschlechterverhältnisse, Kommunikation, Ästhetik.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet den Liebesbrief im 18. Jahrhundert aus?
Das 18. Jahrhundert gilt als das "Jahrhundert des Briefes". Es entstand ein neuer, natürlicher Briefstil nach Gellert, der weg von formalen Regeln hin zu emotionalem Ausdruck und Individualität führte.
Welche Rolle spielt der Verlobungsbrief in der bürgerlichen Gesellschaft?
Er dient einerseits als Ausdruck tiefer emotionaler Verbundenheit und andererseits als Vorbereitung auf die bürgerliche Institution der Ehe, wobei oft Rollenbilder und Erwartungen ausgehandelt wurden.
Was ist das Besondere an Kleists Briefen an Wilhelmine von Zenge?
Kleists Briefe zeigen die Liebe oft als Missverständnis. Sie sind geprägt von einem Erziehungsanspruch gegenüber der Verlobten und dokumentieren den Weg von der Zuneigung zur existenziellen Krise.
Wie unterscheidet sich der Briefwechsel von Sigmund Freud von dem Kleists?
Freuds Briefe an Martha Bernays zeigen ihn sowohl als sentimentalen Liebhaber als auch als "Despoten der Liebe" mit starken Eifersuchtsmotiven, während Martha als starke, reflektierte Partnerin auftritt.
Was bedeutet "Literarisierung der Liebe" im Kontext von Briefen?
Es beschreibt den Prozess, bei dem Liebende durch die Wahl ihrer Sprache, Metaphern und literarischen Bezüge ihre Gefühle in eine ästhetische Form bringen und so "Liebesräume" erschaffen.
- Arbeit zitieren
- Michael Hüttinger (Autor:in), 2014, Der Verlobungsbrief. Literarisierung der Liebe am Beispiel ausgewählter Briefwechsel des 18. und 19. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375382