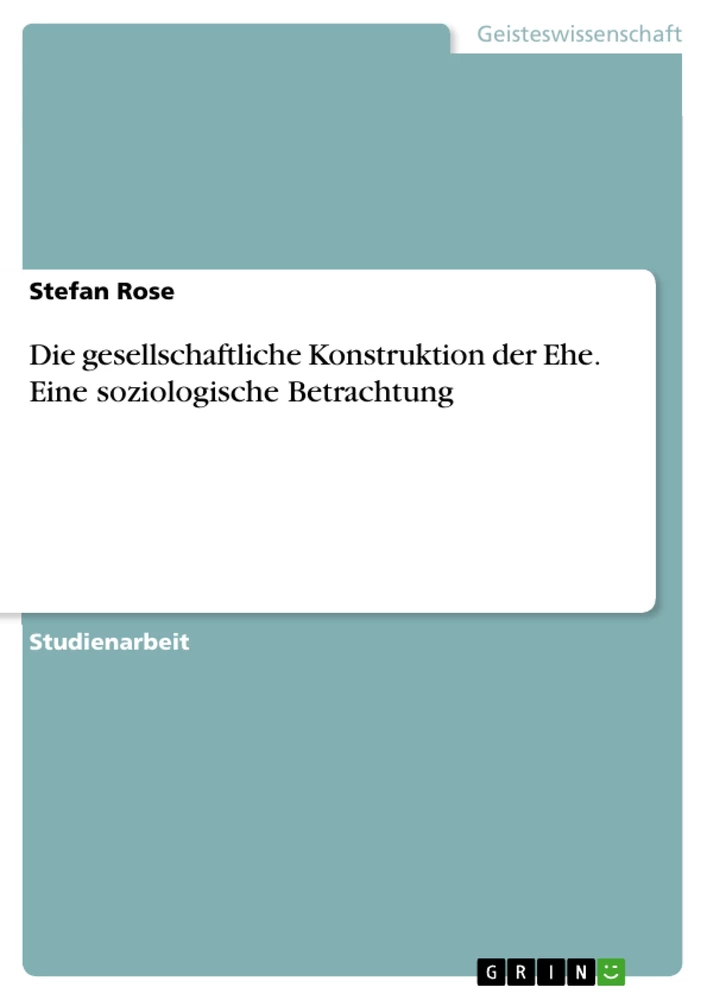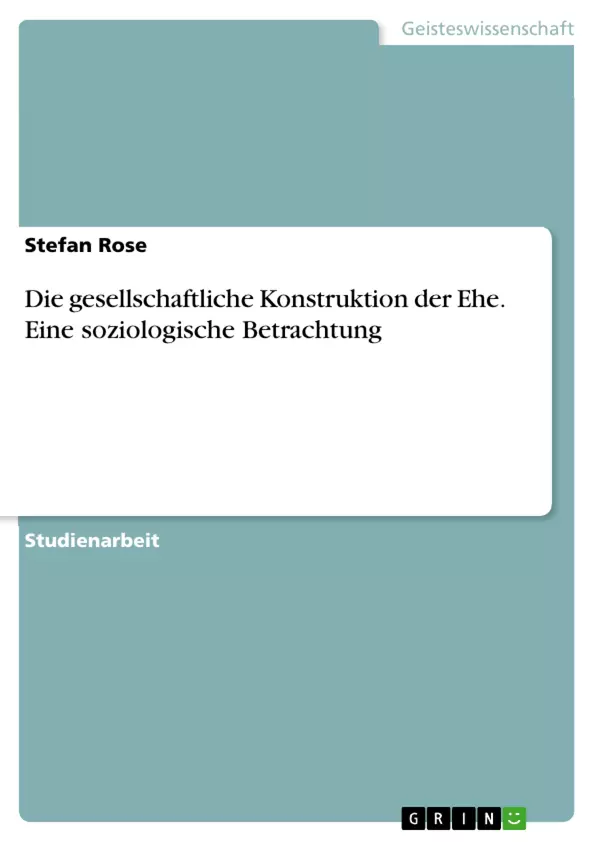Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Konzept der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit und versucht mit ihrer Theorie die soziale Konstruktion der Ehe zu erklären.Viele Aspekt fallen in dieses Themengebiet und nur wenige können in dieser Arbeit behandelt werden.
Die Ehe ist eine besondere soziale Beziehung, die in Deutschland immer noch nur zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden kann. Damit spiegelt die Ehe immer auch das Verhältnis der Geschlechter zueinander wider, denn die Ehe zeigt wie Männer und Frauen zusammenleben wollen. Gleichzeitig ist die Ehe durch gesellschaftliche Konventionen vorbestimmt, d.h., die Ehe zeigt auch, wie Männer und Frauen gesellschaftlich zusammenleben sollen. Es geht somit um die Geschlechterverhältnisse, die Rolle der Frau in der Gesellschaft und um soziologische Geschlechterforschung. Die Ehe ist auch ein Ort der Sexualität, in der Ehe werden Kinder gezeugt und erzogen.
Die Ehe hat sich im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung gewandelt. In dieser Arbeit wird der Wandel als Gegenüberstellung von traditioneller bürgerlicher Ehe und der heutigen Ehe, wie sie in der deutschen Gesell-schaft gelebt wird, zusammengefasst. Als Motor hinter diesem Wandeln wird die Industrialisierung herausgearbeitet und dabei vor allem die neuen Beschäftigungsverhältnisse der Frauen. Die Ehe ist in die Epoche der Moderne eingebettet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Paarbeziehung
- Die bürgerliche Ehe
- Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit
- Prozesse der Entstehung von Alltagswelt
- Geschlecht als soziale Rolle
- Die soziale Konstruktion der Ehe
- Ehe und Identität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann und versucht, mit ihrer Theorie die soziale Konstruktion der Ehe zu erklären. Ergänzt wird die Ausarbeitung durch die Datensätze des ALLBUS 2012 und die Arbeit von Cornelia Koppetsch.
- Soziale Konstruktion der Ehe
- Geschlechterrollen und -verhältnisse
- Die Ehe als gesellschaftliche Institution
- Wandel der Ehe im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung
- Einfluss der Industrialisierung und neuer Beschäftigungsverhältnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text beleuchtet die aktuelle Debatte um die Ehe in Deutschland und die Veränderungen, die die traditionelle Form der Ehe durchläuft. Er stellt die soziale Konstruktion der Wirklichkeit als theoretischen Rahmen vor, um die Ehe zu analysieren. Die Arbeit bezieht sich auf die Daten des ALLBUS 2012 und die Forschung von Cornelia Koppetsch.
Paarbeziehung
Der Abschnitt analysiert die bürgerliche Ehe als Idealbild und stellt sie anderen Formen der Zweierbeziehung gegenüber. Er beleuchtet die Entwicklung von Zweierbeziehungen und die Bedeutung des Begriffs "Zweierbeziehung" nach Karl Lenz, der eine umfassendere Definition von Paarbeziehungen bietet, die auch gleichgeschlechtliche Beziehungen einschließt.
Die bürgerliche Ehe
Dieser Abschnitt beschreibt die bürgerliche Ehe als eine gesellschaftliche Institution, die mit der Industrialisierung entstanden ist. Die bürgerliche Ehe wird als eine monogame Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau mit dem Ziel der Familiengründung durch die Zeugung von Kindern dargestellt. Der Text analysiert die Partnerwahl in der bürgerlichen Ehe und die Rolle der "vernünftigen Liebe" sowie die Herausforderungen, die die Industrialisierung für die Ehe mit sich bringt.
Schlüsselwörter
Soziale Konstruktion der Wirklichkeit, Ehe, Geschlechterrollen, bürgerliche Ehe, Zweierbeziehung, Industrialisierung, ALLBUS, Cornelia Koppetsch, Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Familiensoziologie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet 'soziale Konstruktion der Ehe'?
Nach Berger und Luckmann ist die Ehe kein rein natürliches Phänomen, sondern ein durch gesellschaftliche Konventionen, Rollenerwartungen und geschichtliche Entwicklungen geschaffenes Konstrukt.
Wie veränderte die Industrialisierung die bürgerliche Ehe?
Die Industrialisierung trennte Arbeits- und Wohnwelt und schuf neue Beschäftigungsverhältnisse für Frauen, was das traditionelle Modell der bürgerlichen Ehe grundlegend unter Druck setzte.
Welche Rolle spielen Geschlechterrollen in der Ehe?
Ehe spiegelt immer das aktuelle Geschlechterverhältnis wider; sie zeigt, wie Männer und Frauen gesellschaftlich zusammenleben sollen und welche Rollen ihnen dabei zugeschrieben werden.
Was ist der Unterschied zwischen bürgerlicher Ehe und moderner Paarbeziehung?
Während die bürgerliche Ehe stark institutionell und auf Fortpflanzung ausgerichtet war, betonen moderne Paarbeziehungen stärker die individuelle Identität und emotionale Autonomie.
Was sagt die soziologische Forschung über den Wandel der Ehe aus?
Die Forschung (z.B. ALLBUS 2012) zeigt, dass sich die Ehe in der Moderne wandelt, aber als Ort der Sexualität und Kindererziehung weiterhin eine zentrale, wenn auch veränderte Bedeutung hat.
- Quote paper
- Stefan Rose (Author), 2015, Die gesellschaftliche Konstruktion der Ehe. Eine soziologische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376938