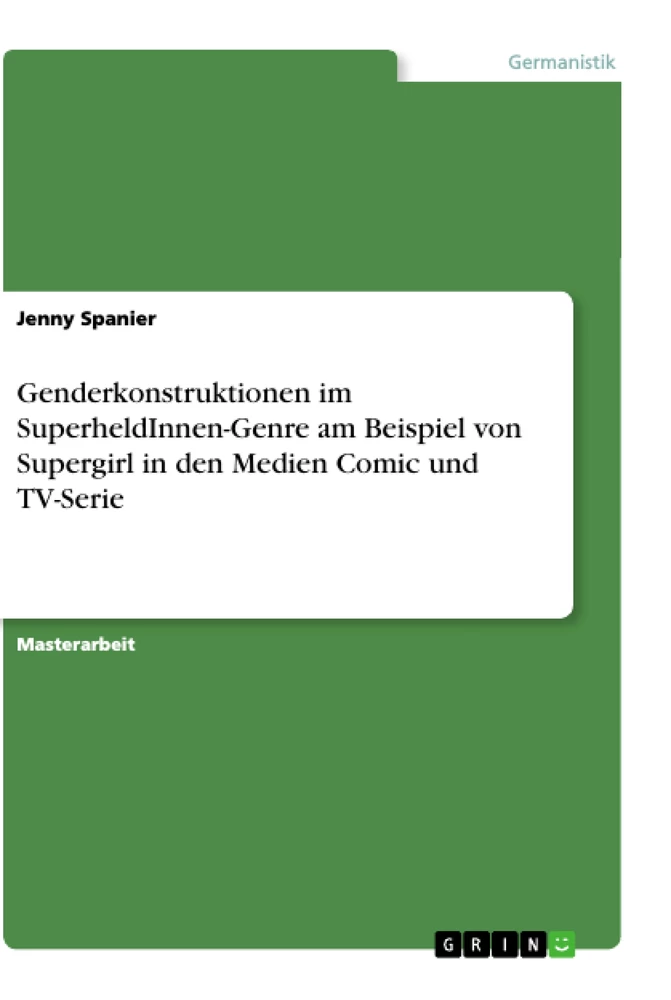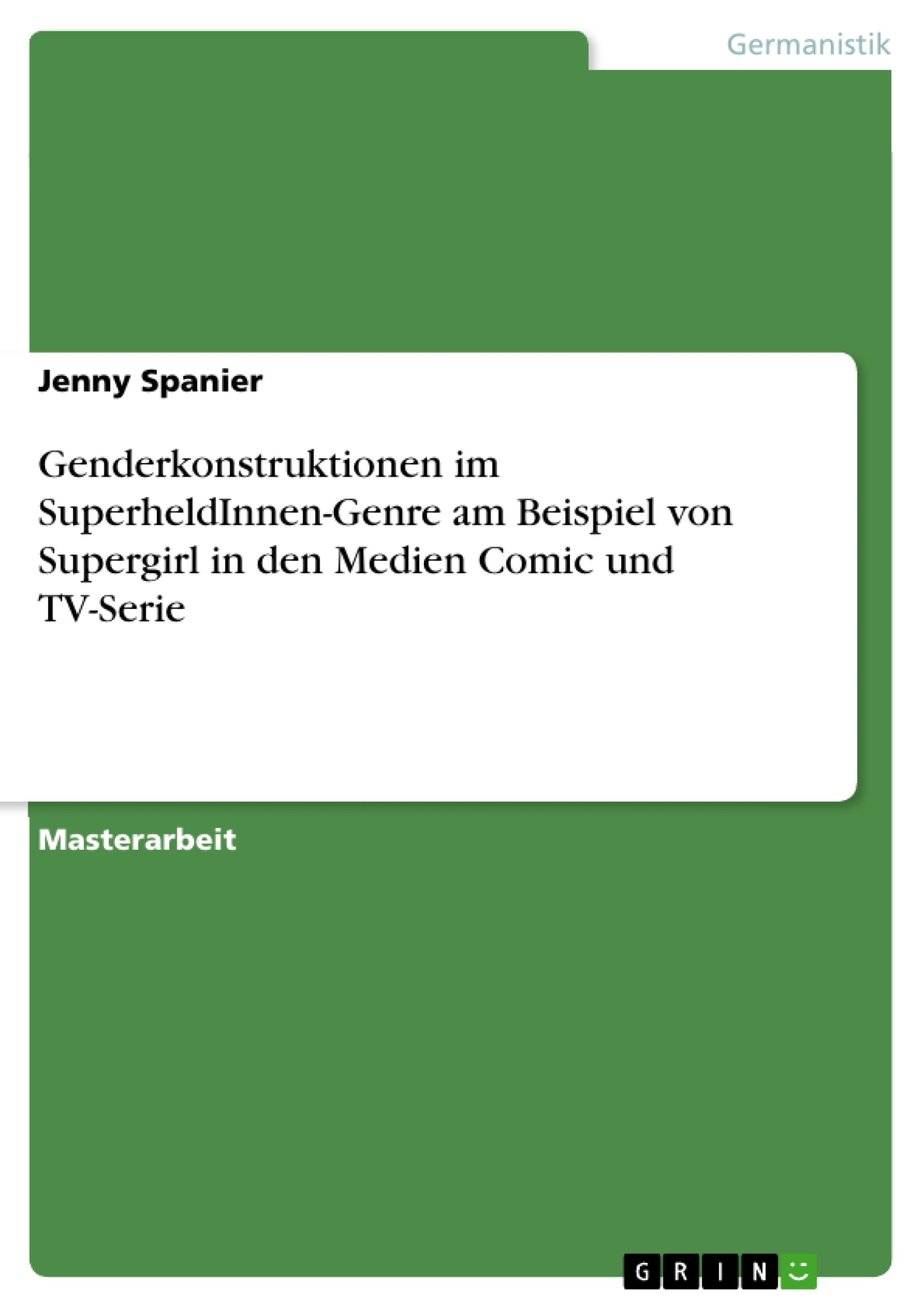Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Genderkonstruktionen im SuperheldInnen-Genre.
Zunächst sollen daher einige Grundsätze der Verbindung dieser Themenfelder herausgearbeitet werden. Dazu gehört die Erklärung, wie sich die Figur des Superhelden im Comic zu einem Genre entwickelt hat und welche Eigenschaften ein Werk aufweisen muss, um diesem zugeordnet zu werden.
Zudem soll versucht werden, eine Antwort auf die Frage zu geben, ob einige der typischen Genre-Elemente bereits als negative Stereotype angesehen werden können und ob diese gleichermaßen eine Aussage über die Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit machen. Und wenn die Rolle der Hauptfigur in geringerem Ausmaß von weiblichen Comic-Figuren vertreten wurde und auch erst in neuster Zeit in Verfilmungen an weibliche Darsteller übergeben wird, welche narrativen Funktionen hatten
Frauen in SuperheldInnen-Comics dann zuvor?
Teil der generellen Überlegung ist außerdem, herauszufinden, auf welche Arten Körper, Kleider und Superkräfte von männlichen sowie weiblichen Figuren im Comic gezeigt werden. Die zentrale Forschungsfrage für die Analyse lautet schließlich: Wie werden Geschlechterdifferenz und Genderrollen innerhalb der Medien Comic und Serie dargestellt und haben sich die möglicherweise abgezeichneten Stereotype und Tropen von den frühen Phasen des Genres zur aktuellen Umsetzung verändert?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung
- 1.2 Fragestellung und Untersuchungsgegenstand
- 1.3 Methodik und Vorgehensweise
- 2. Das SuperheldInnen-Genre
- 2.1 Geschichte des SuperheldInnen-Comics
- 2.2 Mediale Ausbreitung
- 2.3 Genredefinition und Genremerkmale
- 3. Darstellungen von Gender im SuperheldInnen-Genre
- 3.1 Weibliche Helden in der Genreentwicklung
- 3.2 Darstellung von Kleidern und Körpern
- 3.3 Rollen und Machtverhältnisse
- 4. Supergirl und die Konstruktion von Gender
- 4.1 Supergirl im Comic: Old Age zu New Age
- 4.1.1 Publikationsgeschichte der Supergirl-Comics
- 4.1.2 Die Geschichte von Supergirl
- 4.1.3 Darstellung von Kleidern und Körpern
- 4.1.4 Frauenrollen und Machtverhältnisse
- 4.2 Supergirl im Fernsehen: Supergirl (2015)
- 4.2.1 Die Geschichte von Supergirl
- 4.2.2 Darstellung von Kleidern und Körpern
- 4.2.3 Frauenrollen und Machtverhältnisse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion von Gender im Superheldinnen-Genre am Beispiel von Supergirl, indem sie die Darstellung von Supergirl in Comics und Fernsehserien analysiert. Ziel ist es, die Entwicklung der Darstellung weiblicher Superheldinnen im Laufe der Zeit zu beleuchten und zu untersuchen, wie Geschlechterrollen und -stereotype in diesem Genre konstruiert und vermittelt werden.
- Entwicklung des Superheldinnen-Genres und seiner medialen Ausbreitung
- Darstellung weiblicher Helden in der Genreentwicklung und die Herausbildung von Stereotypen
- Analyse der Darstellung von Körpern, Kleidern und Superkräften im Kontext von Gender
- Untersuchung der Rollen und Machtverhältnisse von weiblichen Superheldinnen
- Vergleich der Genderkonstruktionen in Comic und Fernsehserien am Beispiel Supergirl
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Genderkonstruktionen im Superheldinnen-Genre ein und begründet die Relevanz der Untersuchung. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Darstellung von Geschlechterdifferenz und Genderrollen in Comics und Serien und deren Veränderung über die Zeit vor. Supergirl wird als Untersuchungsgegenstand vorgestellt, da sie als eine weibliche Superheldin repräsentativ für die Entwicklung des Genres und die Konstruktion von Gender darin steht.
2. Das SuperheldInnen-Genre: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des Superheldinnen-Comics, seine mediale Verbreitung und die Definition des Genres. Es analysiert typische Genremerkmale und diskutiert, inwieweit diese bereits als Stereotype angesehen werden können und Aussagen über Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit treffen. Die geringe Repräsentation weiblicher Hauptfiguren in früheren Phasen des Genres wird thematisiert.
3. Darstellungen von Gender im SuperheldInnen-Genre: Kapitel 3 untersucht allgemein die Darstellung von Gender im Superheldinnen-Genre. Es analysiert die Entwicklung weiblicher Helden im Laufe der Genregeschichte, die Darstellung von Kleidern und Körpern und die damit verbundenen Botschaften, sowie die Rollen und Machtverhältnisse, die weiblichen Figuren zugeschrieben werden. Hier werden allgemeine Tendenzen und Muster aufgezeigt, die später im Detail am Beispiel von Supergirl untersucht werden.
4. Supergirl und die Konstruktion von Gender: Das Kernkapitel analysiert die Konstruktion von Gender am Beispiel von Supergirl in Comic und Fernsehserie. Es untersucht die Publikationsgeschichte der Supergirl-Comics, die Darstellung ihrer Geschichte, ihrer Kleidung und ihres Körpers, sowie die Rollen und Machtverhältnisse, in denen sie agiert. Ein Vergleich zwischen der Comic- und der Fernseh-Darstellung Supergirls wird durchgeführt, um Entwicklungen und Veränderungen in der Genderkonstruktion über die Medien hinweg aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Genderkonstruktionen, Superheldinnen-Genre, Supergirl, Comic, Fernsehserie, Geschlechterrollen, Stereotype, Medienanalyse, Weiblichkeit, Machtverhältnisse, Genreentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Genderkonstruktionen am Beispiel Supergirl
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion von Gender im Superheldinnen-Genre anhand des Beispiels Supergirl. Analysiert werden die Darstellungen von Supergirl in Comics und Fernsehserien, um die Entwicklung der Darstellung weiblicher Superheldinnen im Laufe der Zeit und die Konstruktion von Geschlechterrollen und -stereotypen in diesem Genre zu beleuchten.
Welche Aspekte werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte: die Entwicklung des Superheldinnen-Genres und seine mediale Ausbreitung; die Darstellung weiblicher Heldinnen und die Herausbildung von Stereotypen; die Analyse der Darstellung von Körpern, Kleidern und Superkräften im Kontext von Gender; die Untersuchung der Rollen und Machtverhältnisse weiblicher Superheldinnen; und einen Vergleich der Genderkonstruktionen in Comic und Fernsehserien am Beispiel Supergirl.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Einführung, Fragestellung, Methodik); Das Superheldinnen-Genre (Geschichte, mediale Ausbreitung, Genremerkmale); Darstellungen von Gender im Superheldinnen-Genre (weibliche Helden, Kleidung, Körper, Rollen und Machtverhältnisse); Supergirl und die Konstruktion von Gender (Supergirl im Comic und im Fernsehen, Analyse von Geschichte, Kleidung, Körper, Rollen und Machtverhältnissen); und Fazit.
Wie wird Supergirl in der Arbeit analysiert?
Supergirl dient als Fallstudie. Die Arbeit analysiert die Darstellung von Supergirl in verschiedenen Comics und der Fernsehserie "Supergirl" (2015). Dabei werden die Publikationsgeschichte der Comics, die Geschichte Supergirls selbst, die Darstellung ihrer Kleidung und ihres Körpers sowie die Rollen und Machtverhältnisse, in denen sie agiert, untersucht und miteinander verglichen.
Welche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Medienanalyse, die sich auf die Untersuchung der Darstellungen von Supergirl in Comics und Fernsehserien konzentriert. Analysiert werden visuelle Aspekte (Kleidung, Körper), narrative Aspekte (Geschichte, Rollen) und die implizierten Botschaften bezüglich Gender und Geschlechterrollen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Genderkonstruktionen, Superheldinnen-Genre, Supergirl, Comic, Fernsehserie, Geschlechterrollen, Stereotype, Medienanalyse, Weiblichkeit, Machtverhältnisse, Genreentwicklung.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie Geschlechterdifferenz und Genderrollen in Comics und Serien über die Zeit dargestellt werden und wie sich diese Darstellungen entwickelt haben. Im Besonderen wird untersucht, wie Supergirl als weibliche Superheldin diese Entwicklung repräsentiert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung der Darstellung weiblicher Superheldinnen im Laufe der Zeit zu beleuchten und zu untersuchen, wie Geschlechterrollen und -stereotype in diesem Genre konstruiert und vermittelt werden.
- Quote paper
- Jenny Spanier (Author), 2019, Genderkonstruktionen im SuperheldInnen-Genre am Beispiel von Supergirl in den Medien Comic und TV-Serie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539149