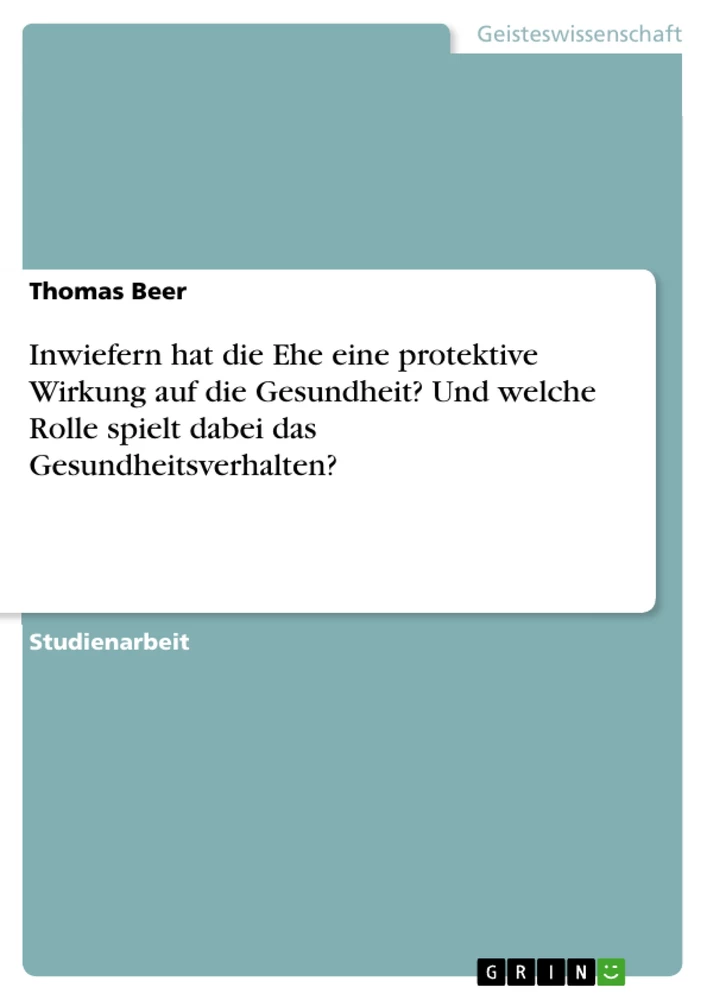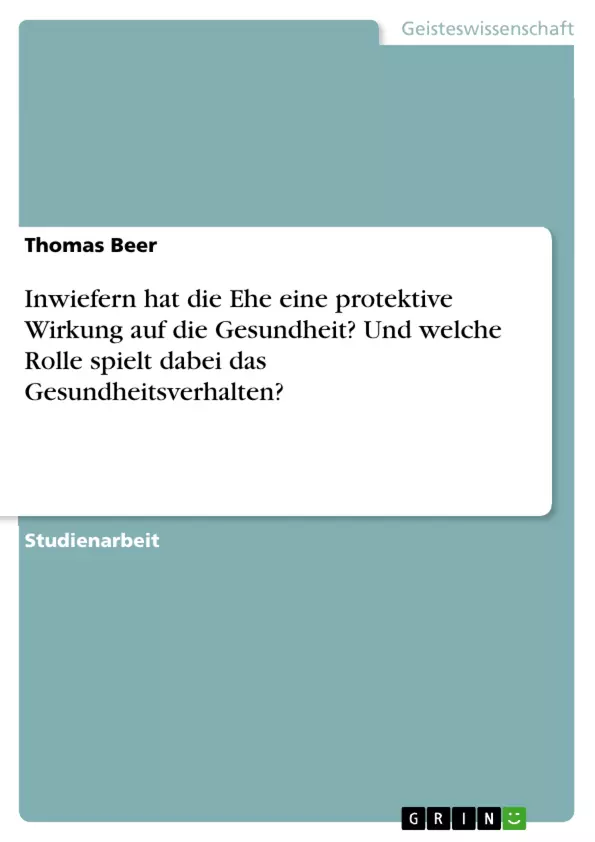Gesundheit kann mit Sicherheit als eine der wichtigsten Ressourcen im Leben bezeichnet werden. Gibt es doch kaum einen Lebensbereich, der nicht durch Gesundheit, bzw. vielmehr das Fehlen dieser, beeinflusst wird. Ungleiche Chancen auf ein Leben in Gesundheit, und damit einhergehend ein ungleiches Sterblichkeitsrisiko, können somit getrost als eine bedeutende soziale Ungleichheit bezeichnet werden. Ein Faktor, der schon seit sehr langer Zeit in Zusammenhang mit Gesundheit beobachtet wird, ist die Ehe.
Ein Zusammenhang zwischen dem Familienstand und der Gesundheit wurde durch eine Vielzahl an empirischen Untersuchungen bestätigt: Menschen, die verheiratet sind, erfreuen sich durchschnittlich besserer Gesundheit und leben länger. Weniger eindeutig ist die Forschungsliteratur bezüglich der Frage, warum dies so ist. Hier besteht seit langem eine kontroverse Diskussion: Die Protektionshypothese, die besagt, dass ein Leben in Ehe einen positiven, schützenden Einfluss auf die Gesundheit ausüben kann, steht hier der Selektionshypothese gegenüber, die davon ausgeht, dass eine höhere Heiratschance von gesunden Personen gegenüber weniger gesunden der Grund dafür ist, warum Verheiratete am Ende auch über eine bessere durchschnittliche Gesundheit verfügen als Unverheiratete.
Ebenso denkbar und Teil der Kontroverse ist eine Mischung aus beiden Effekten. Nichteindeutige Ergebnisse wurden in der Vergangenheit vor allem auch darauf zurückgeführt, dass die meisten Analysen auf Querschnittsdaten beruhten. Des Weiteren finden sich auch immer wieder Geschlechterunterschiede, die darauf hindeuten, dass Männer in Bezug auf ihre Gesundheit stärker von einer Ehe profitieren als Frauen. Die vorliegende Arbeit reit sich in diesen Forschungskontext ein. Basierend auf den Daten des Sozio-oekonomischen Panels soll in einem ersten Schritt untersucht werden, inwiefern ein protektiver Effekt der Ehe auf die Gesundheit nachgewiesen werden kann. Durch Anwendung von Fixed-Effects-Schätzern können dabei mögliche Selektionseffekte herausdifferenziert werden. In einem zweiten Schritt soll untersucht werden, ob sich geschlechtsspezifische Unterschiede in einem möglichen Einfluss der Ehe auf die Gesundheit zeigen. In einem dritten und letzten Schritt wird anschließend eine Veränderung des Gesundheitsverhaltens als möglicher Mechanismus analysiert. Hierfür wird der Tabakkonsum und die Ernährung in der statistischen Analyse berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theorie und Hypothesen
- 3 Daten, Operationalisierung und Methoden
- 4 Deskriptive und multivariate Analysen
- 5 Zusammenfassung und Diskussion.
- 6 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die protektive Wirkung der Ehe auf die Gesundheit anhand von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (v29). Im Fokus steht dabei die Frage, ob die Ehe einen positiven Einfluss auf die Gesundheit hat und ob dieser Einfluss durch eine Veränderung des Gesundheitsverhaltens erklärt werden kann. Dabei werden insbesondere geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beziehung zwischen Ehe und Gesundheit analysiert.
- Protektive Wirkung der Ehe auf die Gesundheit
- Selektionseffekte in Bezug auf die Ehe und Gesundheit
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im Einfluss der Ehe auf die Gesundheit
- Veränderung des Gesundheitsverhaltens als möglicher Mechanismus
- Einfluss des Tabakkonsums und der Ernährung auf die Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz des Themas Gesundheit im Kontext sozialer Ungleichheit. Es wird ein historischer Überblick über die Forschungsliteratur zum Zusammenhang zwischen Ehe und Gesundheit gegeben und die Problematik der Unterscheidung zwischen Selektions- und Protektionseffekten erläutert. Abschließend werden die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit vorgestellt.
2 Theorie und Hypothesen
Das zweite Kapitel stellt die relevanten Theorien und Konzepte vor, die für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Ehe und Gesundheit relevant sind. Die Protektionshypothese, die Selektionshypothese und mögliche vermittelnde Faktoren wie soziale Kontrolle, soziale Unterstützung und soziale Rollenübernahme werden erläutert. Die Hypothesen der Arbeit werden aus den vorgestellten Theorien abgeleitet und in einer Abbildung visualisiert.
3 Daten, Operationalisierung und Methoden
Dieses Kapitel beschreibt die Datengrundlage der Arbeit, die im Sozio-oekonomischen Panel (v29) liegt. Es werden die zentralen Variablen operationalisiert und die angewandten Methoden, insbesondere Fixed-Effects-Schätzer, erläutert.
4 Deskriptive und multivariate Analysen
Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der deskriptiven und multivariaten Analysen vorgestellt. Es wird die Verteilung der zentralen Variablen, die Ergebnisse der multivariaten Regressionsanalyse und die Berücksichtigung des Gesundheitsverhaltens dargestellt.
5 Zusammenfassung und Diskussion
Die Zusammenfassung der Ergebnisse und die Diskussion der Limitationen werden in diesem Kapitel vorgestellt.
Schlüsselwörter
Ehe, Gesundheit, Protektion, Selektion, Gesundheitsverhalten, Sozio-oekonomisches Panel (SOEP), Fixed-Effects-Schätzer, Tabakkonsum, Ernährung, Geschlechterunterschiede.
Häufig gestellte Fragen
Hat die Ehe wirklich eine schützende Wirkung auf die Gesundheit?
Studien zeigen, dass Verheiratete im Durchschnitt gesünder sind und länger leben. Die Arbeit untersucht, ob dies ein echter Schutzeffekt (Protektion) oder ein Auswahlprozess (Selektion) ist.
Was besagt die Selektionshypothese?
Sie geht davon aus, dass gesunde Menschen eine höhere Chance haben zu heiraten, weshalb Verheiratete bereits vor der Ehe einen Gesundheitsvorteil haben.
Profitieren Männer stärker von der Ehe als Frauen?
Die Forschung deutet darauf hin, dass Männer oft stärker von der sozialen Kontrolle und Unterstützung durch die Ehefrau profitieren, was sich positiv auf ihr Gesundheitsverhalten auswirkt.
Welche Rolle spielt das Gesundheitsverhalten in der Ehe?
Die Arbeit analysiert, ob sich Faktoren wie Tabakkonsum und Ernährung nach der Heirat zum Positiven verändern und so die Gesundheit schützen.
Welche Daten wurden für die Analyse genutzt?
Die Untersuchung basiert auf Langzeitdaten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) unter Anwendung von Fixed-Effects-Schätzern.
- Citation du texte
- Thomas Beer (Auteur), 2017, Inwiefern hat die Ehe eine protektive Wirkung auf die Gesundheit? Und welche Rolle spielt dabei das Gesundheitsverhalten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379160