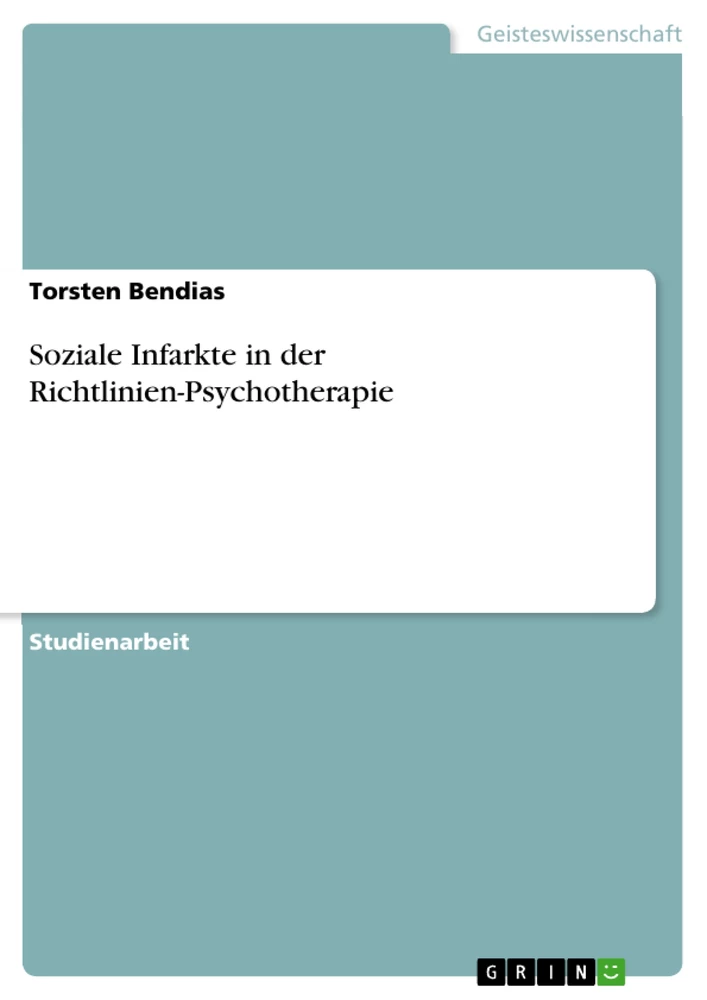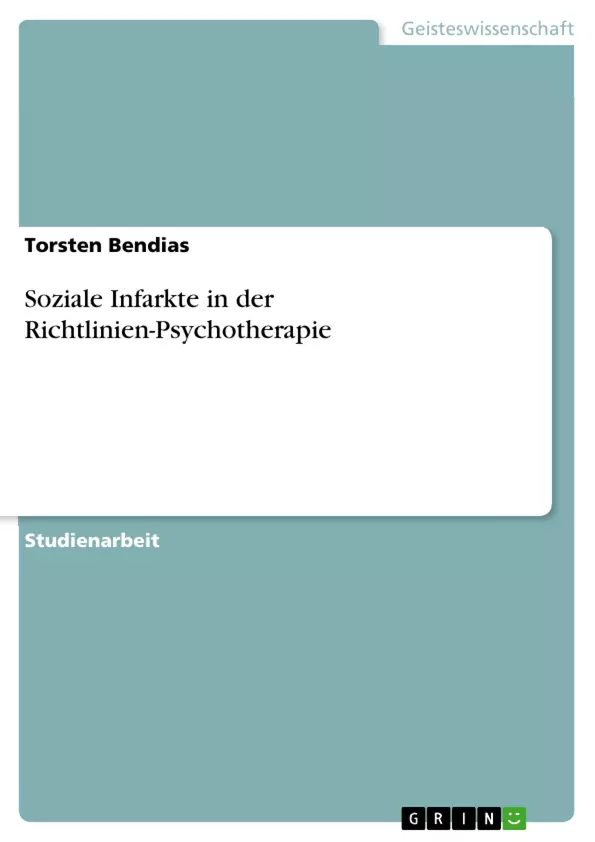In der ambulanten Praxis werden Psychotherapeuten mit sozialen Brandherden konfrontiert, die weit über ihre Routinen hinausgehen. Die Patienten durchkreuzen die normale Anamnese, indem sie von Notlagen berichten, welche sich wechselseitig rasch aufschaukeln und viele Lebensbereiche betreffen können. Ihre Erschöpfung fördert zudem weitere Schadensereignisse. Es besteht zuweilen der Wunsch nach Freitod.
Der Psychotherapeut befindet sich meist umgehend in einer Notidentifikation, ist mit eigener Angst, Orientierungs-und Kompetenzlücken konfrontiert. An der praxisorientierten Arbeit werden Fallvignetten vorgestellt, die Besonderheiten für das Arbeitsbündnis geklärt, die Psychodynamik der Notidentifikation reflektiert und tiefenpsychologische Methodiken vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist ein sozialer Infarkt?
- Fallbeispiel
- Globalisierungstendenzen und ihr Einfluss auf soziale Infarkte
- Gesundheitspolitische Modifizierungen und Lösungsansätze
- Können niedergelassene Psychotherapeuten Patienten mit sozialen Infarkten überhaupt helfen?
- Besonderheiten des SI auf der Ebene des Arbeitsbündnisses
- Besonderheiten des SI – therapeutisch-psychodynamische Faktoren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz analysiert das neuartige Phänomen des „Sozialen Infarkts“, das sich durch eine rasante Eskalation von Krisen in verschiedenen Lebensbereichen auszeichnet. Er beleuchtet die Hintergründe und Dynamiken des Sozialen Infarkts, die sich aus der globalen Dynamisierung und dem Wandel der Arbeitswelt ergeben. Der Autor erörtert die Herausforderungen, denen Psychotherapeuten in der Behandlung von Patienten mit Sozialen Infarkten gegenüberstehen, und beleuchtet die Besonderheiten der psychodynamischen Prozesse in dieser Situation.
- Definition und Charakteristika des Sozialen Infarkts
- Globalisierungstendenzen und ihre Auswirkungen auf die psychosoziale Situation
- Herausforderungen für die Psychotherapie im Umgang mit Sozialen Infarkten
- Psychodynamische Prozesse und therapeutische Ansätze
- Gesundheitspolitische Implikationen und Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
- Was ist ein sozialer Infarkt?: Dieses Kapitel definiert den Sozialen Infarkt als eine Eskalation von Krisen in verschiedenen Lebensbereichen, die zu einer Dekompensation des Individuums führt. Es stellt den Unterschied zum Burnout heraus und beschreibt die verschiedenen Phasen des Sozialen Infarkts.
- Fallbeispiel: Ein fiktives Fallbeispiel illustriert die Dynamik eines Sozialen Infarkts und die damit verbundenen Herausforderungen für die betroffene Person.
- Globalisierungstendenzen und ihr Einfluss auf soziale Infarkte: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Globalisierung und der damit verbundenen Veränderungen in der Arbeitswelt und im gesellschaftlichen Zusammenleben als maßgebliche Faktoren für die Entstehung von Sozialen Infarkten.
Schlüsselwörter
Soziale Infarkte, Globalisierung, Digitalisierung, Arbeitswelt, Psychotherapie, Psychodynamik, Arbeitsbündnis, Gesundheitspolitik, Krisenintervention, Lebenskrisen, Lebensbereiche, Eskalation, Dekompensation, Burnout, Freelancer, Risikoorientierung, Tempodefensive, Funktionsverluste, VUCA-World.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „sozialer Infarkt“ in der Psychotherapie?
Ein sozialer Infarkt bezeichnet eine rapide Eskalation von Krisen in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig, die zu einer völligen Dekompensation und Erschöpfung des Individuums führt.
Wie unterscheidet sich ein sozialer Infarkt vom klassischen Burnout?
Während Burnout oft arbeitszentriert ist, umfasst der soziale Infarkt eine Kettenreaktion aus privaten, beruflichen und sozialen Notlagen, die sich gegenseitig aufschaukeln.
Welchen Einfluss hat die Globalisierung auf soziale Infarkte?
Die zunehmende Digitalisierung, Flexibilisierung der Arbeitswelt (VUCA-World) und der Wegfall stabiler Strukturen erhöhen das Risiko für plötzliche soziale Zusammenbrüche.
Können niedergelassene Psychotherapeuten bei sozialen Infarkten helfen?
Die Therapie erfordert spezielle psychodynamische Ansätze und oft eine Krisenintervention, da die Patienten sich in einer existenziellen Notlage befinden, die über die normale Anamnese hinausgeht.
Was ist eine „Notidentifikation“ des Therapeuten?
Es beschreibt die Situation, in der der Therapeut durch die Schwere der Krise des Patienten selbst mit Angst oder Kompetenzlücken konfrontiert wird und seine professionelle Distanz wahren muss.
- Quote paper
- Torsten Bendias (Author), 2017, Soziale Infarkte in der Richtlinien-Psychotherapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380490