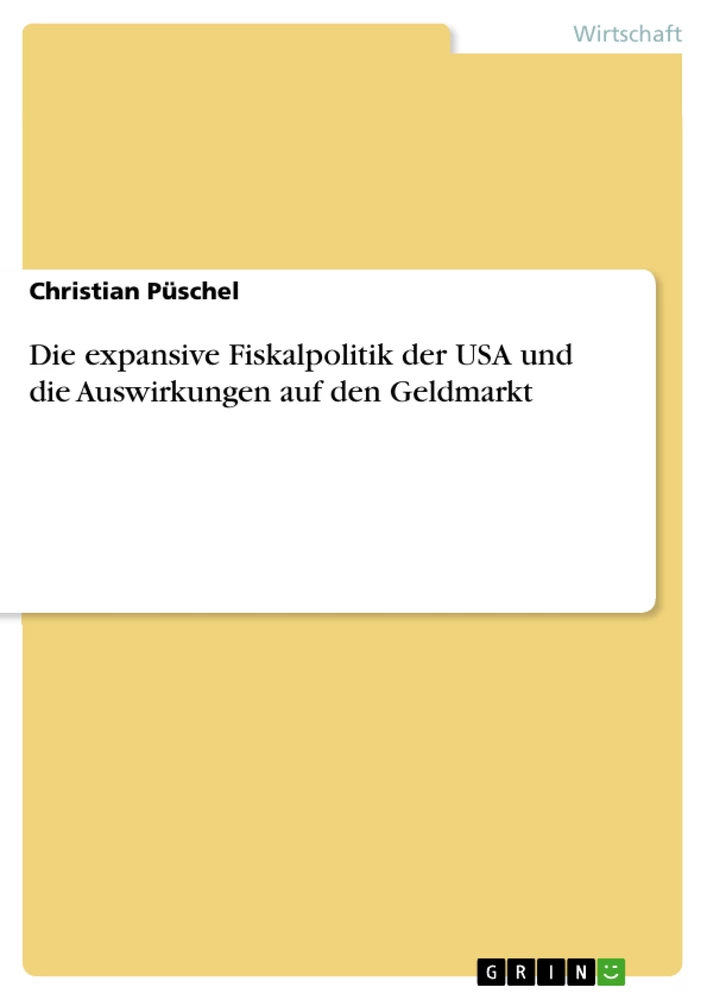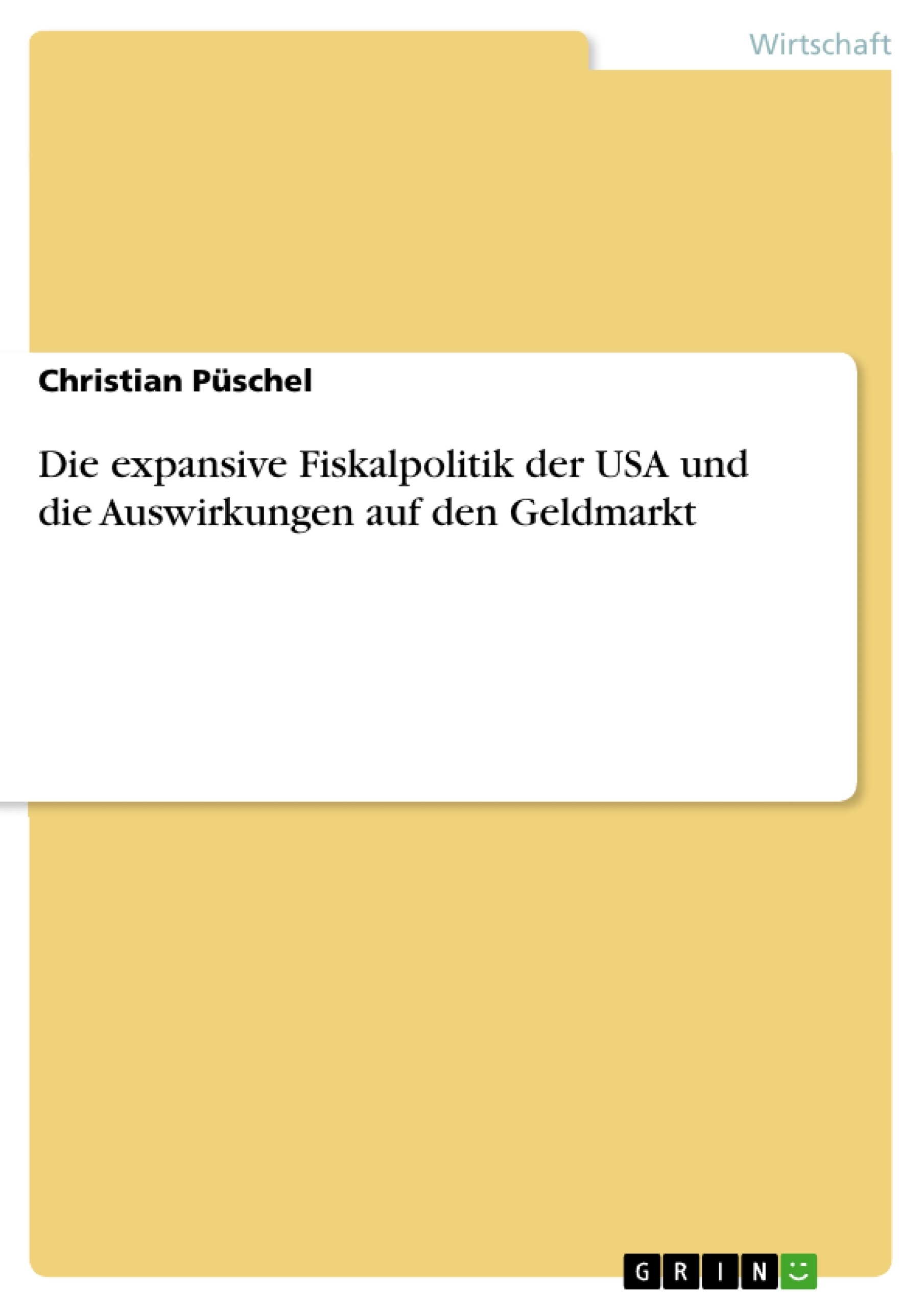„You have to think anyway, so why not think big?” (Donald Trump)
Zum Jahresbeginn 2017 sorgt insbesondere die in Aussicht gestellte Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump für viele Veränderungen. Seine durchaus kritisch zu betrachtende handelspolitische Haltung und sein Bekenntnis, die Haushaltsausgaben auszuweiten, beeinflussen den Ausblick ins Wirtschaftsjahr 2017 maßgeblich. In seiner Zeit als Präsident der USA plant Donald Trump eine expansive Fiskalpolitik. Die geplanten Steuersenkun-gen und erhöhten Haushaltsausgaben für Infrastrukturprojekte in Höhe von etwa 2 Prozent des BIP dürften sich aber positiv auf die ohnehin bereits robuste wirtschaftliche Lage der USA auswirken.
Donald Trump spricht selbst von der größten „Steuer-Revolution“ seit der Reform von Ronald Reagan in den 1980er-Jahren. Man muss aber beachten, dass Amerika zurzeit kein Konjunkturprogramm bräuchte, die US-Konjunktur ein stabiles Wachstum aufweisen kann und das war damals bei Reagan anders. Die von Reagan veranlassten Steuersenkungen für Besserverdiener und Unternehmen sollten die Investitionen ankurbeln und mehr Wachstum und Steuereinnahmen generieren, um sich somit selbst zu finanzieren. Dieses Konzept geht auf den US-Ökonom Arthur Laffer zurück. Jedoch gelten die „Reaganomics“ als gescheitert, denn sie hinterließen verheerende Spuren im Staatshaushalt. Die Schuldenlast der USA stieg von 914 Milliarden USD im Jahr 1980 auf 2,6 Billionen USD im Jahr 1988 an. Anders als Reagan möchte Trump aber auch die Steuerlast der unteren Mittelschicht senken und den Mindestlohn erhöhen.
Die genannten Maßnahmen in der angestrebten expansiven Fiskalpolitik von Trump könn-ten das Wachstum und die Investitionen ankurbeln und neue Arbeitsplätze schaffen, allerdings könnten die daraus resultierenden höheren Ausgaben und sinkenden Steuern die fiskalische Stabilität bedrohen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aussicht auf die expansive Fiskalpolitik Trumps
- Aufbau der Arbeit
- Die antizyklische Fiskalpolitik
- Die Konjunkturpolitik und der Konjunkturzyklus
- Die restriktive Fiskalpolitik
- Die expansive Fiskalpolitik
- Auswirkungen der expansiven Fiskalpolitik im Modell
- Auswirkungen auf den Geldmarkt
- Probleme und negative Aspekte einer expansiven Fiskalpolitik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der expansiven Fiskalpolitik der USA, insbesondere der von Präsident Trump angekündigten Maßnahmen, auf den Geldmarkt. Sie analysiert sowohl die positiven Effekte auf Wachstum und Beschäftigung als auch die potenziellen Risiken für die fiskalische Stabilität. Die Arbeit bewertet kritisch die angestrebte Konjunkturpolitik im Kontext der aktuellen wirtschaftlichen Lage der USA.
- Auswirkungen der expansiven Fiskalpolitik auf den Geldmarkt
- Bewertung der geplanten Steuererleichterungen und erhöhten Staatsausgaben
- Analyse der Risiken einer expansiven Fiskalpolitik für die US-Wirtschaft
- Vergleich mit der Fiskalpolitik unter Ronald Reagan ("Reaganomics")
- Der Konjunkturzyklus und seine Relevanz für die Fiskalpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die geplante expansive Fiskalpolitik der USA unter Präsident Trump vor und skizziert deren potenziellen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Sie verweist auf die geplanten Steuersenkungen und Infrastrukturinvestitionen und setzt diese in den Kontext der bestehenden wirtschaftlichen Lage und der Erfahrungen mit der Fiskalpolitik unter Reagan. Der kritische Blick auf die möglichen Folgen und die Struktur der Arbeit werden dargelegt.
Die antizyklische Fiskalpolitik: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Fiskalpolitik und erläutert deren Rolle in der Konjunkturpolitik. Es beschreibt den Konjunkturzyklus und unterscheidet zwischen restriktiver und expansiver Fiskalpolitik. Es werden unterschiedliche Arten der Fiskalpolitik (angebots- und nachfrageorientiert) erklärt und die Ziele der Konjunkturpolitik, wie Vollbeschäftigung und Preisstabilität, herausgestellt.
Auswirkungen der expansiven Fiskalpolitik im Modell: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die erwarteten Auswirkungen der expansiven Fiskalpolitik auf den Geldmarkt. Es analysiert die möglichen Folgen der Maßnahmen von Präsident Trump für die Geldmenge, Zinsen und Investitionen. Die Arbeit geht dabei auch auf potenzielle negative Folgen ein und erörtert kritische Aspekte einer solchen Politik im bestehenden wirtschaftlichen Kontext.
Schlüsselwörter
Expansive Fiskalpolitik, USA, Geldmarkt, Konjunkturpolitik, Konjunkturzyklus, Steuersenkungen, Staatsausgaben, Infrastrukturinvestitionen, Reaganomics, fiskalische Stabilität, Wirtschaftswachstum, Geldmenge, Zinsen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen der expansiven Fiskalpolitik Trumps auf den Geldmarkt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der expansiven Fiskalpolitik der USA unter Präsident Trump, insbesondere seiner geplanten Steuersenkungen und Infrastrukturinvestitionen, auf den Geldmarkt. Sie untersucht sowohl positive Effekte (z.B. auf Wachstum und Beschäftigung) als auch potenzielle Risiken für die fiskalische Stabilität.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die antizyklische Fiskalpolitik, den Konjunkturzyklus, restriktive und expansive Fiskalpolitik, die Auswirkungen expansiver Fiskalpolitik auf den Geldmarkt (Geldmenge, Zinsen, Investitionen), die Bewertung der geplanten Steuererleichterungen und erhöhten Staatsausgaben, Risiken einer expansiven Fiskalpolitik für die US-Wirtschaft und einen Vergleich mit der Fiskalpolitik unter Ronald Reagan ("Reaganomics").
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur antizyklischen Fiskalpolitik, ein Kapitel zu den Auswirkungen der expansiven Fiskalpolitik im Modell und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Fragestellung und den Aufbau vor. Das Kapitel zur antizyklischen Fiskalpolitik erklärt grundlegende Begriffe und Konzepte. Das Kapitel zu den Auswirkungen der expansiven Fiskalpolitik im Modell analysiert die erwarteten Folgen auf den Geldmarkt.
Welche Schlüsselfragen werden untersucht?
Zentrale Fragen sind: Wie wirkt sich die expansive Fiskalpolitik auf den Geldmarkt aus? Welche Risiken birgt diese Politik für die US-Wirtschaft? Wie lässt sich die Politik Trumps mit der von Reagan vergleichen? Welche Rolle spielt der Konjunkturzyklus?
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Expansive Fiskalpolitik, USA, Geldmarkt, Konjunkturpolitik, Konjunkturzyklus, Steuersenkungen, Staatsausgaben, Infrastrukturinvestitionen, Reaganomics, fiskalische Stabilität, Wirtschaftswachstum, Geldmenge, Zinsen.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt den Inhalt der Einleitung (Vorstellung der Fragestellung und des Aufbaus), des Kapitels zur antizyklischen Fiskalpolitik (Erklärung der Fiskalpolitik und des Konjunkturzyklus) und des Kapitels zu den Auswirkungen der expansiven Fiskalpolitik im Modell (Analyse der Auswirkungen auf den Geldmarkt).
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Wissenschaftler, die sich mit Fiskalpolitik und Konjunkturtheorie befassen, sowie für alle, die sich für die Wirtschaftspolitik der USA interessieren.
- Arbeit zitieren
- Christian Püschel (Autor:in), 2017, Die expansive Fiskalpolitik der USA und die Auswirkungen auf den Geldmarkt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380700