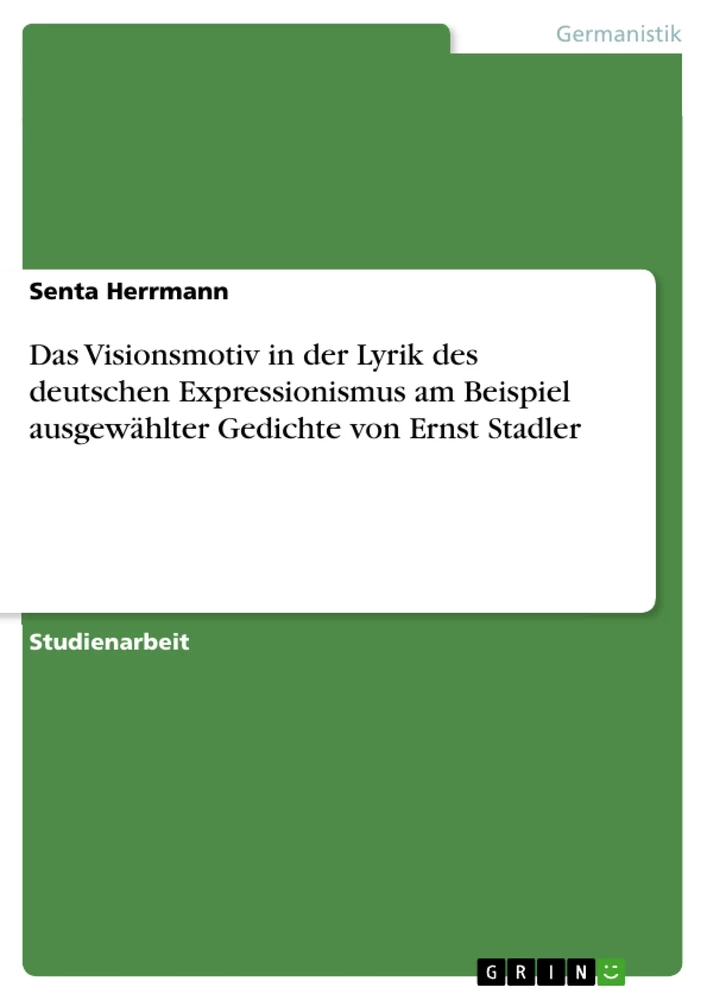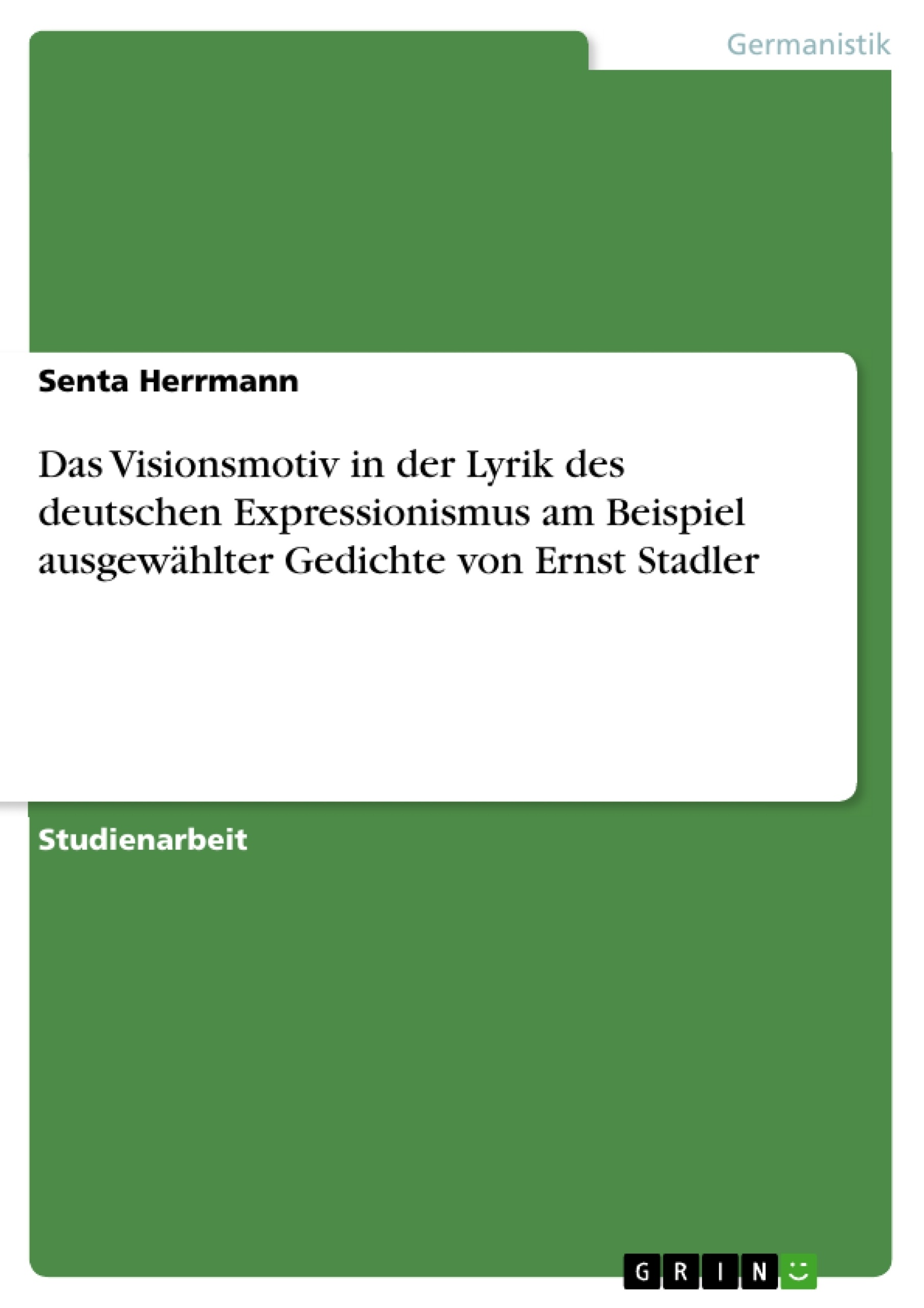Die der Arbeit zugrunde liegende Fragestellung ist, wie Ernst Stadler das Visionsmotiv in seine Gedichte einbettet und inwieweit seine Darstellung mit der hauptsächlichen Darstellung der Vision im Expressionismus übereinstimmt. Sprich: Welche Aspekte der eigentlichen Tradition finden sich bei ihm wieder und was erscheint als eher individuell und 'stadlersspezifisch'? Dabei soll vor allem gezeigt werden, dass Stadler trotz einiger Übereinstimmungen sehr eigene Darstellungsweisen des Motivs nutzt und nicht immer an die Traditionen seiner Zeit anknüpft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Motiv der Vision im Expressionismus - Bedeutung und Darstellung
- Stadler und der Expressionismus - Abriss
- Der Visionsaspekt in Stadlers Gedichten
- Lover's Seat
- Reinigung
- Winteranfang
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Visionsmotiv in den Gedichten von Ernst Stadler und setzt es in Bezug zum allgemeinen Verständnis des Motivs im Expressionismus. Sie analysiert, wie Stadler das Visionsmotiv in seine Gedichte einbettet und inwiefern seine Darstellung mit der hauptsächlichen Darstellung der Vision im Expressionismus übereinstimmt. Dabei soll gezeigt werden, dass Stadler trotz einiger Übereinstimmungen sehr eigene Darstellungsweisen des Motivs nutzt und nicht immer an die Traditionen seiner Zeit anknüpft.
- Die Bedeutung und Darstellung des Visionsmotivs im Expressionismus
- Die Einbettung des Visionsmotivs in Stadlers Gedichten
- Der Vergleich zwischen Stadlers Darstellung und der allgemeinen Darstellung des Motivs im Expressionismus
- Die Analyse ausgewählter Gedichte von Stadler
- Die Untersuchung der Individualität von Stadlers Darstellung des Visionsmotivs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Expressionismus ein und stellt Ernst Stadler als Vertreter dieser literarischen Epoche vor. Sie betont die Bedeutung des Visionsmotivs im Expressionismus und erläutert die Fragestellung der Arbeit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Bedeutung und Darstellung des Visionsmotivs im Expressionismus. Es analysiert den Kontext, in dem dieses Motiv entstand, und die Merkmale, die es charakterisieren.
Das dritte Kapitel bietet einen kurzen Abriss über Ernst Stadler und seine Stilistik. Es skizziert seinen Werdegang und seine literarische Bedeutung.
Das vierte Kapitel analysiert drei ausgewählte Gedichte von Stadler: „Lover's Seat“, „Reinigung“ und „Winteranfang“. Es untersucht, wie Stadler das Visionsmotiv in diesen Gedichten einsetzt und inwiefern seine Darstellung mit der allgemeinen Darstellung des Motivs im Expressionismus übereinstimmt.
Schlüsselwörter
Expressionismus, Vision, Ernst Stadler, Prophetie, Metaphysik, Ekstasis, Entgrenzung, Entrückung, Vergänglichkeit, Verwesung, Verfall, Traumwelt, Aufbruch, Bewegung, Chaos, Weltbild, Naturbilder, Liebeslyrik, Zukunftsvisionen, Traditionsbruch, Individuelle Darstellungsweise.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Visionsmotiv im Expressionismus?
Es beschreibt die Darstellung von prophetischen Schauungen, Ekstase oder metaphysischen Erfahrungen, die oft den Aufbruch oder den Zerfall der Welt thematisieren.
Wie unterscheidet sich Ernst Stadlers Darstellung von der Tradition?
Stadler nutzt zwar expressionistische Elemente, entwickelt aber sehr eigene, stadlerspezifische Darstellungsweisen, die nicht immer den gängigen Konventionen folgen.
Welche Gedichte Stadlers werden in der Arbeit analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Werke „Lover's Seat“, „Reinigung“ und „Winteranfang“.
Welche Themen sind typisch für Stadlers Lyrik?
Typische Themen sind Entgrenzung, Aufbruch, Naturbilder und die Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit und Metaphysik.
Gilt Ernst Stadler als typischer Expressionist?
Er wird als Vertreter des Expressionismus gesehen, seine Stilistik weist jedoch individuelle Züge auf, die ihn von anderen Zeitgenossen abheben.
- Arbeit zitieren
- Senta Herrmann (Autor:in), 2015, Das Visionsmotiv in der Lyrik des deutschen Expressionismus am Beispiel ausgewählter Gedichte von Ernst Stadler, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380866