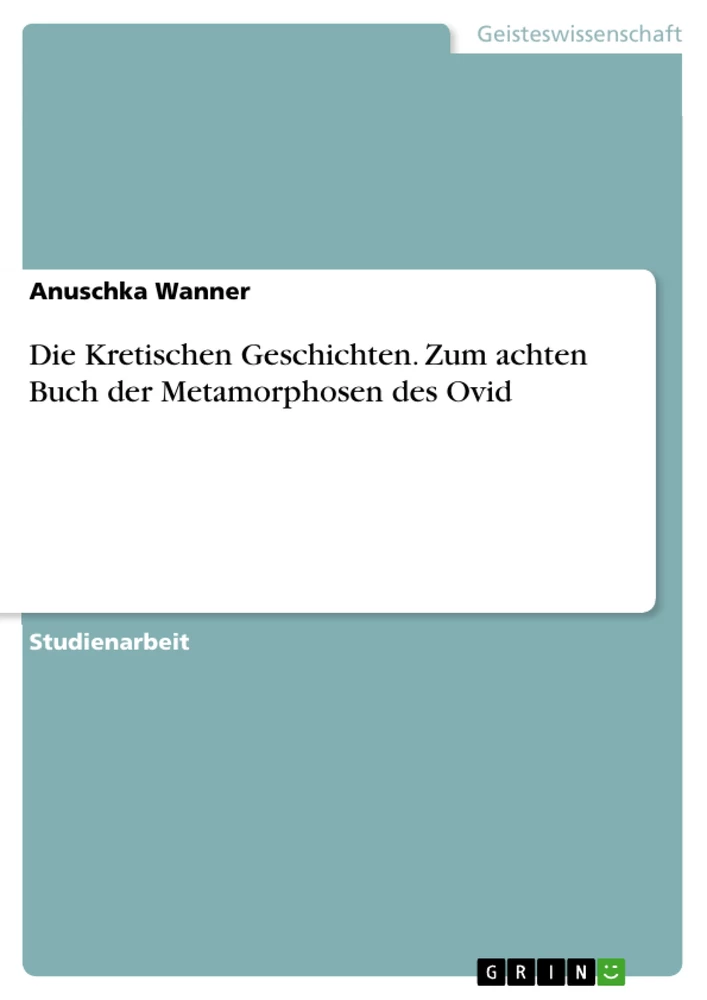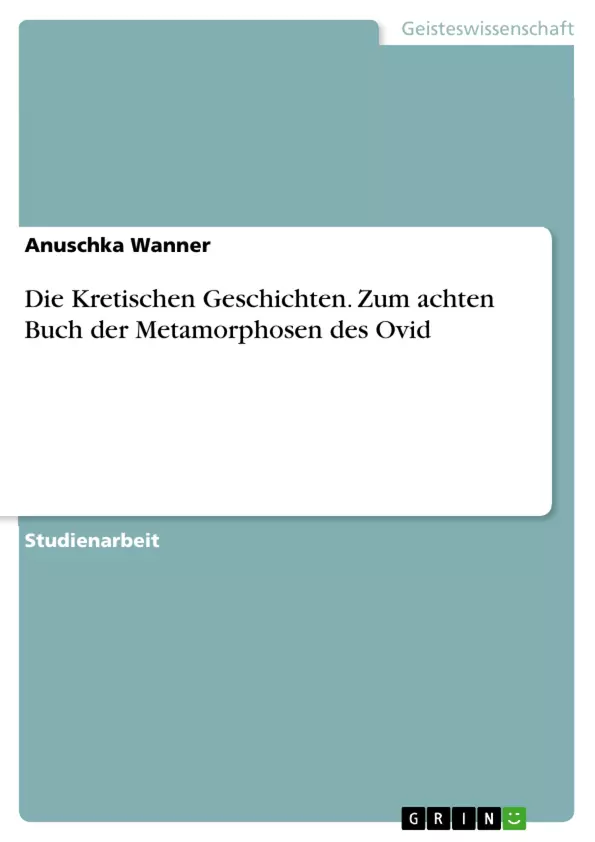Medea, Dido, Scylla und Ariadne: Es sind Namen von Frauen, deren Geschichten in der antiken Mythologie eindrucksvoll geschildert werden. Ihre Darstellung gilt als Kunstwerk und ergreift jedes Mal von neuem die Gefühlswelt der Leser. Die Rezeption der Mythen geht über die literarische Gestaltung hinaus und lässt Künstler aller Art sich dafür begeistern. Es sind Tragödien, Schicksale einzelner Frauen, deren Persönlichkeit von außerordentlicher Bedeutung ist. Medea verrät ihre eigene Familie, um Iason zum Goldenen Vlies zu verhelfen. Dido nimmt Aeneas und seine Gefährten auf und verliebt sich trotz eines Eides in ihn. Scylla stürzt nicht nur ihren Vater, sondern die ganze Stadt ins Unglück, weil sie sich in König Minos verliebt. Und schließlich verliert Ariadne ihr Herz an Theseus, der sie auf der Insel Naxos grausam zurücklässt.
Ovid behandelt in seinem achten Buch der Metamorphosen die Kretischen Geschichten, die um den athenischen Helden Theseus und die Jungfrau Ariadne schweifen. Jedoch stellen sie kein zentrales Thema im Werk dar. Sie werden vielmehr in gedrängter Form dargestellt und dienen als Übergangspassage zu den weiteren Erzählungen um Daedalus. Dennoch verarbeitet Ovid die wichtigsten Elemente des Mythos und weist den Leser geschickt darauf hin. Er schafft es trotz poetischer Verkürzung die Begeisterung im Leser zu wecken und den Sinn jedes einzelnen Wortes verstehen zu wollen.
Die vorliegende Arbeit soll die Themen, die Ovid nur berührt und in Anspielungen erzählt, fassbar machen und in einen Gesamtzusammenhang bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schmach der Pasiphae
- Der Held Theseus
- Theseus und Ariadne
- Ariadne auf der Insel Naxos
- Der кαταστερμóç der Krone
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Themen, die Ovid nur berührt und in Anspielungen erzählt, fassbar zu machen und in einen Gesamtzusammenhang zu bringen.
- Die Geschichte des Minotaurus und seine Entstehung durch die Schmach der Pasiphae
- Die Rolle des Helden Theseus im Mythos und seine Beziehung zu Ariadne
- Die Darstellung der Frauengestalten in den Kretischen Geschichten, insbesondere Ariadnes Schicksal
- Die Kunstfertigkeit des Daedalus und seine Bedeutung im Zusammenhang mit dem Labyrinth
- Ovids Verwendung von Metaphern und Bildern, um die Komplexität des Mythos zu verdeutlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor, indem sie auf die Bedeutung der Frauengestalten Medea, Dido, Scylla und Ariadne in der antiken Mythologie eingeht. Sie hebt die Rezeption der Mythen in Literatur und Kunst hervor und stellt Ovids Behandlung der Kretischen Geschichten in seinen Metamorphosen vor. Die Arbeit soll die Themen, die Ovid nur berührt, tiefergehend erforschen.
Die Schmach der Pasiphae
Dieses Kapitel analysiert die Entstehung des Minotaurus, der durch den Ehebruch zwischen Pasiphae und dem Stier geboren wurde. Ovids sprachliche Gestaltung des Themas wird untersucht, insbesondere die Verwendung von Begriffen wie „Schande“, „Schmach“ und „Ehebruch“. Das Kapitel verdeutlicht, wie Ovid die Geschichte von Scylla als Brücke zu der Geschichte des Minotaurus nutzt.
Der Held Theseus
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle des Helden Theseus im Mythos. Ovids Beschreibung des Minotaurus und des Labyrinths wird analysiert, wobei die Kunstfertigkeit des Daedalus hervorgehoben wird. Das Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Geschichte von Theseus und der Geschichte von Ariadne, ohne jedoch deren Begegnung im Detail zu beschreiben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Mythologie, Literatur, Ovid, Metamorphosen, Kretische Geschichten, Minotaurus, Theseus, Ariadne, Pasiphae, Daedalus, Labyrinth, Stier, Schmach, Ehebruch, Kunstfertigkeit, Metaphern.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die „Kretischen Geschichten“ im achten Buch der Metamorphosen?
Es handelt sich um Sagenkreise um Minos, den Minotaurus, Daedalus, Theseus und Ariadne, die Ovid in gedrängter, poetischer Form darstellt.
Welche Rolle spielt Ariadne in Ovids Erzählung?
Ariadne wird als tragische Figur dargestellt, die Theseus hilft, aber schließlich auf Naxos verlassen wird, bevor ihre Krone als Sternbild am Himmel verewigt wird.
Wie wird die Entstehung des Minotaurus beschrieben?
Ovid thematisiert die „Schmach der Pasiphae“, die durch den Ehebruch mit einem Stier das Mischwesen Minotaurus zur Welt brachte, das Minos im Labyrinth verbarg.
Welche Bedeutung hat Daedalus in diesem Werk?
Daedalus verkörpert die Kunstfertigkeit und den menschlichen Erfindungsgeist, indem er das Labyrinth entwirft, um die Schande des Minos zu verbergen.
Warum verwendet Ovid Metaphern und poetische Verkürzungen?
Ovid nutzt diese Stilmittel, um komplexe Mythen in einen Gesamtzusammenhang zu bringen und die Emotionen der Leser trotz knapper Darstellung zu wecken.
- Arbeit zitieren
- Anuschka Wanner (Autor:in), 2014, Die Kretischen Geschichten. Zum achten Buch der Metamorphosen des Ovid, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/382000