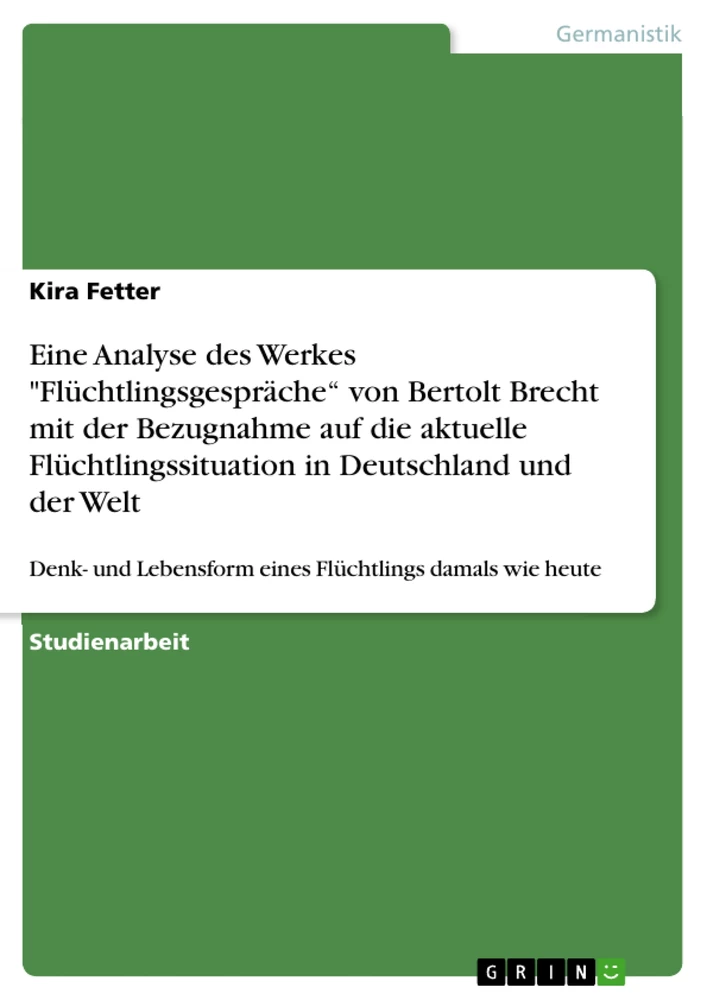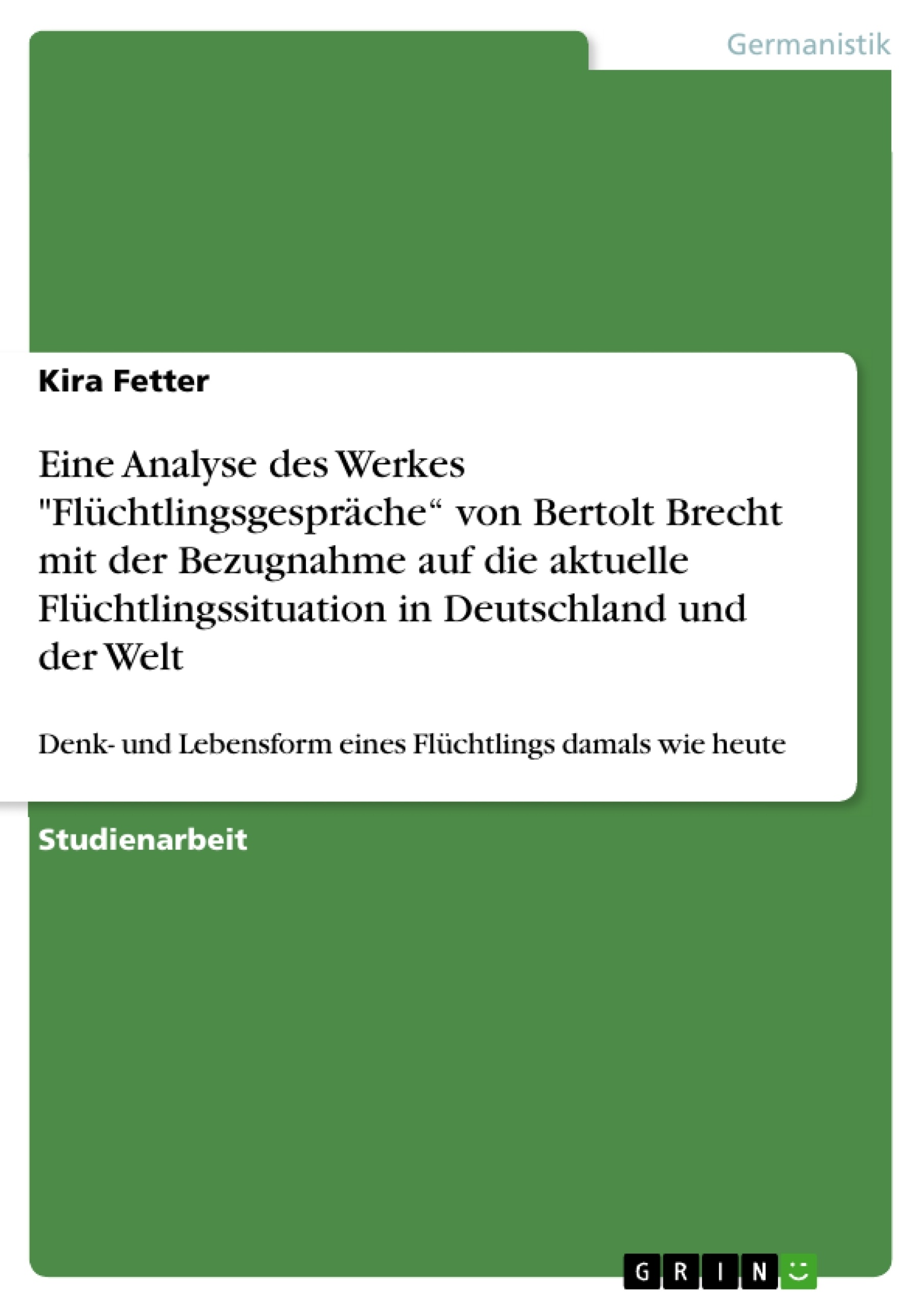Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie sich vertriebene Menschen fühlen, welche Stimmung und Gedanken sie begleiten und über welche Themen sie diskutieren. Und welches Buch würde sich für diese Thematik besser eignen als Bertolt Brechts Prosastück "Flüchtlingsgespräche". Da hier zwei völlig gegensätzliche Charaktere über Themen politischer, philosophischer und religiöser Art diskutieren, kann man sehr eindrucksvoll erkennen, welche Punkte die Vertriebenen beschäftigt, wo die Meinungen differieren und wo sie sich einig sind.
Die Sicht- und Ausdrucksweise, die Bertold Brecht (1898-1956) seinen beiden Figuren im Roman "Flüchtlingsgespräche" zuteilt, grenzt den Schriftsteller deutlich von den meisten anderen Exilautoren ab. Kaum einer seiner Kollegen sah sich im Stande, positiv wirkende Formulierungen zu den damals vorherrschenden Umständen im zweiten Weltkrieg niederzuschreiben. Brecht schafft es, dass sein Roman Flüchtlingsgespräche beinahe wie eine angenehme Lektüre auf den Leser wirkt. Dieser Eindruck bildet das Pendant zu der unsicheren und auch lebensbedrohlichen Situation, in der sich Brecht während der Entstehung des Romans befand und in der sich auch seine beiden Figuren in den Flüchtlingsgesprächen befinden.
Doch Brechts Flüchtlingsgespräche sind nicht nur wegen des Erzählstils außergewöhnlich; besonders wegen seines autobiographischen Charakters ist der Prosatext einzigartig. Brecht flechtet nicht nur Selbstzitate und Selbstverwertungen in seinen Roman hinein, auch der Ort des Geschehens und die Lokalität – ein Bahnhofsrestaurant in Helsinki- in der die Gespräche stattfinden, sind Orte, in denen Brecht sich selbst während des Exils aufhielt. Brecht selbst war ein Flüchtling und Vertriebener zur Zeit des Nationalsozialismus. Des Weiteren hatte er während seiner Flucht durch diverse Länder die Möglichkeit, das Verhalten von Flüchtlingen kennenzulernen und zu studieren.
Auch heute ist die Zahl der Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, höher denn je. Im Jahre 2016 verzeichnete man weltweit 65,3 Millionen Menschen, die auf der Flucht waren. Davon kamen 745.545 Personen nach Deutschland. Diese Zahl ist die Höchste, die seit dem Bestehen des Bundesamtes für Flüchtlinge verzeichnet wurde1 und die Höchste seit dem zweiten Weltkrieg.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Aktuelle Thematik
- Entstehung
- Definitionen: Migrant und Flüchtling
- Ursprung: Transitgedanke
- Flüchtlinge: 2 Charaktere
- Der Intellektuelle und der Arbeiter
- Analyse von Schwerpunktdialogen
- Erste Eindrücke / Ausgangssituation
- Der Pass und die Ordnung
- Sattessen und Ziffels Memoirenvorhaben
- Ziffels Memoiren
- Stationen des Exils und deren Tugenden
- Eine ungenaue Bewegung
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, Bertolt Brechts "Flüchtlingsgespräche" zu analysieren und den Denk- und Lebensformen eines Flüchtlings im Kontext der aktuellen Flüchtlingssituation zu beleuchten. Die Analyse verbindet Brechts Werk mit der heutigen Realität und untersucht, wie seine Ideen und Beobachtungen auf die heutige Situation übertragen werden können.
- Die Darstellung der Flüchtlingserfahrung und deren Auswirkungen auf die Denkweise
- Der Vergleich zwischen Brechts Exilsituation und der aktuellen Flüchtlingskrise
- Die Analyse von Dialogen und deren Bedeutung für die Charakterentwicklung
- Die Erörterung der politischen, philosophischen und religiösen Themen, die in den "Flüchtlingsgesprächen" behandelt werden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der "Flüchtlingsgespräche" ein und stellt Bertolt Brecht als Flüchtling und Exilautor vor. Anschließend wird die Aktualität des Themas im Kontext der heutigen Flüchtlingskrise beleuchtet. Kapitel 3 geht auf die Entstehung des Werkes ein und beschreibt Brechts ursprüngliche Intentionen und Inspirationen.
Kapitel 4 beleuchtet die Definitionen von "Migrant" und "Flüchtling" und verdeutlicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Kapitel 5 analysiert die Bedeutung des "Transitgedankens" in Brechts Werk, während Kapitel 6 die beiden Hauptfiguren in den "Flüchtlingsgesprächen" und ihre unterschiedlichen Perspektiven vorstellt. Kapitel 7 analysiert ausgewählte Dialoge und deren Bedeutung für die Charakterentwicklung und die behandelten Themen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von "Flüchtlingsgespräche" von Bertolt Brecht, untersucht die Denk- und Lebensform eines Flüchtlings, vergleicht Brechts Exilsituation mit der heutigen Flüchtlingskrise und analysiert die politischen, philosophischen und religiösen Themen des Werkes. Zu den Schlüsselbegriffen zählen: Flüchtling, Exil, Migration, Identität, Politik, Philosophie, Religion, Dialog, Charakterentwicklung, Transitgedanke.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Brechts „Flüchtlingsgesprächen“?
In dem Werk diskutieren zwei sehr unterschiedliche Charaktere – ein Intellektueller und ein Arbeiter – in einem Bahnhofsrestaurant im Exil über Politik, Philosophie und das Leben als Flüchtling.
Welchen autobiographischen Bezug hat das Werk?
Brecht schrieb das Werk während seines eigenen Exils in Finnland und verarbeitete darin persönliche Erfahrungen, Beobachtungen und sogar reale Orte wie den Bahnhof von Helsinki.
Wie lässt sich Brechts Werk auf die heutige Flüchtlingssituation übertragen?
Die Arbeit zieht Parallelen zwischen den Erfahrungen von 1940 und der heutigen globalen Flüchtlingskrise, insbesondere in Bezug auf Identitätsverlust und bürokratische Hürden (wie den „Pass“).
Was symbolisiert der „Pass“ in den Flüchtlingsgesprächen?
Der Pass steht für die Entmenschlichung und die totale Abhängigkeit des Individuums von staatlicher Ordnung und Bürokratie im Exil.
Welche Rolle spielt der Gegensatz zwischen Arbeiter und Intellektuellem?
Der Dialog zwischen den Figuren Ziffel und Kalle ermöglicht es Brecht, verschiedene soziale Perspektiven auf den Faschismus und die Fluchtursachen darzustellen.
- Citar trabajo
- Kira Fetter (Autor), 2017, Eine Analyse des Werkes "Flüchtlingsgespräche“ von Bertolt Brecht mit der Bezugnahme auf die aktuelle Flüchtlingssituation in Deutschland und der Welt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383034