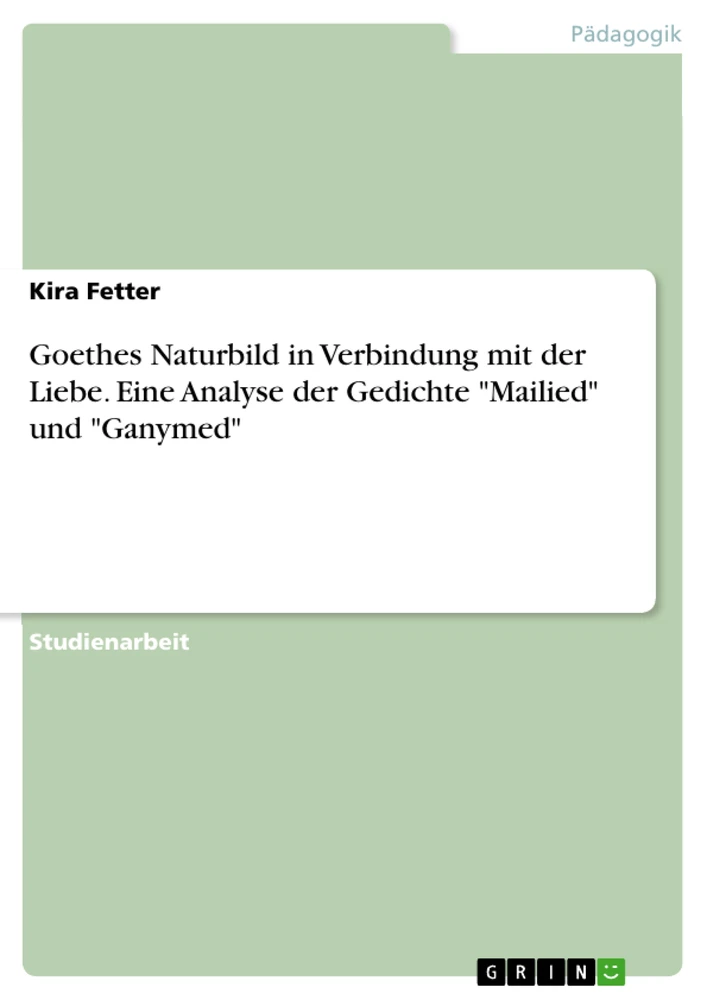Den Gegenstand dieser Arbeit bilden die motivähnlichen Gedichte „Mailied“ (1771) und „Ganymed“ (1774), welche von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) in seinen jungen Jahren verfasst worden sind. Das Hauptaugenmerk soll hierbei auf die Darstellung der Natur und der Liebe gelegt werden.
Im "Mailied" festigt sich die Zusammenkunft von Gott, Liebe und Natur und kreiert eine unzerstörbare Einheit. Zudem steht die Natur im Einklang mit dem lyrischen Subjekt und scheint sich gerade durch dieses erst verwirklichen zu können. Somit beherrscht nach Goethe das Gesetz tiefster und unaufhebbarer Wechselwirkung und fruchtbarster Gegenseitigkeit das Verhältnis von Mensch und Natur. Auch in der Ganymed-Ode erfährt das lyrische Ich seine höchste Steigerung in der bedingungslosen Hingabe an das natürliche Allleben und geht letztlich in das göttliche Ganze des Pantheismus über.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Maifest
- Entstehungsrahmen
- Metrik und Inhalt
- Interpretation und Analyse „Maifest“
- Ganymed
- Entstehungsrahmen
- Metrik und Inhalt
- Analyse und Interpretation „Ganymed“
- Ganymed- Bezug zur griechischen Mythologie
- Maifest
- Maifest und Ganymed im Vergleich
- Goethe und der Pantheismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung der Natur und der Liebe in Goethes Gedichten „Mailied“ und „Ganymed“. Sie untersucht, wie Goethe die Natur in seinen Gedichten beschreibt und wie sich seine Sichtweise auf Natur und Liebe in seinen frühen Werken widerspiegelt. Dabei wird insbesondere auf die Verbindung von Natur, Liebe und dem göttlichen Prinzip im Pantheismus eingegangen.
- Die Verbindung von Natur und Liebe in Goethes Gedichten
- Die Rolle des lyrischen Ichs in den Gedichten
- Die Darstellung der Natur als Symbol für das Göttliche
- Die Bedeutung des Pantheismus in Goethes Werk
- Die Interpretation von „Mailied“ und „Ganymed“ im Kontext von Goethes Leben und Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Goethes Lyrik und seine Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft vor. Sie führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Gedichte „Mailied“ und „Ganymed“ als zentrale Beispiele für Goethes Verbindung von Natur und Liebe.
Der Hauptteil der Arbeit widmet sich zunächst dem Gedicht „Maifest“. Er untersucht den Entstehungsrahmen, die Metrik und den Inhalt des Gedichts, sowie die Interpretation und Analyse des Gedichtes.
Im zweiten Teil des Hauptteils wird das Gedicht „Ganymed“ behandelt. Auch hier werden der Entstehungsrahmen, die Metrik und der Inhalt des Gedichts, sowie die Analyse und Interpretation des Gedichtes im Detail erläutert.
Der Abschnitt „Maifest und Ganymed im Vergleich“ beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Gedichte in Bezug auf die Darstellung von Natur und Liebe.
Schlüsselwörter
Goethes Lyrik, Natur, Liebe, Pantheismus, Mailied, Ganymed, Lyrisches Ich, Naturbildlichkeit, Gefühlssprache, Interpretation, Analyse.
- Quote paper
- Kira Fetter (Author), 2016, Goethes Naturbild in Verbindung mit der Liebe. Eine Analyse der Gedichte "Mailied" und "Ganymed", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383035