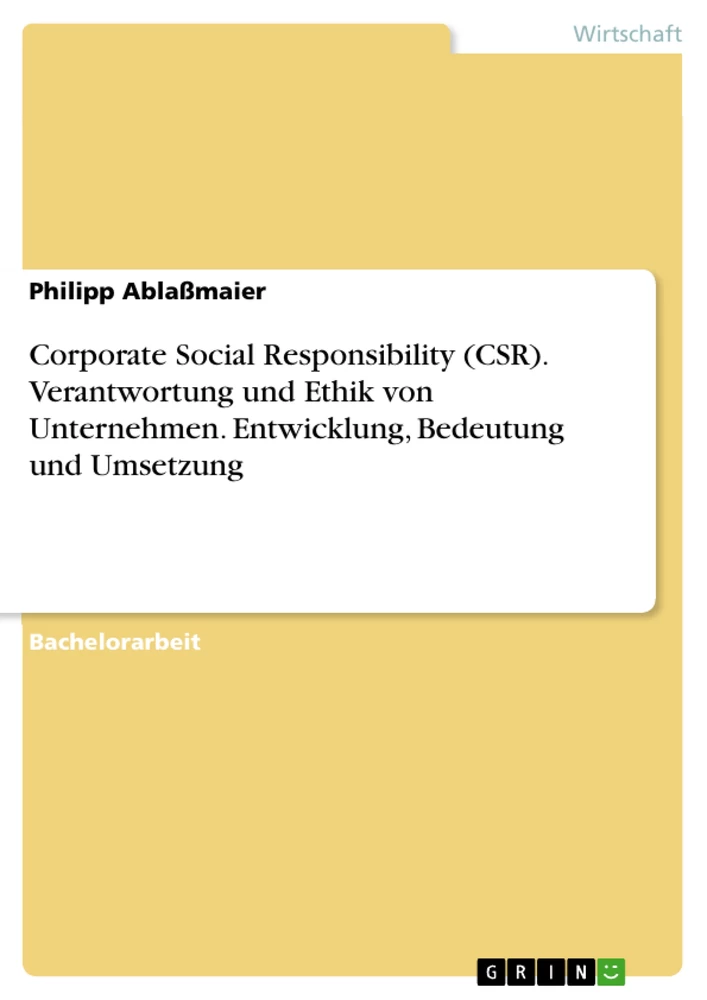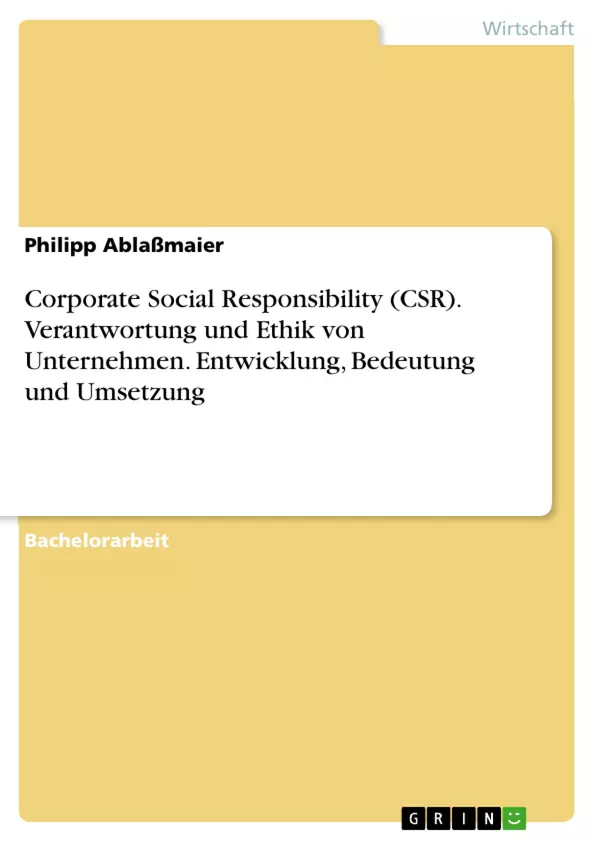In der nachfolgenden Arbeit sollen im ersten Teil die theoretischen Hintergründe von CSR erläutert werden und welchen Umfang diese wichtige Thematik eigentlich hat. Des Weiteren werden Bestandteil die Entwicklung, die Bedeutung und Umsetzung von CSR sein. Letzteres soll an drei Unternehmensbeispielen verdeutlicht werden. Ziel meiner Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis durch Aufarbeitung von theoretischen Hintergründen zu vermitteln. Ferner ist es unumgänglich zu erwähnen wie das CSR-Konzept in der Praxis überhaupt angewendet wird. Dabei sollen folgende Fragen geklärt werden:
- Was versteht man unter CSR?
- Was ist die Motivation?
- Welche Dimensionen existieren innerhalb des Konzepts?
- Welche Stakeholder sind betroffen?
- Wie wurde das Konzept entwickelt?
- Was sind der Nutzen und die Folgen?
- Gibt es internationale Unterschiede?
- Welche praktischen Beispiele gibt es?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Aufbau und Ziel der Arbeit
- 2. CSR – Ein Überblick
- 2.1 Definition Corporate Social Responsibility
- 2.2 Verwandte Konzepte des CSR
- 2.2.1 Corporate Citizenship
- 2.2.2 Corporate Governance
- 2.3 Das Drei-Säulenmodell – Tripple Bottom Line
- 2.3.1 Motivation und Zielsetzung von CSR
- 2.3.2 Ökonomische Dimension (economic prosperity)
- 2.3.3 Ökologische Dimension (environmental protection)
- 2.3.4 Soziale Dimension (social equity)
- 2.3.5 Interne und externe Dimension
- 2.4 Der CSR-Check
- 2.5 CSR und Stakeholder
- 2.5.1 Interne Stakeholder
- 2.5.2 Externe Stakeholder
- 2.6 CSR Instrumente
- 2.7 Verantwortung und Ethik von Unternehmen
- 3. Entwicklung, Bedeutung und Umsetzung von CSR
- 3.1 Entwicklung von CSR
- 3.1.1 Der ehrbare Kaufmann
- 3.1.1.1 Antike
- 3.1.1.2 Mittelalter
- 3.1.1.3 Frühe Neuzeit
- 3.1.1.4 Moderne
- 3.1.2 Meilensteine der Entwicklung von CSR
- 3.2 Bedeutung von CSR
- 3.2.1 Nutzen und Chancen von CSR
- 3.2.2 CSR als „Business Case“
- 3.2.3 CSR als Teil der Unternehmensstrategie
- 3.2.4 CSR global
- 3.2.4.1 UN Global Compact
- 3.2.4.2 OECD-Leitlinien
- 3.2.4.3 Global Reporting Initiative (GRI)
- 3.2.5 CSR in Europa
- 3.3 Umsetzung von CSR anhand von Beispielen
- 3.3.1 Beispiel „BMW Group“
- 3.3.2 Beispiel „H&M Group“
- 3.3.3 Beispiel „McDonalds“
- Definition und Abgrenzung von CSR
- Entwicklung und Meilensteine von CSR
- Bedeutung und Nutzen von CSR für Unternehmen
- Umsetzung von CSR in der Praxis anhand von Beispielen
- Internationale und europäische CSR-Initiativen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Corporate Social Responsibility (CSR) und analysiert dessen Entwicklung, Bedeutung und Umsetzung. Dabei wird ein umfassendes Verständnis des CSR-Konzepts vermittelt, seine Motivation und die verschiedenen Dimensionen beleuchtet. Darüber hinaus werden wichtige Stakeholder des CSR-Konzepts vorgestellt sowie die Entwicklung von CSR in historischen Kontexten erörtert.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema CSR ein und erläutert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Anschließend wird im zweiten Kapitel das Konzept von CSR definiert und seine verwandten Konzepte, wie Corporate Citizenship und Corporate Governance, dargestellt. Das Drei-Säulenmodell (Triple Bottom Line) wird vorgestellt, das die ökonomische, ökologische und soziale Dimension von CSR beleuchtet. Weitere Schwerpunkte dieses Kapitels sind die Motivation von CSR, der CSR-Check, Stakeholder und CSR-Instrumente sowie die Bedeutung von Verantwortung und Ethik in Unternehmen.
Kapitel 3 widmet sich der Entwicklung, Bedeutung und Umsetzung von CSR. Es beleuchtet die historische Entwicklung des ehrbaren Kaufmanns und wichtige Meilensteine der CSR-Entwicklung. Der Nutzen und die Chancen von CSR für Unternehmen werden analysiert und die Relevanz von CSR als "Business Case" und Teil der Unternehmensstrategie wird hervorgehoben. Des Weiteren wird der globale Kontext von CSR betrachtet und internationale Initiativen wie der UN Global Compact, die OECD-Leitlinien und die Global Reporting Initiative (GRI) werden vorgestellt. Schließlich wird CSR im europäischen Kontext beleuchtet und an ausgewählten Beispielen wie der BMW Group, der H&M Group und McDonalds die Umsetzung von CSR in der Praxis dargestellt.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility (CSR), Nachhaltigkeit, Triple Bottom Line, Stakeholder, Unternehmensverantwortung, Ethik, Entwicklung, Bedeutung, Umsetzung, Beispiele, Internationales, Europäisches, UN Global Compact, OECD-Leitlinien, Global Reporting Initiative (GRI).
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR bezeichnet die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht.
Was ist das Drei-Säulenmodell der Nachhaltigkeit?
Es umfasst die drei Dimensionen ökonomische Prosperität, ökologischer Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit (Triple Bottom Line).
Wer sind die Stakeholder bei CSR?
Man unterscheidet interne Stakeholder (Mitarbeiter, Manager) und externe Stakeholder (Kunden, Lieferanten, Staat, Gesellschaft).
Welche historischen Wurzeln hat CSR?
Das Konzept lässt sich bis zum Leitbild des "ehrbaren Kaufmanns" in der Antike und dem Mittelalter zurückverfolgen.
Welche praktischen Beispiele für CSR werden genannt?
Die Arbeit analysiert die Umsetzung von CSR-Strategien bei der BMW Group, der H&M Group und McDonalds.
Was sind die OECD-Leitlinien für CSR?
Es handelt sich um internationale Empfehlungen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln im globalen Kontext.
- Quote paper
- Philipp Ablaßmaier (Author), 2017, Corporate Social Responsibility (CSR). Verantwortung und Ethik von Unternehmen. Entwicklung, Bedeutung und Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383120