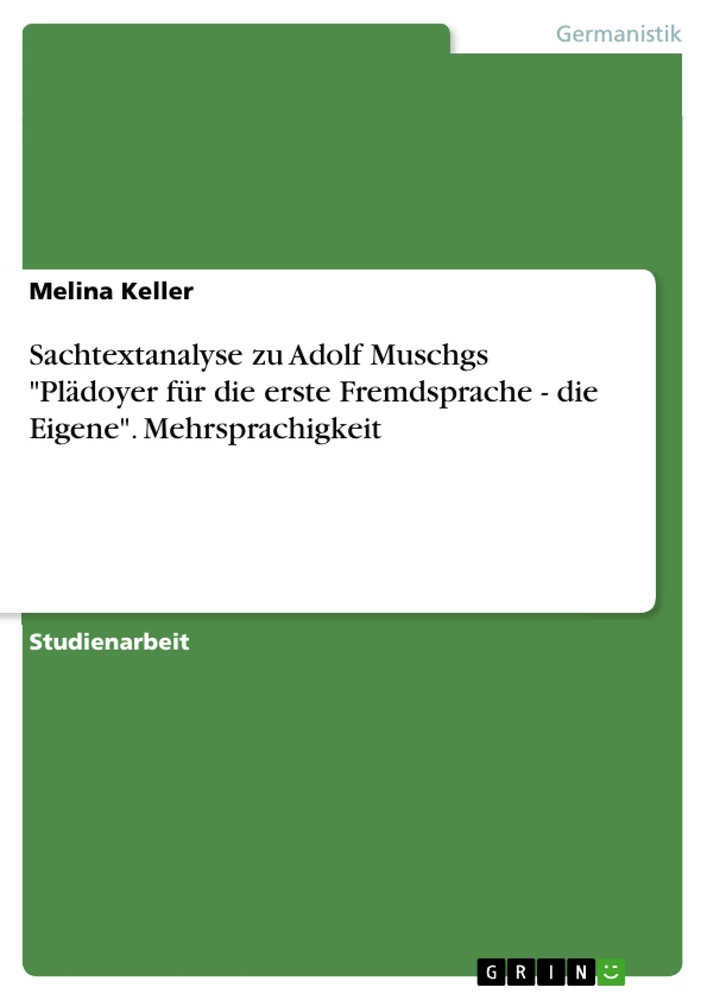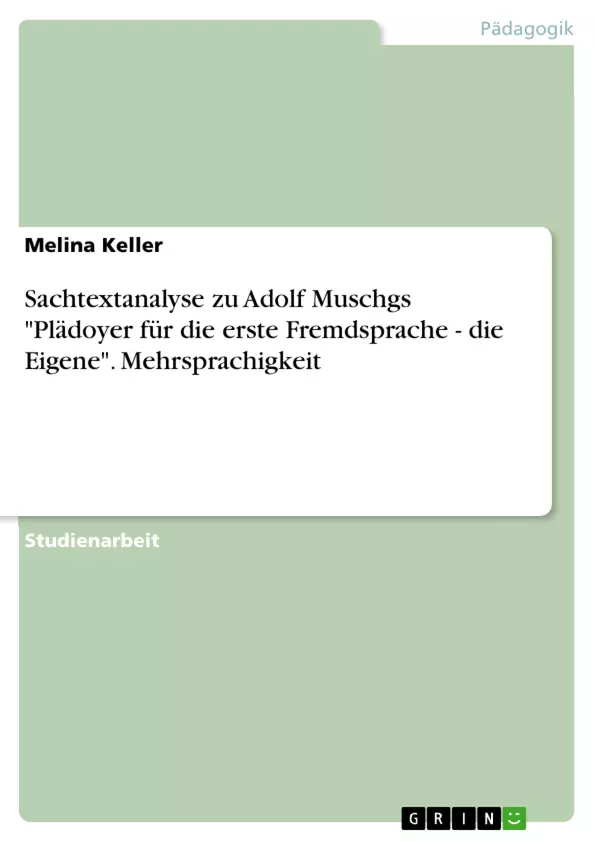Der Artikel „Plädoyer für die erste Fremdsprache – die eigene“, geschrieben von Adolf Muschg thematisiert die Vorteile von Fremdsprachenunterricht, sowie Folgen für die Muttersprache und die Bedeutung von Sprache in Europa allgemein.
Adolf Muschg vertritt die Meinung, dass das Erlernen einer Fremdsprache zwar Vorteile bietet, aber das dadurch die Muttersprache zu stiefmütterlich behandelt wird. Außerdem lehnt er den Fremdsprachenunterricht aus rein wirtschaftlichen Zwecken ab und fordert eine nähere Auseinandersetzung mit Sprache und ihrer Funktion als Kulturträger.
Inhaltlich lässt sich der Artikel in vier Sinnabschnitte gliedern. Der erste Abschnitt (Z. 1-12) thematisiert Muschgs ersten Kontakt mit Sprache in seiner Kindheit, als er erkennt, dass Sprache auch eine trennende und ausgrenzende Funktion hat und dass damit auch die Frage nach Identität verbunden ist.
Der zweite Abschnitt (Z. 13-64) handelt von dem momentanen Verständnis von Sprache ein Europa und dem damit zusammenhängenden Ziel von Fremdsprachenunterricht. Muschg sagt, dass Sprache auch mit Geschichte und Identität verbunden ist. In Europa verliert Sprache als Kulturträger allerdings immer mehr an Wert. Viel wichtiger ist der Wettbewerbsvorteil, den eine Sprache den Menschen in der Wirtschaft verschafft. Darauf wird Sprache reduziert, sodass die Kultur hinter einer Sprache in den Hintergrund rückt, wie beispielsweise beim Englisch. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Sachtextanalyse
- Einleitung
- Der erste Abschnitt (Z. 1-12)
- Der zweite Abschnitt (Z. 13-64)
- Der dritte Abschnitt (Z. 65-92)
- Der vierte Abschnitt (Z.93-145)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Artikel „Plädoyer für die erste Fremdsprache – die eigene“, verfasst von Adolf Muschg, befasst sich mit den Vorteilen des Fremdsprachenunterrichts, sowie den Folgen für die Muttersprache und der Bedeutung von Sprache im europäischen Kontext. Muschg argumentiert, dass das Erlernen einer Fremdsprache, während es Vorteile bietet, die Muttersprache vernachlässigen kann. Er lehnt Fremdsprachenunterricht aus rein wirtschaftlichen Gründen ab und plädiert für eine tiefere Auseinandersetzung mit Sprache und ihrer Funktion als Kulturträger.
- Die Bedeutung von Sprache als Kulturträger
- Die Folgen von einseitigem Fremdsprachenunterricht für die Muttersprache
- Die Bedeutung der eigenen Sprache als Basis für den Fremdsprachenunterricht
- Die Rolle der Sprache als Vermittler von Kultur und Identität
- Die Bedeutung der eigenen Sprache für ein vereintes Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Abschnitt des Artikels behandelt Muschgs eigene Erfahrungen mit Sprache in der Kindheit, die ihm die trennende und ausgrenzende Funktion von Sprache verdeutlichten. Der zweite Abschnitt beleuchtet das Verständnis von Sprache in Europa, das zunehmend durch wirtschaftliche Interessen geprägt ist und die Kultur hinter der Sprache in den Hintergrund drängt. Der dritte Abschnitt befasst sich mit der Notwendigkeit eines Fremdsprachenunterrichts, der nicht nur praktische Ziele verfolgt, sondern auch die kulturellen Aspekte der Sprache berücksichtigt. Der vierte Abschnitt argumentiert für einen achtsamen Umgang mit der eigenen Sprache, um das Verständnis für andere Kulturen und eine politische Einheit in Europa zu fördern.
Schlüsselwörter
Der Artikel fokussiert auf die Themen Fremdsprachenunterricht, Muttersprache, Kultur, Identität, Europa, Globalisierung, Bildung, Sprachentwicklung und Sprachverarmung. Muschg untersucht dabei die Funktionsweise und den Einfluss von Sprache, sowie deren Bedeutung für Kultur und Identität. Der Artikel beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Muttersprache und Fremdsprache im Kontext des europäischen Zusammenwachses.
Häufig gestellte Fragen
Was thematisiert Adolf Muschgs Artikel „Plädoyer für die erste Fremdsprache – die eigene“?
Der Artikel behandelt die Bedeutung der Muttersprache als Basis für das Erlernen von Fremdsprachen und kritisiert die Reduzierung von Sprache auf wirtschaftliche Zwecke.
Warum lehnt Muschg Fremdsprachenunterricht aus rein wirtschaftlichen Gründen ab?
Er argumentiert, dass Sprache dadurch ihren Wert als Kulturträger verliert und auf einen bloßen Wettbewerbsvorteil reduziert wird, während die kulturelle Tiefe verloren geht.
Welche Gefahr sieht Muschg für die Muttersprache?
Er befürchtet, dass durch die Überbetonung von Fremdsprachen die eigene Sprache "stiefmütterlich" behandelt wird und somit das Fundament für Identität und Geschichte bröckelt.
Welche Rolle spielt Sprache für die Identität?
Muschg zeigt auf, dass Sprache sowohl eine verbindende als auch eine trennende Funktion hat und untrennbar mit der persönlichen und nationalen Identität verknüpft ist.
Was fordert Muschg für ein vereintes Europa?
Er plädiert für einen achtsamen Umgang mit der eigenen Sprache, da nur ein tiefes Verständnis der eigenen Kultur die Basis für echtes Verständnis anderer Kulturen in Europa sein kann.
Wie ist der Artikel inhaltlich gegliedert?
Der Text gliedert sich in vier Abschnitte: Kindheitserfahrungen, das aktuelle Sprachverständnis in Europa, kulturelle Aspekte des Sprachenlernens und die Bedeutung für die politische Einheit.
- Quote paper
- Melina Keller (Author), 2017, Sachtextanalyse zu Adolf Muschgs "Plädoyer für die erste Fremdsprache - die Eigene". Mehrsprachigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383140