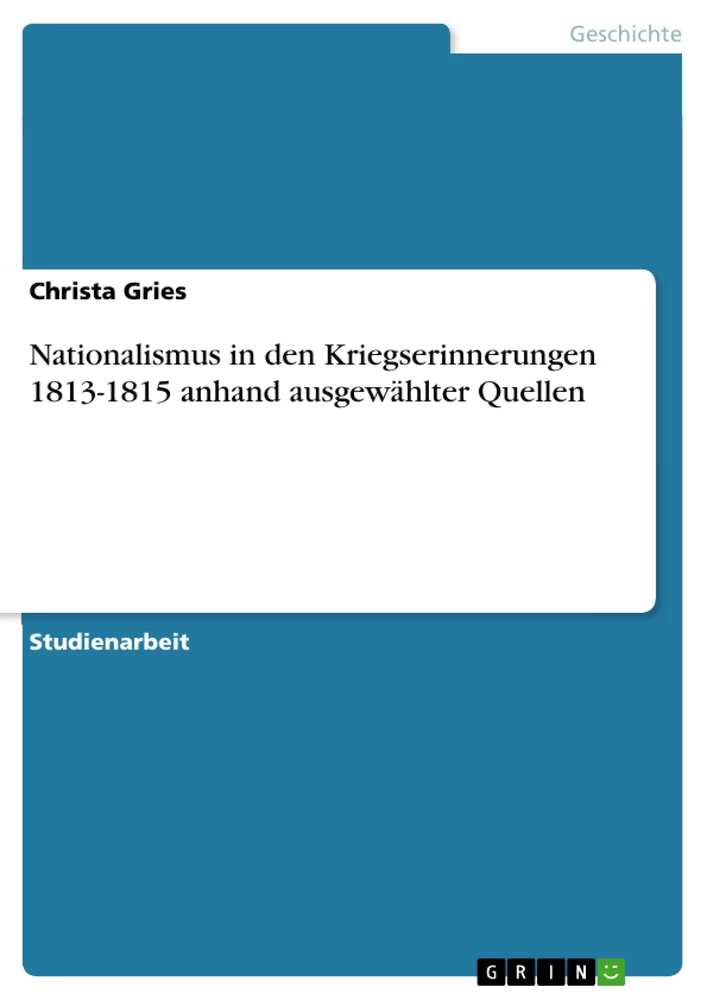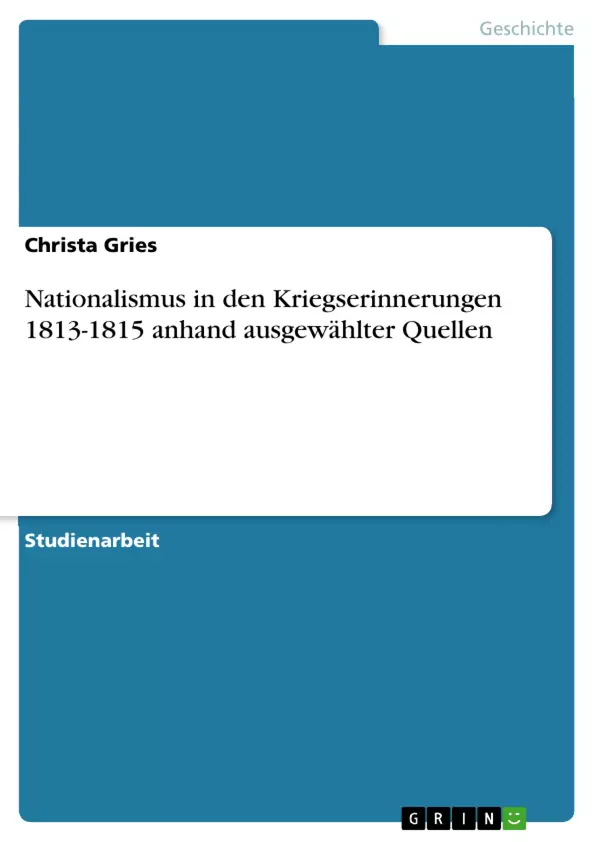Lässt sich der deutsche Nationalismus in den Kriegserinnerungen der Zeitzeugen belegen? Oder bestätigt der Quellenkorpus die Kritik der neueren Forschung? Nationalismus soll hier an Hand von Szenen in den Texten belegt werden, die Rückschlüsse auf die positive Einstellung des Autors zu Deutschland als Vaterland und auf den Wunsch nach einer geeinten deutschen Nation zulassen. Ein möglichst breites Spektrum an Autoren soll dabei zu Wort kommen, einfache Soldaten, Offiziere, Zivilisten, Literaten aus den verschiedenen deutschen Regionen.
Basis für die Arbeit war Karen Hagenmanns Studie von 2015, in der sie 269 Kriegserinnerungen deutscher Zeitzeugen nach Vita, Region, Motivation des Autors und Zeitpunkt der Publikation systematisiert hat. Männer von höherem militärischen Rang oder Mitglieder der zivilen Oberschicht (Adel, Bildungsbürger) verfassten die Mehrheit der Texte. Sie stammten vor allem aus den Rheinbundstaaten und Preußen.
Angelehnt an Hagemanns Gruppierungen sind die Quellen in der Arbeit so gewählt, dass jede Gruppe mit mindestens einem Autor repräsentiert ist: zwei gemeine Soldaten (Deifel, Lindau), zwei rheinbündische Offiziere auf französischer Seite (von Funck, von Ditfurth), ein sächsischer Berufsoffizier gegen Napoleon (von François), zwei preußische Offiziere (von Müffling, von Wolzogen), ein sächsischer Musikkritiker (von Rochlitz) und ein preußischer Literat (von Kügelgen). Nicht berücksichtigt sind Autorinnen, da sie eher Ausnahmen darstellten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der autobiographische Boom im 19. Jahrhundert
- 2. Auf der Suche nach Nationalismus in den Quellen
- 2.1 Phase 1: Restauration und Vormärz (1815-1840)
- 2.2 Phase 2: Die nationalliberale Bewegung und die Revolution von 1847/48
- 2.3 Phase 3: Im Kaiserreich (1871-1914)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des deutschen Nationalismus in Kriegserinnerungen der Zeitzeugen der Befreiungskriege (1813-1815). Ziel ist es, anhand ausgewählter Quellen die gängige Interpretation der Befreiungskriege als Wiege des deutschen Nationalismus zu überprüfen und die Kritik der neueren Forschung zu beleuchten. Dabei wird ein breites Spektrum an Autoren berücksichtigt, um verschiedene Perspektiven zu erfassen.
- Der autobiographische Boom des 19. Jahrhunderts und seine Auswirkungen auf die Quellenlage
- Die Entwicklung des deutschen Nationalismus im Spiegel der Kriegserinnerungen
- Die Rolle sozialer und psychologischer Faktoren in den Kriegserinnerungen
- Vergleichende Analyse von Kriegserinnerungen verschiedener sozialer Gruppen und Regionen
- Bewertung der traditionellen und neueren Interpretationen der Befreiungskriege
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel in der Geschichtsschreibung der Befreiungskriege, von einer nationalistisch geprägten Sichtweise im Kaiserreich hin zu einer kritischen Auseinandersetzung in der neueren Forschung. Die Arbeit zielt darauf ab, anhand von Kriegserinnerungen die Existenz und Ausprägung von deutschem Nationalismus in dieser Zeit zu untersuchen und dabei verschiedene soziale und regionale Perspektiven zu berücksichtigen. Die Methodik und die Auswahl der Quellen werden ebenfalls erläutert.
1. Der autobiographische Boom im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert den Aufschwung des autobiographischen Genres im 19. Jahrhundert im Kontext der Aufklärung, der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege. Es wird gezeigt, wie die tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüche zu einer verstärkten Reflexion des individuellen Lebenserfahrungen und deren Niederschrift in autobiographischen Texten führten, die dann als Quellen für die vorliegende Arbeit dienen. Der Wandel des autobiographischen Stils vom bekennenden zum erzählenden wird ebenfalls beschrieben.
2. Auf der Suche nach Nationalismus in den Quellen: Dieses Kapitel präsentiert die Analyse der Kriegserinnerungen, gegliedert in drei Phasen: Restauration und Vormärz, die nationalliberale Bewegung und Revolution von 1847/48, und das Kaiserreich. Es werden Szenen aus den Texten untersucht, die Aufschluss über die Einstellung der Autoren zu Deutschland als Vaterland und den Wunsch nach einer geeinten Nation geben. Die Auswahl der Quellen basiert auf der Systematisierung von Karen Hagemann, um eine breite Palette an Autoren aus verschiedenen sozialen Schichten und Regionen zu repräsentieren. Die Kapitel beschreiben die Methode der Quellenanalyse und die Auswahl der Quellen. Es wird ein Überblick über die verschiedenen Autoren und deren soziale und militärische Hintergründe gegeben.
Schlüsselwörter
Befreiungskriege, Napoleonische Kriege, deutscher Nationalismus, Kriegserinnerungen, Autobiographie, 19. Jahrhundert, nationalliberale Bewegung, Restauration, Kaiserreich, Quellenkritik, soziale Geschichte, regionale Unterschiede, Generationengedächtnis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung des deutschen Nationalismus in Kriegserinnerungen der Befreiungskriege
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des deutschen Nationalismus in Kriegserinnerungen von Zeitzeugen der Befreiungskriege (1813-1815). Sie hinterfragt die gängige Interpretation der Befreiungskriege als Wiege des deutschen Nationalismus und beleuchtet kritische Stimmen aus der neueren Forschung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Kriegserinnerungen verschiedener Autoren, um verschiedene Perspektiven und soziale Schichten zu erfassen. Die Auswahl basiert auf der Systematisierung von Karen Hagemann, um eine breite Palette an Autoren aus verschiedenen sozialen Schichten und Regionen zu repräsentieren. Der autobiographische Boom des 19. Jahrhunderts und seine Auswirkungen auf die Quellenlage werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Die Analyse der Kriegserinnerungen ist in drei Phasen gegliedert: Restauration und Vormärz (1815-1840), die nationalliberale Bewegung und die Revolution von 1847/48, und das Kaiserreich (1871-1914).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den autobiographischen Boom des 19. Jahrhunderts, die Entwicklung des deutschen Nationalismus im Spiegel der Kriegserinnerungen, die Rolle sozialer und psychologischer Faktoren, vergleichende Analysen verschiedener sozialer Gruppen und Regionen, und die Bewertung traditioneller und neuerer Interpretationen der Befreiungskriege.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit beschreibt die Methode der Quellenanalyse und die Auswahl der Quellen. Es wird ein Überblick über die verschiedenen Autoren und deren soziale und militärische Hintergründe gegeben. Die Analyse untersucht Szenen aus den Texten, die Aufschluss über die Einstellung der Autoren zu Deutschland als Vaterland und den Wunsch nach einer geeinten Nation geben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Befreiungskriege, Napoleonische Kriege, deutscher Nationalismus, Kriegserinnerungen, Autobiographie, 19. Jahrhundert, nationalliberale Bewegung, Restauration, Kaiserreich, Quellenkritik, soziale Geschichte, regionale Unterschiede, Generationengedächtnis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zum autobiographischen Boom des 19. Jahrhunderts, ein Kapitel zur Analyse der Kriegserinnerungen in drei Phasen (Restauration und Vormärz, nationalliberale Bewegung und Revolution von 1847/48, Kaiserreich) und ein Fazit.
Welches ist das übergeordnete Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, anhand ausgewählter Quellen die gängige Interpretation der Befreiungskriege als Wiege des deutschen Nationalismus zu überprüfen und die Kritik der neueren Forschung zu beleuchten, indem ein breites Spektrum an Autoren und deren Perspektiven berücksichtigt wird.
- Quote paper
- Christa Gries (Author), 2017, Nationalismus in den Kriegserinnerungen 1813-1815 anhand ausgewählter Quellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384444