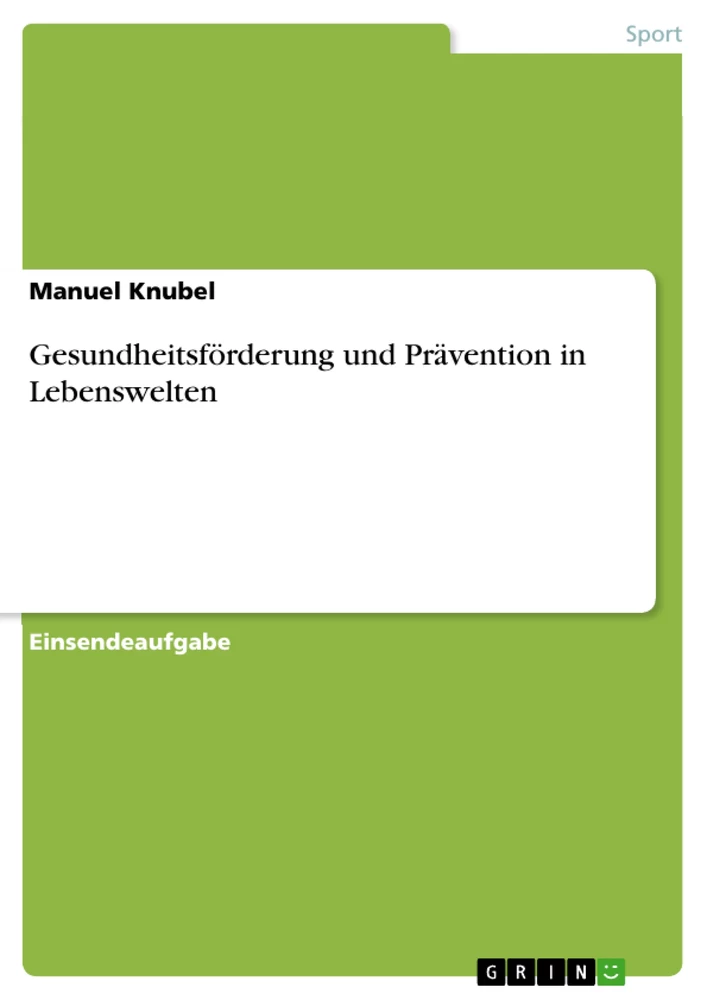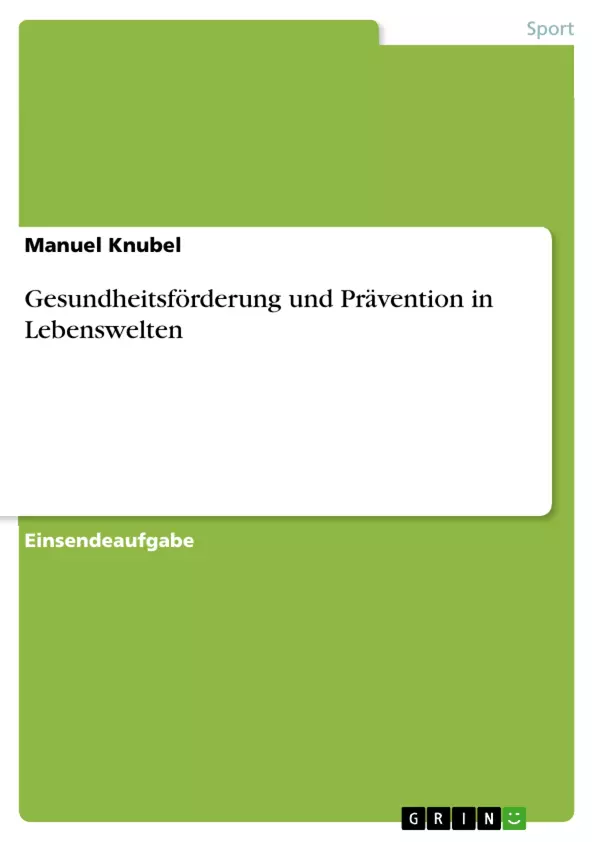Die Gesundheitsförderung und Prävention gewinnt immer mehr an Bedeutung und nimmt eine zentralisierte Rolle in den Lebenswelten, hier besonders im Alltag und Beruf, ein. In dieser Arbeit wird die Ausgangssituation im Setting Schule analysiert und Handlungsschwerpunkte für eine Gesundheitsförderung abgeleitet.
- Quote paper
- Manuel Knubel (Author), 2017, Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385124
Look inside the ebook