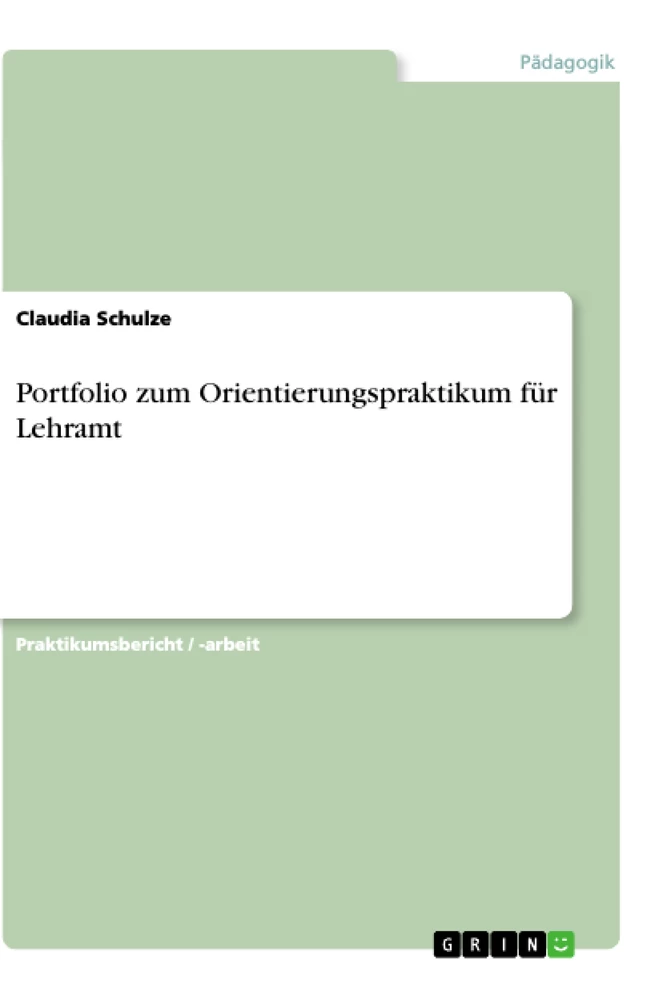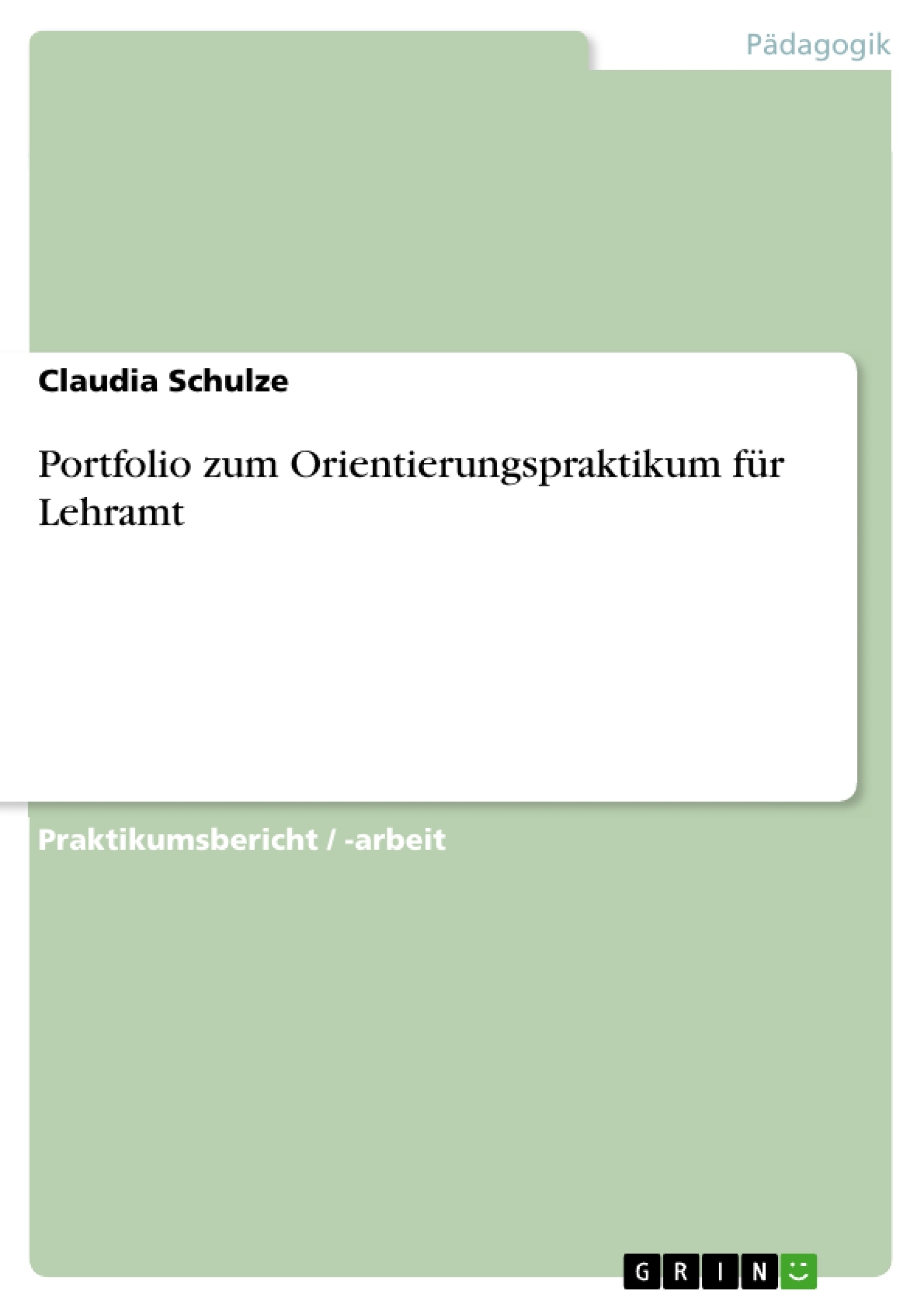Die vorliegende Arbeit bildet den Abschluss des Moduls Praxis- und Studienfeld Schule. Im Rahmen der Schulpraktischen Studien hospitierte ich Unterrichtsstunden und -einheiten sowie Pausenaufsichten und schulische Veranstaltungen an der Albert-Schweitzer Oberschule vom 08.09.14 bis zum 02.10.14. Ziele dieses Praktikums waren es, Charakteristika meines späteren Tätigkeitsfeldes Schule kennen zu lernen. Dazu gehören Verfahren der Erkundung der Praktikumsschule sowie der Unterrichtsbeobachtung und die daraus folgende Analyse und Beschreibung unter Anleitung von schulischen Mentor/innen. Die Belastungen im Lehrerberuf und Strategien für deren Bewältigung, die Analyse der Aufgaben der Lehrkräfte im Schulalltag und meinen Wandel von der Schüler- zur Lehrerrolle, sowie die Berufswahl zu reflektieren, waren weitere Ziele der Schulpraktischen Studie. Meine persönlichen Erwartungen waren es, Lehrer-Schüler-Verhältnisse sowie positive als auch evtl. negative Situationen des Schulalltags zu beobachten, um mein Bild von dem Beruf zu vervollständigen und somit angenehme aber auch problemhafte Seiten aufzuzeigen. Es sollte meine Berufsentscheidung festigen und mich in der Fortsetzung des Studiums ermutigen. Die Hospitation und der eigene Unterrichtsversuch sollten bestätigen, was ich im Studium bereits gelernt habe und ermitteln, wo meine Stärken liegen, wo meine Defizite sind und in welcher Hinsicht ich mich noch weiter entwickeln muss. Aus Gründen des praktischen Sprachgebrauchs und einem begünstigten Textfluss, verzichte ich auf das ständige Wiederholen der weiblichen oder männlichen Formen, gemeint sind aber stets beide. Um der Verschwiegenheitspflicht nachzukommen, habe ich im gesamten Portfolio sämtliche Schüler- und Lehrernamen entweder abgekürzt oder verschlüsselt. Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle meiner Mentorin aussprechen, die für mich stets eine kompetente Ansprechpartnerin war. Dank gilt auch dem Schulleiter, der es mir ermöglichte, mein Praktikum an der Albert-Schweitzer-Oberschule zu absolvieren und dadurch viele neue Erfahrungen sammeln zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung der Praktikumsschule
- Aufgaben und Belastungen im Lehrerberuf
- Unterrichtsbeobachtung: Frageverhalten im Unterricht
- Unterrichtsbeobachtung: Umgang mit Unterrichtsstörungen
- Hospitation - Nachvollzug didaktischer Entscheidungen
- Planung, Beschreibung und Analyse der Durchführung des Unterrichts
- Reflexion der Schulpraktischen Studie
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit stellt die Ergebnisse der Schulpraktischen Studien des Autors dar, die an der Albert-Schweitzer-Oberschule durchgeführt wurden. Im Mittelpunkt stand die Erkundung der Praktikumsschule, die Beobachtung von Unterrichtsstunden und die Analyse des Lehrerberufs. Das Ziel war es, die Charakteristika des späteren Tätigkeitsfeldes Schule kennenzulernen, die Belastungen im Lehrerberuf zu reflektieren und die eigene Rolle als zukünftiger Lehrer zu hinterfragen.
- Charakteristika der Praktikumsschule (Schulform, Gebäude, Schulpersonal, pädagogische Schwerpunktsetzungen)
- Aufgaben und Belastungen im Lehrerberuf
- Analyse von Unterrichtsbeobachtungen (Frageverhalten, Umgang mit Unterrichtsstörungen)
- Reflexion der eigenen Rolle als zukünftiger Lehrer
- Bewertung der Schulpraktischen Studien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Schulpraktischen Studien ein und erläutert die Ziele und Erwartungen des Autors. Es werden auch wichtige methodische Aspekte und die Dankesadresse an die Mentorin und den Schulleiter hervorgehoben.
- Beschreibung der Praktikumsschule: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Darstellung der Albert-Schweitzer-Oberschule. Es beschreibt die Schulform, das Gebäude, das Schulpersonal, die pädagogischen Schwerpunktsetzungen und die Besonderheiten der Schule. Der Autor gibt auch Einblicke in die Gewinnung der Daten über die Schule.
- Aufgaben und Belastungen im Lehrerberuf: Hier werden die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen des Lehrerberufs beleuchtet. Der Autor zeigt auf, welchen Belastungen Lehrer im Alltag ausgesetzt sind und welche Strategien zur Bewältigung dieser Belastungen existieren.
- Unterrichtsbeobachtung: Frageverhalten im Unterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse des Frageverhaltens im Unterricht. Der Autor beschreibt verschiedene Fragetypen und ihre Auswirkungen auf den Lernerfolg.
- Unterrichtsbeobachtung: Umgang mit Unterrichtsstörungen: In diesem Kapitel wird der Umgang mit Unterrichtsstörungen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Der Autor analysiert verschiedene Strategien zur Vermeidung und Bewältigung von Störungen.
- Hospitation - Nachvollzug didaktischer Entscheidungen: Hier werden die Beobachtungen des Autors während der Hospitationen im Unterricht analysiert. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der didaktischen Entscheidungen der Lehrer und ihrer Auswirkungen auf den Unterricht.
- Planung, Beschreibung und Analyse der Durchführung des Unterrichts: Das Kapitel befasst sich mit der eigenen Unterrichtsplanung des Autors. Es beschreibt den geplanten Unterricht, analysiert die Durchführung und reflektiert die Erfahrungen des Autors im Rahmen des eigenen Unterrichtsversuchs.
- Reflexion der Schulpraktischen Studie: In diesem Kapitel fasst der Autor die Erfahrungen und Erkenntnisse aus seinen Schulpraktischen Studien zusammen. Er reflektiert seine Erwartungen, den Lernprozess und die Auswirkungen der Studie auf seine Berufswahl.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Schulpraktische Studien, Lehrerberuf, Unterrichtsbeobachtung, Schulentwicklung, pädagogische Schwerpunktsetzungen, Belastungen im Lehrerberuf, Unterrichtsstörungen, didaktische Entscheidungen, Unterrichtsplanung, Reflexion.
- Arbeit zitieren
- Claudia Schulze (Autor:in), 2015, Portfolio zum Orientierungspraktikum für Lehramt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385837