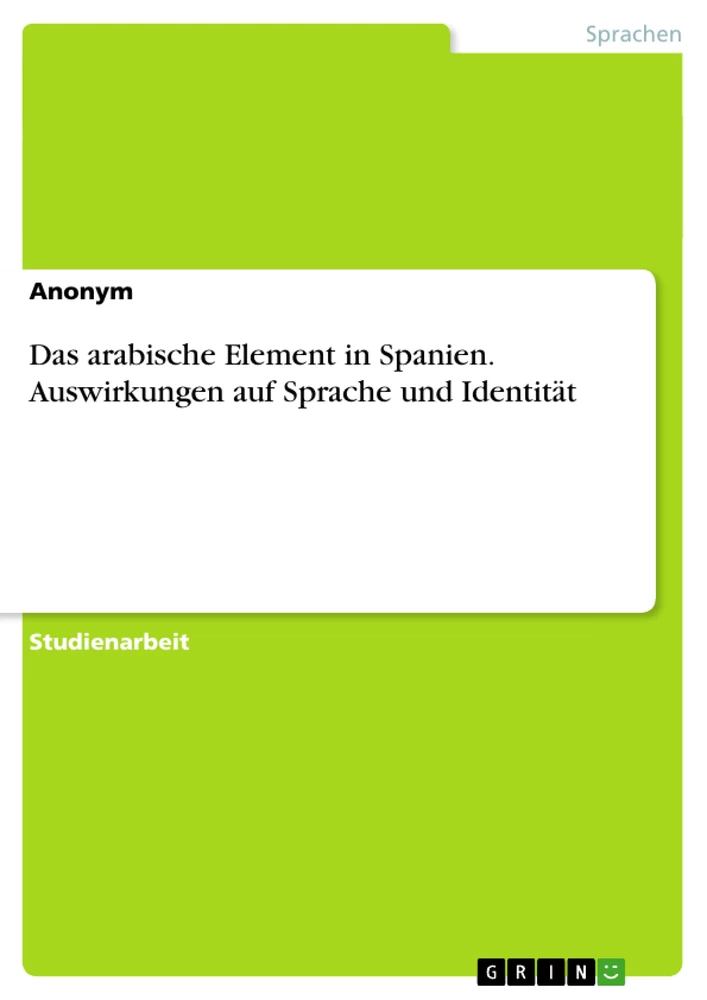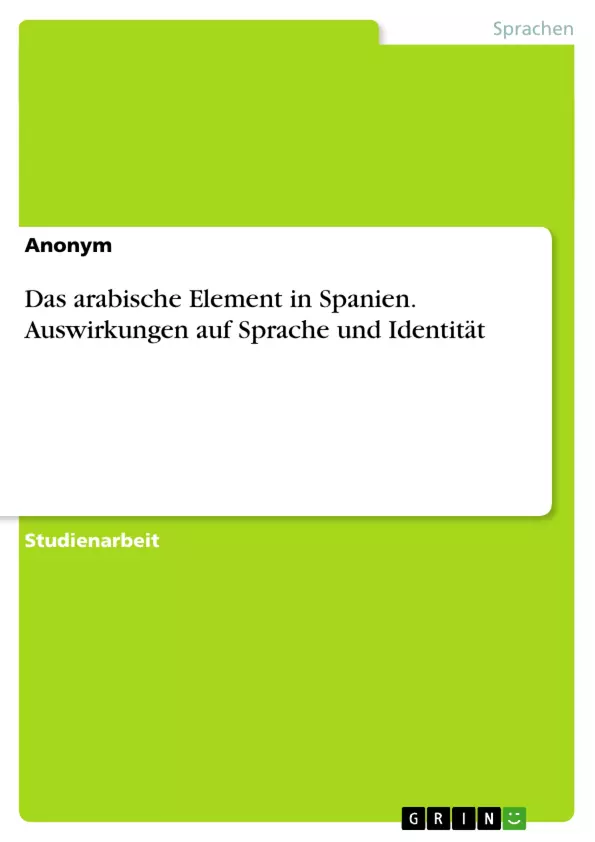[...] Innerhalb der romanischen Sprachwissenschaft, in deren Wirkungsbereich diese Arbeit entsteht, bietet sich als Untersuchungsgegenstand der Kontakt der Araber mit den romanischen Völkern auf der Iberischen Halbinsel im Mittelalter an. Freilich sind die Konsequenzen dieses Ereignisses vielfältig. Eine mögliche Facette jedoch erschien uns besonders interessant, nämlich das Aufeinandertreffen der Kulturen im Sinne eines Aufeinandertreffens von Sprachen. Ziel unserer Untersuchungen soll daher die Klärung der Frage sein, inwieweit sich der Kontakt zwischen Arabern und Iberern auf sprachlicher Ebene ausgewirkt hat und wie er aus sprachwissenschaftlicher Perspektive zu beurteilen ist. Sprache - ein Teil unserer Kultur. Kultur – ein Teil unserer Identität. Mit diesem Gedanken rücken wir eine weitere Dimension des oben beschriebenen Sprachkontaktes in den Mittelpunkt und formulieren somit eine weitere Fragestellung: Inwieweit hatte der (Sprach-) Kontakt identitätsstiftende Wirkung auf die Bevölkerung der damaligen Zeit, oder: Betrachten die Spanier heute die „arabischen Elemente“ in ihrem Leben (hier im Besonderen in ihrer Sprache) als identitätsstiftend? Beide Aspekte –der Sprachkontakt ebenso wie dessen Einfluss auf die Identitätsbildungerscheinen uns äußerst interessant und stellen in Kombination zudem eine besondere Betrachtungsweise des Untersuchungsgegenstandes dar, weswegen auch beide berücksichtigt werden sollen. Allerdings wurde während der Vorbereitungsphase schnell deutlich, dass selbst die erschöpfende Erörterung nur eines der beiden Aspekte deutlich über den vorgegebenen Rahmen dieser Arbeit hinausgehen würde. Aus diesem Grund haben wir zum einen beschlossen, gerade bei der Erarbeitung der theoretischen und wissenschaftlichen Grundlagen nicht allzu sehr ins Detail zu gehen; zum anderen soll der Bereich „(Sprach-) Kontakt und Identität“ nur am Rande analysiert werden – nicht zuletzt auch wegen der schwer möglichen Rekonstruierbarkeit des Einflusses auf die Menschen im Mittelalter. Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen des Sprachkontakts bzw. Sprachkonflikts. Dabei steht zunächst die Herausarbeitung der wissenschaftlich–theoretischen Grundlagen im Vordergrund. Im Anschluss daran werden die Kontaktsituationen zwischen Arabern und Iberern aufgezeigt, um abschließend eine Einschätzung aus sprachwissenschaftlicher Sicht zu wagen. Den zweiten Teil bildet schließlich die Betrachtung des Identitätsaspektes.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. AL-ANDALUS: OSMOSE UND SYMBIOSE DER KULTUREN UND SPRACHEN
- 1. Sprachkontakt und Sprachkonflikt aus sprachwissenschaftlicher Sicht
- 1.1 Sprachkontakt
- 1.2 Sprachkonflikt
- 1.3 Linguistische Konsequenzen von Sprachkontakt und Sprachkonflikt
- 1.3.1 Intralinguistische Konsequenzen
- 1.3.2 Interlinguistische Konsequenzen
- 1.4 Extralinguistische Konsequenzen von Sprachkontakt und Sprachkonflikt
- 2. Das arabische Iberien: eine Analyse der Konsequenzen für die sprachliche Entwicklung
- 2.1 Ein geschichtlicher Überblick
- 2.2 Der arabische Einfluss vom 8. bis zum 16. Jahrhundert
- 2.2.1 Die Invasion der Araber
- 2.2.2 Die Expansion der arabischen Kultur
- 2.2.3 Die Entstehung des Mozarabischen
- 2.2.4 Der arabische Einfluss während der Reconquista
- 2.2.5 Blütezeit der arabischen Hochkultur: Die Übersetzerschulen
- 2.2.6 Die Aljamiadotexte
- 2.3 Das arabische Element in der spanischen Sprache
- 2.3.1 Kurzcharakteristik der Arabischen Sprache
- 2.3.2 Der Arabismus im Spanischen - konkrete Beispiele
- 2.3.3 Zusammenfassende Aspekte
- 2.4 Die Araber im historischen Spanien – ein Resümee unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten
- 3. Convivencia de las culturas - ein identitätsstiftendes Modell?
- 3.1 Theoretische Grundlagen
- 3.2 Der arabische Einfluss auf die Identität Spaniens
- 3.3 Persönliche Stellungnahme
- III. SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Kontakt zwischen arabischer und iberischer Kultur im Mittelalter und dessen Auswirkungen auf die sprachliche Entwicklung Spaniens. Dabei werden die linguistischen Konsequenzen des Sprachkontakts und dessen Einfluss auf die Identitätsbildung der Bevölkerung untersucht.
- Die wissenschaftliche Definition und Einordnung des Sprachkontakts und Sprachkonflikts.
- Die Analyse des arabischen Einflusses auf die spanische Sprache, inklusive historischer Entwicklung und linguistischer Beispiele.
- Die Untersuchung des Konzepts der „Convivencia de las culturas“ im Hinblick auf seine identitätsstiftende Wirkung für Spanien.
- Die Erörterung des Einflusses der arabischen Sprache auf die kulturelle Identität Spaniens.
- Die Frage, ob die heutigen Spanier die „arabischen Elemente“ in ihrer Sprache als identitätsstiftend betrachten.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die wissenschaftlichen Grundlagen des Sprachkontakts und Sprachkonflikts. Hierbei werden verschiedene Konstellationen und deren Konsequenzen für die beteiligten Sprachen beleuchtet. Das zweite Kapitel widmet sich dem Kontakt zwischen Arabern und Iberern auf der Iberischen Halbinsel im Mittelalter. Es wird ein historischer Überblick gegeben und der Einfluss der arabischen Sprache auf die spanische Sprache analysiert. Im dritten Kapitel wird das Konzept der „Convivencia de las culturas“ beleuchtet und dessen Einfluss auf die Identität Spaniens untersucht. Die Frage, ob die heutigen Spanier die „arabischen Elemente“ in ihrer Sprache als identitätsstiftend betrachten, wird ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Sprachkontakt, Sprachkonflikt, Arabismus im Spanischen, kulturelle Identität, „Convivencia de las culturas“, historische Sprachentwicklung und linguistische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie stark beeinflusste die arabische Sprache das Spanische?
Nach dem Lateinischen ist Arabisch der wichtigste Einflussfaktor auf den spanischen Wortschatz. Über 4.000 Wörter (Arabismen) finden sich heute im modernen Spanisch, besonders in Bereichen wie Landwirtschaft, Architektur und Wissenschaft.
Was versteht man unter „Al-Andalus“?
Al-Andalus bezeichnet die Gebiete der Iberischen Halbinsel, die zwischen 711 und 1492 unter muslimischer Herrschaft standen und ein Zentrum des kulturellen und wissenschaftlichen Austauschs waren.
Wer waren die Mozaraber?
Mozaraber waren Christen, die unter muslimischer Herrschaft in Al-Andalus lebten. Sie übernahmen viele arabische Sitten und die Sprache, behielten aber ihren christlichen Glauben bei.
Was ist die „Convivencia“?
Der Begriff beschreibt das (teils idealisierte) friedliche Zusammenleben von Muslimen, Christen und Juden im mittelalterlichen Spanien, das eine einzigartige kulturelle Symbiose ermöglichte.
Was sind Aljamiado-Texte?
Dies sind Texte in einer romanischen Sprache (meist Altspanisch), die jedoch mit arabischen Schriftzeichen geschrieben wurden – ein deutliches Zeichen für den tiefgreifenden Sprachkontakt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2003, Das arabische Element in Spanien. Auswirkungen auf Sprache und Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38621