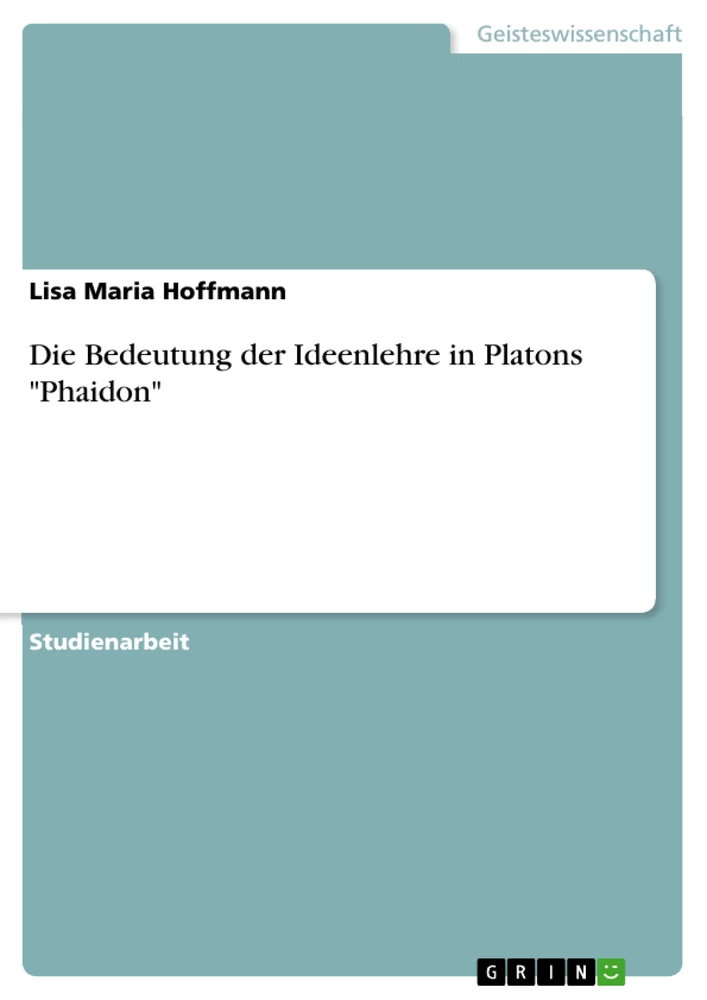Zielsetzung dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es, die Elemente der platonischen Ideenlehre im Phaidon herauszuarbeiten. Dabei soll die Frage, welche Bedeutung der Ideenlehre im genannten Kontext zukommt, im Zentrum stehen, um die These, dass das zentrale Thema des Phaidon mehr die Ideenlehre darstellt und weniger die Unsterblichkeitsbeweise der Seele, bestätigen oder falsifizieren zu können. Bevor jedoch die Aufmerksamkeit den einzelnen Komponenten der Ideenlehre gewidmet wird, soll in einem ersten Schritt prägnant auf den Begriff Idee eingegangen werden, um etwaige Missdeutungen auszuschließen.
Danach erfolgt die Beschäftigung mit den Elementen der Ideenlehre. In diesem Zusammenhang soll zum einen auf die Arten und Eigenschaften der Ideen im Phaidon und zum anderen auf den transzendenten Charakter der Ideen mit Blick auf die „Zweiweltentheorie“ eingegangen werden. Daran anschließend soll Platons Beschreibung der Idee als formale Ursache genauer betrachtet werden, während in einem nächsten Schritt das Verhältnis zwischen Ideen und Sinnendingen durch die Betrachtung der Teilhabe im Phaidon spezifiziert werden. Zuletzt ist es vonnöten, näher auf die immanenten Eigenschaften der Ideen einzugehen. Im Anschluss an die soeben skizzierte Untersuchung folgt die Schlussbetrachtung der Arbeit, die vordergründig, neben einem prägnanten Resümee der Betrachtung, die Beantwortung der die Arbeit leitenden Frage sowie eine Stellungnahme in Bezug auf die zuvorderst erwähnte These erstrebt.
Platons Werk Phaidon zählt zu den mittleren Dialogen des antiken Philosophen. Kutschera bezeichnet die Dialoge dieser Gruppe, zu denen u.a. auch die Werke Symposion, Politeia und Phaidros gehören, als die „großartigsten Zeugnisse platonischer Philosophie.“ Auch ein Blick auf die Rezeptionsgeschichte bestätigt die Bedeutung des Phaidon: Er gehört zu den meist rezipierten Werken Platons. Das mag mitunter an der hohen literarischen Qualität der Texte liegen und der detaillierten Ausarbeitung der letzten Stunden des Sokrates kurz vor seinem Tod. Der Großteil der Schrift ist den Unsterblichkeitsbeweisen der Seele gewidmet, die unter anderem der These, dass der Tod für Philosophen kein Übel darstellt, sondern etwas Erstrebenswertes ist, dienen. Nichtsdestoweniger thematisiert der Dialog weitere Elemente der platonischen Philosophie, darunter die Ideenlehre. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Ideenlehre nicht als zusammenhängendes Werk formuliert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Zum Begriff Idee
- Die Ideenlehre in Platons Phaidon
- Art und Eigenschaften der Ideen
- Transzendenz der Ideen
- Das Verhältnis der Ideen zu den empirischen Gegenständen
- Ideen als formale Ursachen
- Teilhabe
- Die immanenten Eigenschaften
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Primärwerke
- Sekundärwerke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die platonische Ideenlehre im Phaidon. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung der Ideenlehre im Kontext des Dialogs und die Überprüfung der These, dass die Ideenlehre das zentrale Thema des Phaidon darstellt, nicht die Unsterblichkeitsbeweise der Seele. Die Arbeit analysiert den Begriff "Idee" selbst, bevor sie die Komponenten der Ideenlehre im Phaidon detailliert untersucht.
- Der Begriff "Idee" in der platonischen Philosophie und seine etymologischen Wurzeln.
- Die Eigenschaften und Arten von Ideen im Phaidon.
- Der transzendente Charakter der Ideen und die "Zweiweltentheorie".
- Das Verhältnis zwischen Ideen und sinnlichen Gegenständen (Teilhabe).
- Die Rolle der Ideen als formale Ursachen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hinführung: Diese Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Phaidon als einen der wichtigsten Dialoge Platons, der sich zwar hauptsächlich mit der Unsterblichkeit der Seele beschäftigt, aber untrennbar mit der Ideenlehre verbunden ist. Sie betont den komplexen Charakter der Ideenlehre bei Platon, die nicht als systematisch entwickeltes Lehrstück betrachtet werden kann, und formuliert die Zielsetzung der Arbeit, die Bedeutung der Ideenlehre im Phaidon zu untersuchen und die These zu überprüfen, dass diese wichtiger ist als die Unsterblichkeitsbeweise.
2. Zum Begriff Idee: Dieses Kapitel befasst sich mit dem etymologischen Ursprung des Begriffs "Idee" und den semantischen Unterschieden zwischen dem griechischen Begriff und seiner deutschen Entsprechung. Es wird deutlich gemacht, dass der deutsche Begriff "Idee" die volle Bedeutung der griechischen Termini `idéa`, `ɛidos`, und `yέvos` nicht vollständig erfasst und dass eine differenzierte Betrachtung der Bedeutung notwendig ist, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Ambivalenz des deutschen Begriffs wird anhand des Dudens Bedeutungswörterbuchs veranschaulicht. Das Kapitel betont die Notwendigkeit, den Begriff "Idee" im Kontext der platonischen Philosophie vorsichtig und differenziert zu interpretieren.
3. Die Ideenlehre in Platons Phaidon: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Ideenlehre im Phaidon. Es untersucht die verschiedenen sprachlichen Formen, die Platon verwendet, um Ideen zu bezeichnen, wie substantivierte Adjektive im Singular mit bestimmtem Artikel und Verbindungen mit dem Derivationssuffix -heit. Es hebt hervor, dass Platon keine explizite Definition der Idee liefert, und konzentriert sich auf die Charakterisierung der Ideen anhand von Platons Beschreibungen. Das Kapitel legt den Grundstein für die detailliertere Betrachtung der Arten und Eigenschaften der Ideen im folgenden Abschnitt.
3.1 Art und Eigenschaften der Ideen: Dieses Kapitel analysiert die Eigenschaften der Ideen im Phaidon, ausgehend von Platons Charakterisierung der Idee als "das, was wir bezeichnen als >>dies selbst, was es ist<<". Es diskutiert weitere Eigenschaften der Ideen, wie sie im Kontext des Affinitätsarguments zur Unsterblichkeit der Seele dargestellt werden, und betont, dass Ideen als unveränderlich und einzigartig beschrieben werden.
Schlüsselwörter
Platon, Phaidon, Ideenlehre, Unsterblichkeit der Seele, Idee (idéa, ɛidos, yέvos), Transzendenz, Zweiweltentheorie, formale Ursache, Teilhabe, immanente Eigenschaften, Philosophie, Antike.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur wissenschaftlichen Arbeit: Platon's Ideenlehre im Phaidon
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht Platons Ideenlehre im Kontext seines Dialogs „Phaidon“. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung der Ideenlehre für den Dialog selbst und der Überprüfung der These, dass die Ideenlehre wichtiger ist als die Unsterblichkeitsbeweise der Seele, die ebenfalls im Phaidon behandelt werden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert den Begriff "Idee" an sich, seine etymologischen Wurzeln und seine semantischen Unterschiede zwischen Griechisch und Deutsch. Sie untersucht die Eigenschaften und Arten von Ideen im Phaidon, den transzendenten Charakter der Ideen und die damit verbundene Zweiweltentheorie. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Verhältnis zwischen Ideen und sinnlichen Gegenständen (Teilhabe) sowie der Rolle der Ideen als formale Ursachen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung (Hinführung), ein Kapitel zum Begriff "Idee", ein Hauptkapitel zur Ideenlehre im Phaidon (inkl. Unterkapiteln zu Art und Eigenschaften der Ideen, Transzendenz der Ideen und dem Verhältnis der Ideen zu empirischen Gegenständen), und eine Schlussbetrachtung. Zusätzlich enthält sie ein Literaturverzeichnis mit Primär- und Sekundärwerken.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem einzelnen?
Hinführung: Einleitung in das Thema und den Phaidon als wichtigen Platon-Dialog. Formulierung der Zielsetzung und These der Arbeit. Zum Begriff Idee: Etymologische und semantische Analyse des Begriffs "Idee" im Vergleich zwischen Griechisch und Deutsch. Die Ideenlehre in Platons Phaidon: Analyse der Ideenlehre im Phaidon, einschließlich der sprachlichen Formen, die Platon verwendet, um Ideen zu bezeichnen. 3.1 Art und Eigenschaften der Ideen: Analyse der Eigenschaften der Ideen im Phaidon basierend auf Platons Beschreibungen. Schlussbetrachtung: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Platon, Phaidon, Ideenlehre, Unsterblichkeit der Seele, Idee (idéa, ɛidos, yέnos), Transzendenz, Zweiweltentheorie, formale Ursache, Teilhabe, immanente Eigenschaften, Philosophie, Antike.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Ideenlehre im Phaidon zu untersuchen und die These zu überprüfen, dass die Ideenlehre das zentrale Thema des Dialogs darstellt, nicht die Unsterblichkeitsbeweise der Seele. Sie analysiert den Begriff "Idee" und die Komponenten der Ideenlehre im Detail.
Wie wird das Verhältnis zwischen Ideen und sinnlichen Gegenständen beschrieben?
Die Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Ideen und sinnlichen Gegenständen im Kontext der "Teilhabe". Es wird analysiert, wie Platon die Beziehung zwischen den transzendenten Ideen und den empirischen Gegenständen beschreibt.
Welche Rolle spielen die Ideen als formale Ursachen?
Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Ideen als formale Ursachen. Dies wird im Kontext der platonischen Philosophie und im Zusammenhang mit dem Phaidon untersucht.
- Citar trabajo
- Lisa Maria Hoffmann (Autor), 2017, Die Bedeutung der Ideenlehre in Platons "Phaidon", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386913