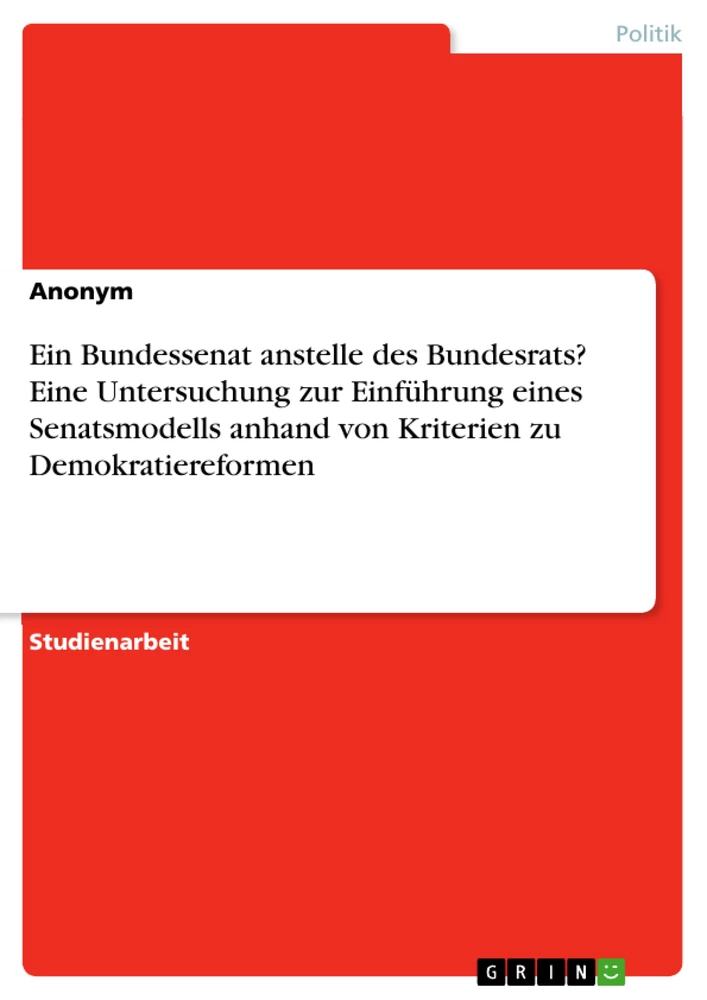In dieser Arbeit wird der Kriterienkatalog von Ludger Helms auf das Senatsmodell angewandt. Welches Verhältnis besteht zwischen Partei- und Landesinteressen im Bundesrat? Ist eine Reform, wie die Einführung eines Senats nach US-amerikanischem Vorbild, sinnvoll?
Zunächst soll daher ein Überblick über die Besonderheiten des Bundesrats im Institutionengefüge der Bundesrepublik dargelegt werden. Im Anschluss daran folgt eine Diskussion über die Probleme und den Reformbedarf, die diese Besonderheiten mit sich bringen. Anschließend wird auf der Grundlage der von Ludger Helms beschriebenen Kriterien zur Einordnung von Demokratiereformen ein Analyseraster erarbeitet. Darauf folgt eine genauere Beschreibung des Reformvorschlags in Form des Senatsmodells. Zuletzt soll anhand der aufgestellten Kriterien geprüft werden, ob – und wenn ja, inwieweit – durch eine mögliche Reform Vorteile zum bestehenden Status-Quo zu erwarten sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Besonderheiten und Funktionen
- Rolle im föderalen System der Bundesrepublik
- Einbindung in die Gesetzgebung der Bundesrepublik
- Probleme und Reformbedürftigkeit
- Komplizierte Mehrheitsfindung und „divided government“
- Landes- und Parteiinteressen
- Der Bundesrat als Blockadeinstrument?
- Zwischenfazit
- Bewertungskriterien der Reformoptionen
- Einführung eines Senats statt des Bundesrats?
- Das „Senatsmodell“
- Evaluation der Reformoption
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem deutschen Bundesrat und seinen Herausforderungen im Kontext des föderalen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die besondere Rolle des Bundesrats im politischen System und diskutiert die Probleme, die sich aus seiner Konstruktion ergeben. Insbesondere stehen die komplizierte Mehrheitsfindung, die Vermischung von Landes- und Parteiinteressen sowie die potentielle Blockadewirkung des Bundesrats im Vordergrund.
- Rolle und Funktionsweise des Bundesrats im deutschen Föderalismus
- Probleme und Reformbedürftigkeit des Bundesrats
- Vergleichende Analyse von Reformoptionen
- Evaluation des „Senatsmodells“ als mögliche Reform
- Normative Überlegungen zur Gestaltung des Bundesrats
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz des Bundesrats für das politische System Deutschlands. Kapitel 2 behandelt die Besonderheiten und Funktionen des Bundesrats und untersucht seine Rolle im föderalen System. Im Fokus von Kapitel 3 stehen die Probleme und die Reformbedürftigkeit des Bundesrats. Es werden die Herausforderungen der Mehrheitsfindung, die Verflechtung von Landes- und Parteiinteressen sowie die mögliche Blockadewirkung des Bundesrats analysiert. Kapitel 4 beschreibt die Bewertungskriterien, die für die Einordnung von Demokratiereformen relevant sind. In Kapitel 5 wird das „Senatsmodell“ als mögliche Reformoption vorgestellt und anhand der zuvor entwickelten Kriterien evaluiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Bundesrat im Kontext des deutschen Föderalismus, den Problemen der Mehrheitsfindung und der Blockadewirkung, der Einbindung von Landes- und Parteiinteressen sowie der Evaluation von Reformoptionen. Weitere wichtige Begriffe sind „Senatsmodell“, „divided government“, „Vetospieler“, „Demokratiereformen“ und „Pfadabhängigkeit“.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion hat der Bundesrat im deutschen System?
Der Bundesrat ist das Verfassungsorgan, durch das die Bundesländer an der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der EU mitwirken.
Warum wird der Bundesrat oft als Blockadeinstrument kritisiert?
Wenn im Bundesrat andere Mehrheitsverhältnisse herrschen als im Bundestag ("divided government"), können Parteien Landesinteressen nutzen, um Bundesgesetze aus parteipolitischen Gründen zu blockieren.
Was ist das vorgeschlagene "Senatsmodell"?
Das Senatsmodell, angelehnt an das US-Vorbild, sieht vor, dass die Mitglieder der zweiten Kammer direkt oder indirekt gewählt werden und freier von Weisungen der Landesregierungen entscheiden können.
Welche Probleme ergeben sich aus der Vermischung von Landes- und Parteiinteressen?
Diese Vermischung erschwert eine sachorientierte Gesetzgebung, da Entscheidungen oft im Hinblick auf anstehende Landtagswahlen oder die Bundespolitik getroffen werden statt zum Wohl des jeweiligen Bundeslandes.
Was sind "Vetospieler" in diesem Kontext?
Vetospieler sind Akteure, deren Zustimmung für eine Änderung des Status quo notwendig ist. Der Bundesrat fungiert im Gesetzgebungsprozess oft als ein solcher mächtiger Vetospieler.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2016, Ein Bundessenat anstelle des Bundesrats? Eine Untersuchung zur Einführung eines Senatsmodells anhand von Kriterien zu Demokratiereformen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387554