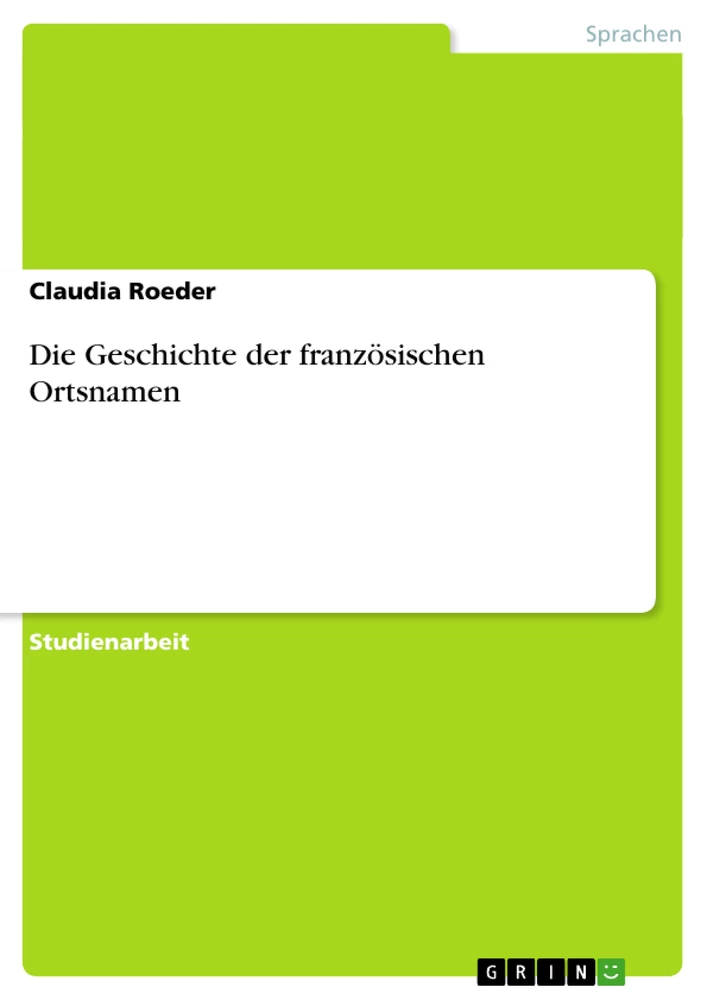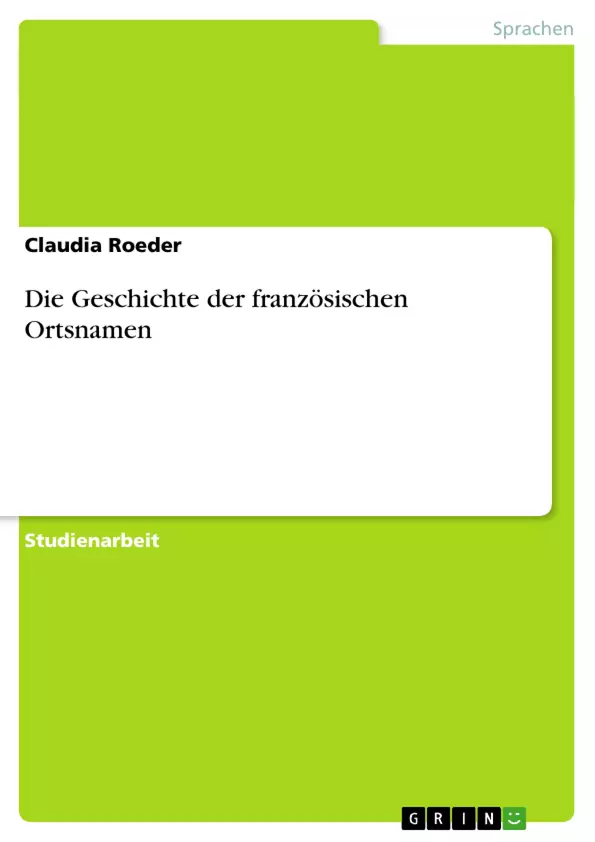Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Forschungsrichtung der Toponymastik am Beispiel Frankreichs, also mit der Wissenschaft von der Erforschung der französischen Ortsnamen. Die Toponymastik gehört neben der Anthroponymastik (Erforschung der Personennamen) zur Onomastik, der allgemeinen Namensforschung, die sich mit der Geschichte und Etymologie von Namen befasst.
Nach einer kurzen Einführung in die Grundproblematiken der Toponymastik werde ich ausführlich auf die Einflüsse der verschiedenen Volksstämme, die das Gebiet des heutigen Frankreichs bewohnt haben, auf die regionalen Ortsnamen eingehen.
Auf Details zur Forschungsrichtung der Toponymastik verzichte ich bewusst, da meine Kommilitonin und Referatspartnerin Christina Eggeling sich in ihrer Hausarbeit mit diesen Themen beschäftigen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Funktionen und Probleme der Toponymastik
- Allgemeine Ortsnamentypen
- Entstehung der französischen Ortsnamen
- Vorkeltische Elemente
- Keltische Elemente
- Lateinische Elemente
- Germanische Elemente
- Normannische Elemente
- Mittelalterliche Elemente
- Zusammenfassung
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Forschungsrichtung der Toponymastik am Beispiel Frankreichs, also mit der Wissenschaft von der Erforschung der französischen Ortsnamen. Die Arbeit erforscht die Einflüsse verschiedener Volksstämme auf die regionalen Ortsnamen in Frankreich.
- Die Geschichte der französischen Ortsnamen
- Die verschiedenen Volksstämme, die das Gebiet des heutigen Frankreichs bewohnt haben
- Die Funktionen und Probleme der Toponymastik
- Die allgemeinen Ortsnamentypen
- Die Bedeutung von Ortsnamen für die sprachliche Geschichte und die (frühere) Bevölkerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Toponymastik und deren Bedeutung für die Erforschung der französischen Ortsnamen ein.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Funktionen und Probleme der Toponymastik als recht junge Wissenschaft, die erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts konsequent betrieben wird.
Im dritten Kapitel werden allgemeine Ortsnamentypen nach formalen und inhaltlichen Kriterien vorgestellt. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die inhaltlichen Kriterien, die sich entweder auf die Art der benannten Objekte oder auf die ursprüngliche Bedeutung der Namen beziehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Toponymastik, der Erforschung der französischen Ortsnamen, und ihren Funktionen und Problemen. Sie untersucht die Einflüsse verschiedener Volksstämme, wie Kelten, Römer und Germanen, auf die Entstehung und Entwicklung der französischen Ortsnamen und stellt allgemeine Ortsnamentypen vor. Die Arbeit behandelt die sprachliche Geschichte und die Bedeutung von Ortsnamen für die (frühere) Bevölkerung.
Häufig gestellte Fragen zur Toponymastik in Frankreich
Was ist Toponymastik?
Toponymastik ist die Wissenschaft von der Erforschung der Ortsnamen. Sie untersucht die Etymologie, Geschichte und Bedeutung von Namen von Städten, Dörfern, Flüssen und Bergen.
Welchen Einfluss hatten die Kelten auf französische Ortsnamen?
Viele alte französische Ortsnamen haben keltische (gallische) Wurzeln, oft erkennbar an Endungen wie -dun (Festung, z. B. Verdun) oder -magos (Feld/Markt, z. B. Rouen).
Wie prägten die Römer die Namenslandschaft?
Die lateinischen Einflüsse sind massiv. Viele Namen leiten sich von römischen Villen oder Kastellen ab. Typisch sind Endungen auf -acum, das sich im Norden oft zu -ay/-y und im Süden zu -ac entwickelte.
Gibt es germanische Einflüsse in französischen Ortsnamen?
Ja, besonders im Norden und Osten. Namen auf -court (Hof) oder -ville (Siedlung, oft kombiniert mit germanischen Personennamen) zeugen von der fränkischen Landnahme.
Warum sind Ortsnamen für Historiker wichtig?
Ortsnamen fungieren als "sprachliche Fossilien". Sie geben Aufschluss über frühere Besiedlungsmuster, verschwundene Sprachen und die Beschaffenheit der Landschaft in vergangenen Zeiten.
- Quote paper
- Claudia Roeder (Author), 2004, Die Geschichte der französischen Ortsnamen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38780