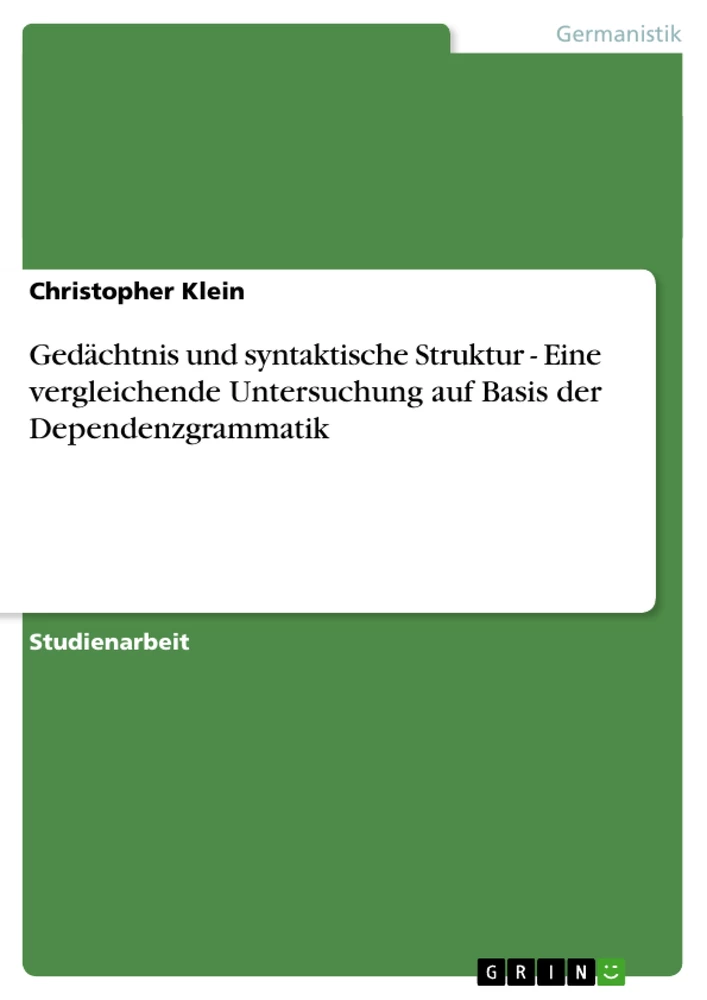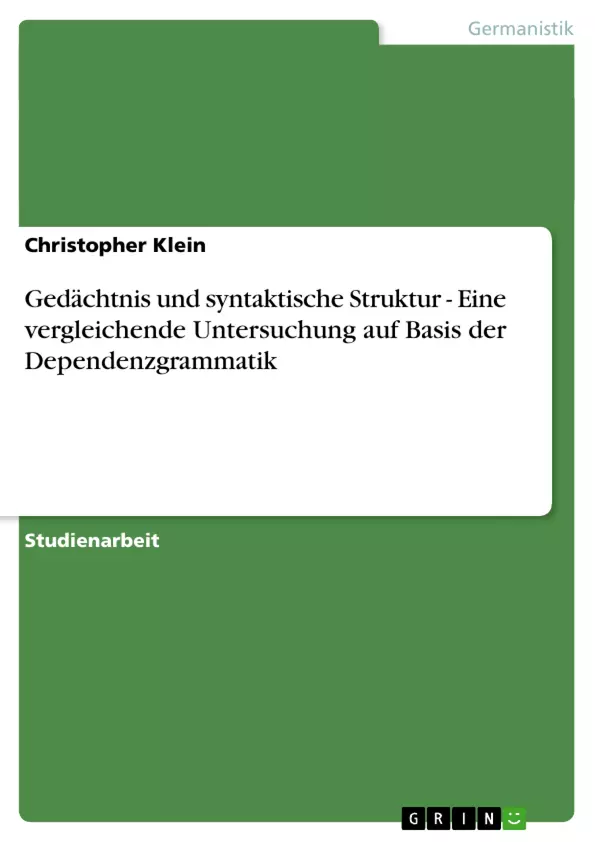„Jedes Wort ist, wenn es als Teil eines Satzes fungiert, nicht mehr isoliert wie im Wörterbuch. Zwischen ihm und benachbarten Wörtern stellt das Bewußtsein Konnexionen fest: Beziehungen, deren Gesamtheit das Gerüst des Satzes bildet.“1 Gleich zu Anfang des Werks „Grundzüge der strukturalen Syntax“2 beschreibt Lucien Tesnière, dass Sprache in ihrer grammatischen Struktur und Bewusstsein voneinander abhängen. Allein der Begriff der Dependenz verweist auf dieses Netzwerk von Abhängigkeiten, sei es auf der Beziehungsebene des Wortes zum Satz, der Worte untereinander oder, was hier im Vordergrund steht, die Verbindung zwischen Struktur der Sprache und der kognitiven Verarbeitung sprachlicher Zeichen. Wenn es, wie in der kognitiven Linguistik, um die Relation von Bewusstsein und Sprache geht, wird oft das Theorem der gene rativen Grammatik Chomskys zitiert. Dass Denk- und Sprachstrukturen interdependent sind, wie auch die Sapyr-Whorf-Hypothese umschreibt, gilt dieser Arbeit als Grundvoraussetzung. Zitieren ließe sich diese Auffassung von Wittgenstein und Foucault3 bis zurück zur Aufklärung mit Lessing und Humboldt. An dem Punkt der Sprachauffassung, an dem sich das sprachliche Zeichen von der Natürlichkeit der Dinge ablöst und in ein arbiträres Verweisverhältnis tritt, muss sich die Sprachwissenschaft notwendigerweise mit dem menschlichen Bewusstsein auseinandersetzen, da der Weg von Bezeichnendem und Bezeichnetem über die Fertigkeit des menschlichen Gehirns gewährleistet wird. Dabei beha ndelt die neuere Kognitionswissenschaft nicht nur die Bewusstseinsleistung des Menschen beim Verarbeiten von (sprachlicher) Information, sondern in abstrahierter Weise die grundlegende Bedingung von Informationsverarbeitung an sich, maßgeblich in der Kybernetik oder Automatentheorie. Andersherum ist die Auswirkung der Struktur der Syntax auf das menschliche Bewusstsein nicht weniger wichtig. [...] 1 Tesnière, Lucien: Grundzüge der strukturalen Syntax. Hrsg. v. Engel, Ulrich. Stuttgart: Klett-Cotta 1980. S. 25 2 Tesnière, Lucien: Tesnière, Lucien: Grundzüge der strukturalen Syntax. A.a.O. 3 Foucault, Michele: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1974.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. INFORMATION
- 1.1. Information und Bewusstsein
- 1.2. Information und Konnexion
- 1.3. Informationseinheiten - Chunks
- 2. KOGNITION
- 2.1. Sprache und Kognition
- 2.2. Bewusstsein
- 2.3. Gedächtnis
- 3. SPRACHSTRUKTUR UND DEPENDENZGRAMMATIK
- 3.1. Dependenz
- 3.2. Valenz und thematische Rolle (semantische Merkmale)
- 3.3. Verbale Satzglieder und Gedächtnisstruktur
- 3.4. Dependenzgrammatik und Theater
- 1. INFORMATION
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Interdependenz von sprachlicher Struktur und kognitiver Verarbeitung, insbesondere die Beziehung zwischen Gedächtnis und syntaktischer Struktur im Rahmen der Dependenzgrammatik. Sie hinterfragt die Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Informationsverarbeitung im Kontext grammatischer Strukturen.
- Die Beziehung zwischen Bewusstsein und Sprache
- Die Rolle des Gedächtnisses bei der Verarbeitung syntaktischer Strukturen
- Die Anwendung der Dependenzgrammatik zur Analyse sprachlicher und kognitiver Prozesse
- Die Grenzen der menschlichen Informationsverarbeitung in Bezug auf Satzlänge und Komplexität
- Die Verbindung zwischen Valenztheorie und kognitiver Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung legt die Grundvoraussetzung der Arbeit dar: die Interdependenz von Denk- und Sprachstrukturen. Sie führt den Gedanken Tesnières ein, dass grammatische Struktur und Bewusstsein eng miteinander verbunden sind, und betont die Relevanz der Dependenzgrammatik für das Verständnis dieses Zusammenhangs. Die Arbeit zielt darauf ab, die kognitiven Prozesse bei der Verarbeitung sprachlicher Information im Licht der Dependenzgrammatik zu untersuchen, wobei die Begrifflichkeiten der Kybernetik als hilfreiches Werkzeug dienen sollen. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie die Dependenzgrammatik Sprach- und Denkmöglichkeit in Einklang bringen kann. Die Einleitung skizziert die benötigten Begriffsklärungen (Information, Valenztheorie) und den methodischen Ansatz der Arbeit.
II. Hauptteil - 1. Information: Dieser Abschnitt beginnt mit der Klärung des Begriffs „Information“ und seiner Beziehung zum Bewusstsein. Es wird die mathematische Sichtweise des Bewusstseins als Setzen einer Grenze zwischen System und Umwelt diskutiert. Die Arbeit greift auf verschiedene Informationsmodelle zurück und sucht nach einem geeigneten Rahmen, um die Beziehung zwischen Grammatik und Kognition zu erhellen. Die Diskussion um unendlich lange Sätze verdeutlicht die Grenzen der menschlichen Informationsverarbeitung. Es wird darauf hingewiesen, dass ein geeignetes Modell für das Verständnis von Information gefunden werden muss, um die Klärung zwischen Grammatik und Kognition voranzutreiben. Die Grenzen der menschlichen Informationsverarbeitung werden im Kontext der Grammatik analysiert.
Häufig gestellte Fragen zu: Interdependenz von Sprachstruktur und Kognitiver Verarbeitung
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Interdependenz von sprachlicher Struktur und kognitiver Verarbeitung, insbesondere die Beziehung zwischen Gedächtnis und syntaktischer Struktur im Rahmen der Dependenzgrammatik. Sie analysiert die Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Informationsverarbeitung im Kontext grammatischer Strukturen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen Bewusstsein und Sprache, der Rolle des Gedächtnisses bei der syntaktischen Verarbeitung, der Anwendung der Dependenzgrammatik zur Analyse sprachlicher und kognitiver Prozesse, den Grenzen der menschlichen Informationsverarbeitung (bezogen auf Satzlänge und Komplexität) und der Verbindung zwischen Valenztheorie und kognitiver Wissenschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung (I), einen Hauptteil (II) und einen Schluss (III). Der Hauptteil ist weiter unterteilt in Abschnitte zu Information (inkl. Information und Bewusstsein, Information und Konnexion, Informationseinheiten - Chunks), Kognition (inkl. Sprache und Kognition, Bewusstsein, Gedächtnis) und Sprachstruktur und Dependenzgrammatik (inkl. Dependenz, Valenz und thematische Rolle, verbale Satzglieder und Gedächtnisstruktur, Dependenzgrammatik und Theater).
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung stellt die Grundvoraussetzung der Arbeit – die Interdependenz von Denk- und Sprachstrukturen – dar. Sie führt den Gedanken Tesnières zur engen Verbindung von grammatischer Struktur und Bewusstsein ein und betont die Relevanz der Dependenzgrammatik. Sie skizziert den methodischen Ansatz und die benötigten Begriffsklärungen (Information, Valenztheorie).
Worauf konzentriert sich der Abschnitt "Information"?
Dieser Abschnitt klärt den Begriff "Information" und seine Beziehung zum Bewusstsein. Es wird die mathematische Sichtweise des Bewusstseins diskutiert und nach einem geeigneten Rahmen zur Erhellung der Beziehung zwischen Grammatik und Kognition gesucht. Die Diskussion unendlich langer Sätze verdeutlicht die Grenzen der menschlichen Informationsverarbeitung.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet die Dependenzgrammatik als analytisches Werkzeug, um die kognitiven Prozesse bei der Verarbeitung sprachlicher Information zu untersuchen. Begrifflichkeiten der Kybernetik werden als hilfreich erachtet.
Welche Fragen stehen im Mittelpunkt der Untersuchung?
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Dependenzgrammatik Sprach- und Denkmöglichkeit in Einklang bringen kann und wie die Grenzen der menschlichen Informationsverarbeitung im Kontext der Grammatik zu verstehen sind.
- Quote paper
- Christopher Klein (Author), 2005, Gedächtnis und syntaktische Struktur - Eine vergleichende Untersuchung auf Basis der Dependenzgrammatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39195