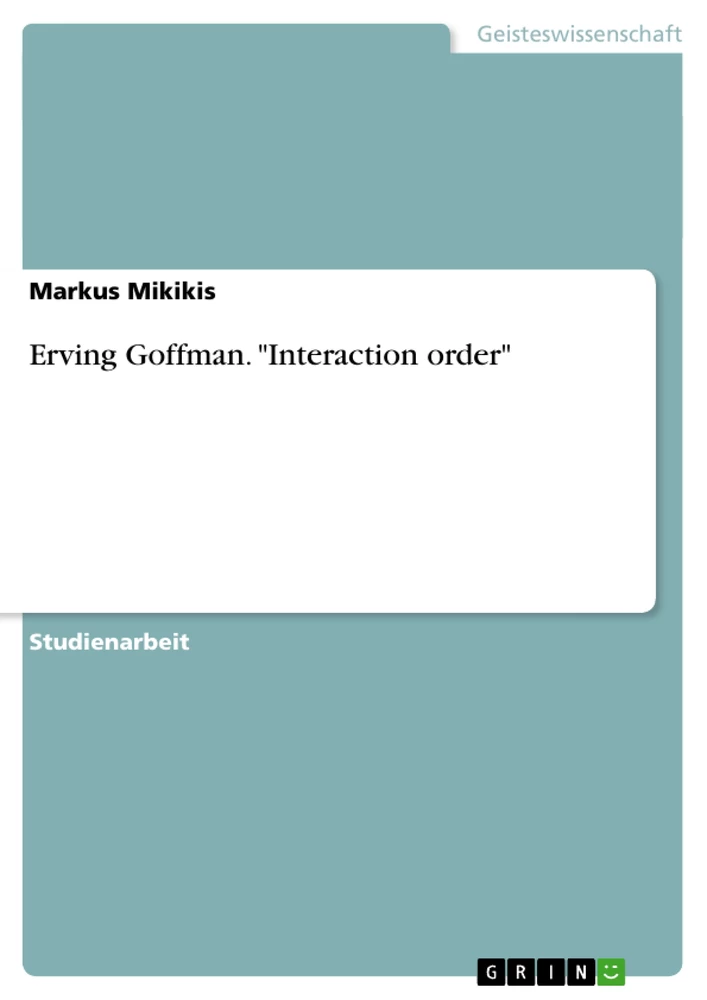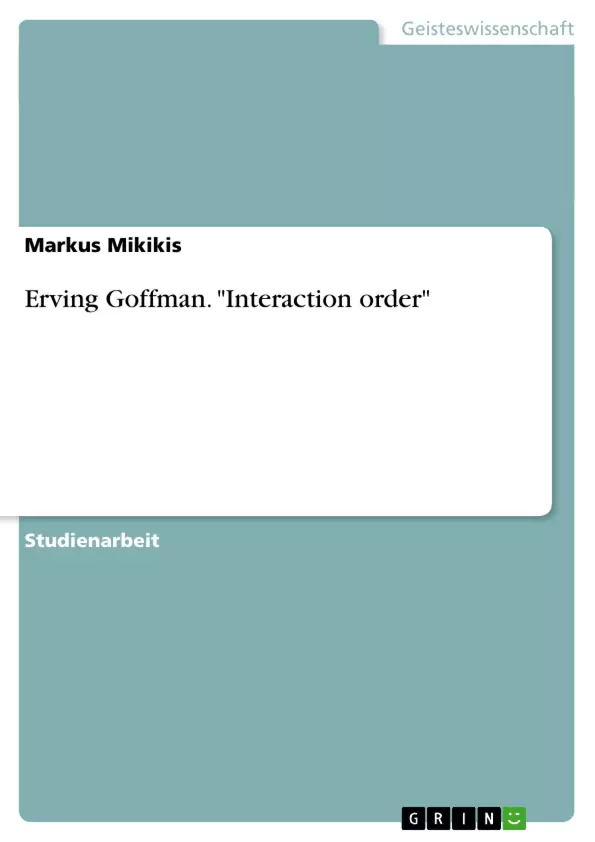Erving Goffman gehört heute zu den populärsten und meist gelesenen Soziologen unserer Zeit. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, und mehrfach mit Preisen ausgezeichnet (vgl. Hettlage/Lenz 1991:25). Goffmans Interesse galt nicht dem Entwurf einer umfassenden makrosoziologischen Theorie, sondern vielmehr dem kleinräumigen Bereich der face-to-face-Interaktion, und somit dem Mikrokosmos (vgl. Hettlage/Lenz 1991:8-9). Nicht zuletzt ging es ihm um die Etablierung des Themas face-to-face-Interaktion als einen eigenständigen Forschungsgegenstand.
Dennoch wird Goffman aus der Perspektive des soziologischen Wissenschaftsbetriebs auch heute noch häufig als Außenseiter wahrgenommen, dessen gesamtes Forschungsprogramm und einzelnen Konzepte als kaum einheitlich und perspektivenreich betrachtet werden, und der den Zugang zu den Makro-Perspektiven seines Faches nie gefunden habe (vgl. Hettlage/Lenz 1991:9).
Neben der Darstellung seines Forschungsprogramms möchte ich untersuchen, ob diese Einschätzung zutreffend ist, oder sein Beitrag für die Entwicklung der Soziologie unterschätzt wird, was auf zahlreiche merkwürdige Details und Beispiele in seinen Werken, eines „zu guten Stils“ (Hettlage/Lenz 1991:9), stark variierenden Begriffsverwendungen und der Person Goffman an sich zurück zu führen sein könnte.
Zunächst werde ich die grundlegenden Lebensdaten Goffmans darstellen. Dann möchte ich einen ersten Einblick in Goffmans Forschungsprogramm ermöglichen, indem ich eine Übersicht über die wesentlichen Inhalte erstelle. Eine Beschreibung seiner wissenschaftlichen Vorgehensweise wird nützlich sein, um die erwähnten Details und Beispiele, im Rahmen der Untersuchung von face-to-face-Interaktionen, als zweckgerichtet zu verstehen.
Anschließend werde ich das erste veröffentlichte Buch Goffmans, „The Presentation of Self in Everyday Life“ (dt.: Wir alle spielen Theater, 1969), vorstellen, um ein erstes Verständnis seines Werkes und der darin enthaltenen Vorstellungen und Begrifflichkeiten zu ermöglichen.
Darauf folgt eine weniger ausführliche Darstellung seiner Bücher „Interaction Ritual“ (dt.: Interaktionsrituale, 1986) und „Frame Analysis“ (1974; dt.: Rahmen – Analyse, 1977), die mir in Bezug auf Goffmans Gesamtwerk, neben „Wir alle spielen Theater“, den repräsentativsten Eindruck vermittelt haben. Schließlich möchte ich versuchen einen Bezug zwischen diesen Büchern aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographie
- Goffmans Forschungsprogramm
- Forschungsprogramm der „interaction order“
- Vorgehensweisen
- „Wir alle spielen Theater“
- Theater-Analogie
- Darsteller und Darstellungen
- Das Ensemble
- Ort und ortsbestimmtes Verhalten
- Kommunikation außerhalb der Rolle
- „Interaktionsrituale“
- Einführung
- „Techniken der Imagepflege“
- „Über Ehrerbietung und Benehmen“
- „Verlegenheit und soziale Organisation“
- „Rahmen-Analyse“
- Goffmans Hauptwerk
- Primäre Rahmen
- Modulationen (Keying) und Täuschungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Forschungsprogramm von Erving Goffman, insbesondere sein Konzept der „interaction order“. Sie untersucht, ob Goffman, trotz seiner Konzentration auf Mikro-Interaktionen, einen bedeutenden Beitrag zur Soziologie leistet.
- Das Forschungsprogramm der „interaction order“
- Die Anwendung der Theater-Analogie auf Alltagsinteraktionen
- Die Bedeutung von Interaktionsritualen in der sozialen Ordnung
- Goffmans „Rahmen-Analyse“ und die Interpretation sozialer Situationen
- Die Frage, ob Goffmans Arbeit die Makro-Perspektiven der Soziologie vernachlässigt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Biographie von Erving Goffman, um seinen Werdegang und die Entstehung seines Forschungsprogramms zu beleuchten. Sie stellt Goffmans Kernkonzept der „interaction order“ vor, das die Regelstrukturen der face-to-face-Interaktion untersucht.
Im nächsten Schritt wird Goffmans Buch „The Presentation of Self in Everyday Life“ analysiert, das die Theater-Analogie auf Alltagsinteraktionen anwendet. Hierbei werden die Rollen, die Darsteller und das „Ensemble“ der Interaktion untersucht.
Die Arbeit setzt sich dann mit Goffmans „Interaction Ritual“ auseinander, das die Bedeutung von Interaktionsritualen für die soziale Ordnung beleuchtet. Hier werden die „Techniken der Imagepflege“, die „Ehrerbietung und das Benehmen“ sowie „Verlegenheit und soziale Organisation“ näher betrachtet.
Schließlich wird Goffmans „Frame Analysis“ behandelt, das die Interpretation sozialer Situationen durch die „Rahmen-Analyse“ untersucht. Dabei werden primäre Rahmen und Modulationen (Keying) sowie Täuschungen thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der „interaction order“, face-to-face-Interaktion, Goffmans Forschungsprogramm, Theater-Analogie, Interaktionsrituale, „Rahmen-Analyse“, Mikro-Perspektiven, soziale Ordnung, Imagepflege, Ehrerbietung, Benehmen, Verlegenheit, Täuschungen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Erving Goffman unter der „interaction order“?
Die „interaction order“ beschreibt den eigenständigen Bereich der Face-to-Face-Interaktion als Mikrokosmos sozialer Ordnung, der eigenen Regeln und Strukturen folgt.
Wie funktioniert die Theater-Analogie in Goffmans Werk?
In „Wir alle spielen Theater“ beschreibt Goffman den Alltag als Bühne, auf der Individuen Rollen einnehmen, um ein bestimmtes Selbstbild (Image) vor einem „Ensemble“ zu präsentieren.
Was sind Interaktionsrituale?
Es handelt sich um standardisierte Verhaltensweisen in sozialen Begegnungen, die der Imagepflege, der Ehrerbietung und der Vermeidung von Verlegenheit dienen.
Was ist das Ziel der „Rahmen-Analyse“?
Die Rahmen-Analyse untersucht, wie Menschen soziale Situationen interpretieren und organisieren, um die Frage „Was ist es, das hier vorgeht?“ zu beantworten.
Warum gilt Goffman oft als soziologischer Außenseiter?
Kritiker bemängeln oft, dass er sich fast ausschließlich auf die Mikro-Ebene konzentriert und keine umfassende makrosoziologische Theorie entwickelt habe.
- Quote paper
- Markus Mikikis (Author), 2005, Erving Goffman. "Interaction order", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39267