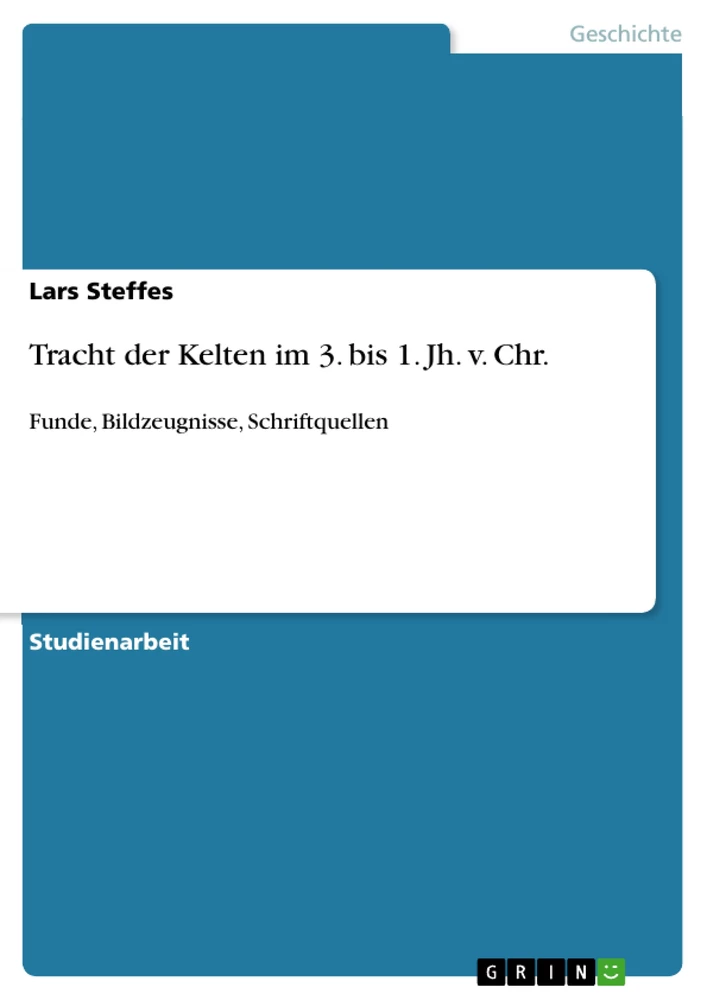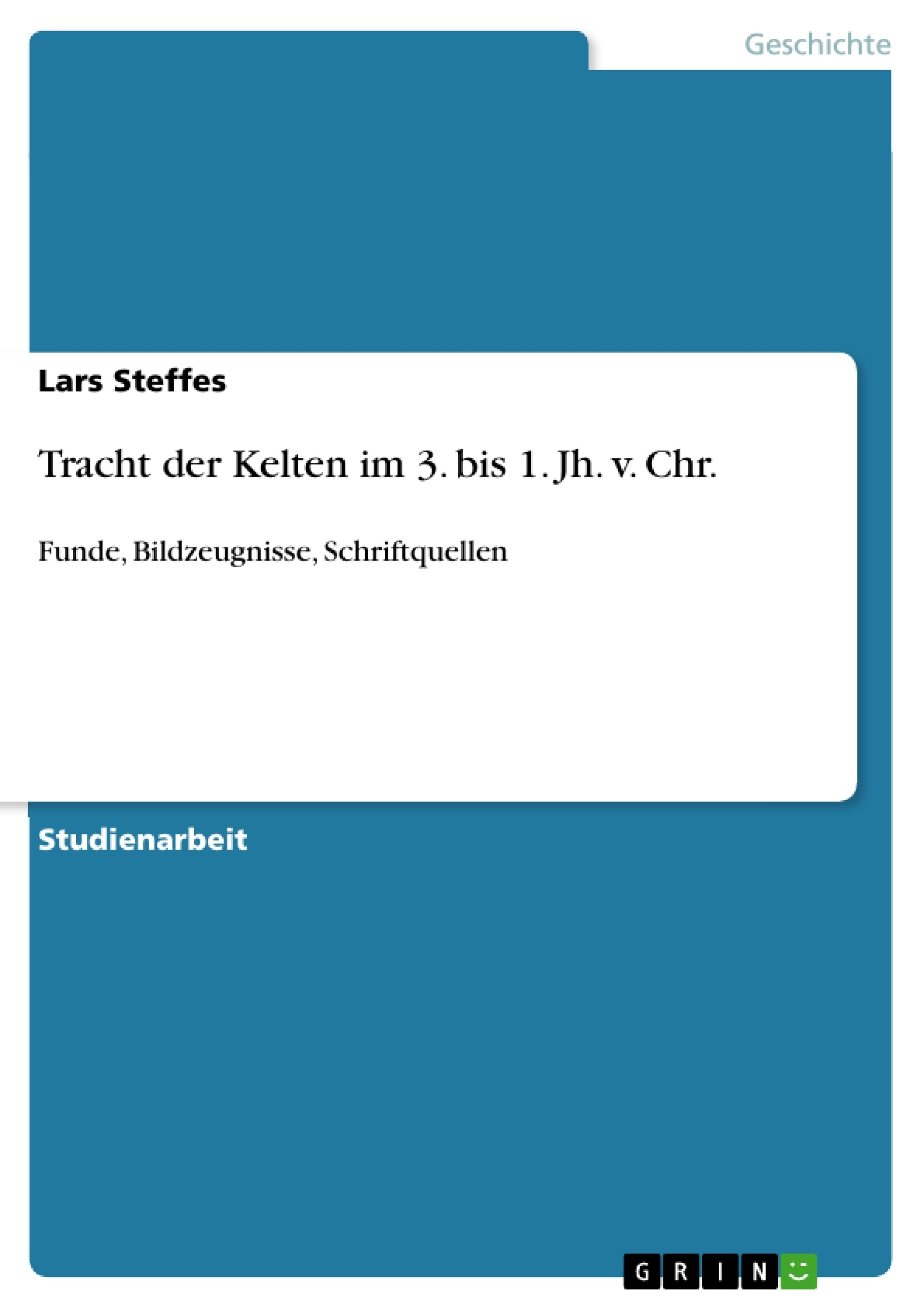Die folgende Hausarbeit soll einen Überblick über die Tracht der Kelten im 3. bis
1. Jh. v. Chr. geben. Ziel ist es, Handwerk und Mode der Kelten aufgrund von
Funden und Überlieferungen, sowohl aus dem eigentlichen Kulturkreis wie auch
aus der Sicht anderer Völker zu beleuchten. Hauptaugenmerk wird auf die
eigentlichen Textilien und weniger auf weitere Trachtbestandteile gelegt. Eine
Ausnahme bilden die Fibeln, die ein wichtiger Bestandteil der Tracht und schon
mehr ein Kleidungsstück als ein reines Accessoires waren. Als erstes wird das
Handwerk betrachtet. Wie und mit welchen Mitteln werden die Stoffe für die
Textilherstellung gewonnen und verarbeitet? Dann werden anhand von Funden,
die in der Latènezeit vorherrschenden Stoffe und Muster im Kontext zu früheren
Perioden dargestellt. Da diese Funde nur Bruchstücke der eigentlichen Kleidung
sind und keine Auskunft über die Trageweise geben, werden abschließend
künstlerische Darstellungen aus dieser Zeit betrachtet. Dabei werden
Darstellungen aus dem eigenen Kulturraum und von benachbarten Völkern
herangezogen. Damit ergibt sich ein Überblick von der Gewinnung der Stoffe
über Verarbeitung hin zu der handwerklichen Herstellung und der Trageweise. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grundlagen der Textilherstellung
- 1.1 Das Rohmaterial
- 1.2 Die Verarbeitung
- 1.3 Das Weben
- 2. Funde
- 2.1 Latènezeitliche Gewebefunde
- 2.2 Grabfunde
- 2.3 Latènezeitliche Fibeln
- 3. Bildzeugnisse
- 3.1 Beispiele aus dem Osthallstattkreis
- 3.2 Der Gundestrup-Kessel
- 4. Die Kelten in der Kunst der Griechen und Römer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Tracht der Kelten im 3. bis 1. Jh. v. Chr. und zielt darauf ab, Handwerk und Mode der Kelten basierend auf Funden und Überlieferungen aus dem eigenen Kulturkreis sowie der Perspektive anderer Völker zu beleuchten. Der Schwerpunkt liegt auf den Textilien selbst, wobei Fibeln als wichtiger Bestandteil der Tracht und als mehr als nur ein Accessoire betrachtet werden.
- Die Gewinnung und Verarbeitung von Rohmaterialien für die Textilherstellung
- Die in der Latènezeit vorherrschenden Stoffe und Muster im Kontext zu früheren Perioden anhand von Funden
- Künstlerische Darstellungen der Tracht aus der Latènezeit, sowohl aus dem eigenen Kulturraum als auch von benachbarten Völkern
- Die handwerkliche Herstellung von Textilien und die Trageweise der Kleidung
- Die Bedeutung von Fibeln als Teil der Tracht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 1 behandelt die Grundlagen der Textilherstellung, wobei das Rohmaterial, die Verarbeitung und das Weben im Detail betrachtet werden. Kapitel 2 befasst sich mit Funden aus der Latènezeit, darunter Gewebefunde, Grabfunde und Fibeln. Kapitel 3 analysiert Bildzeugnisse, insbesondere Beispiele aus dem Osthallstattkreis und den Gundestrup-Kessel, um Einblicke in die Tracht der Kelten zu gewinnen. Kapitel 4 beleuchtet die Darstellung der Kelten in der Kunst der Griechen und Römer. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Kelten, Tracht, Textilherstellung, Latènezeit, Funde, Bildzeugnisse, Fibeln, Rohmaterial, Verarbeitung, Weben, Muster, Kunst, Griechen, Römer, Handwerk, Mode
- Quote paper
- Lars Steffes (Author), 2005, Tracht der Kelten im 3. bis 1. Jh. v. Chr., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39331