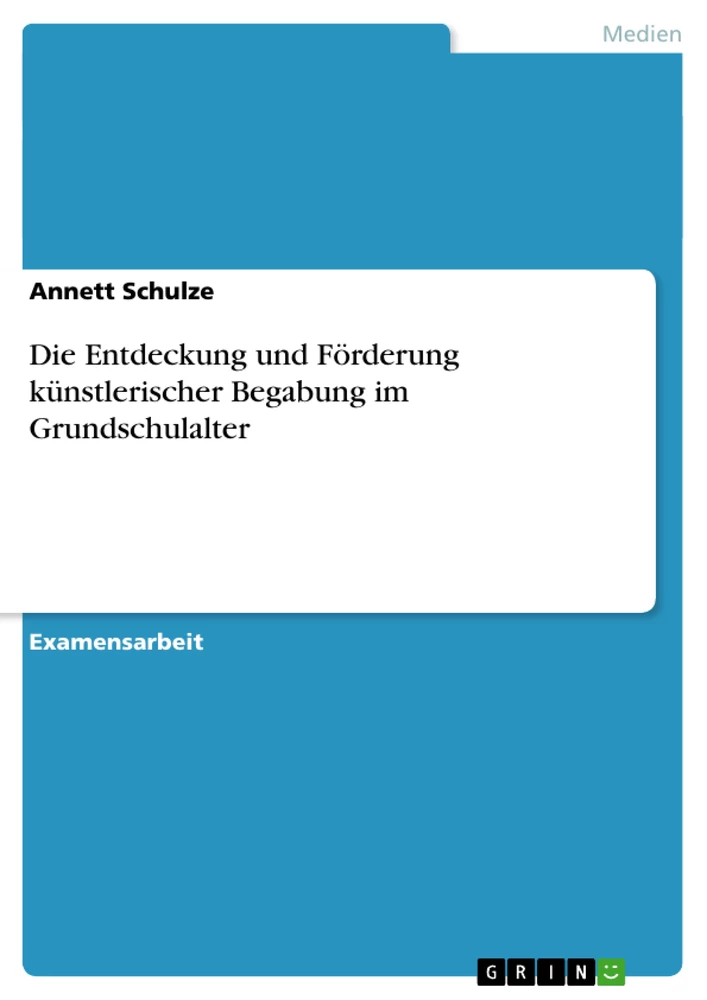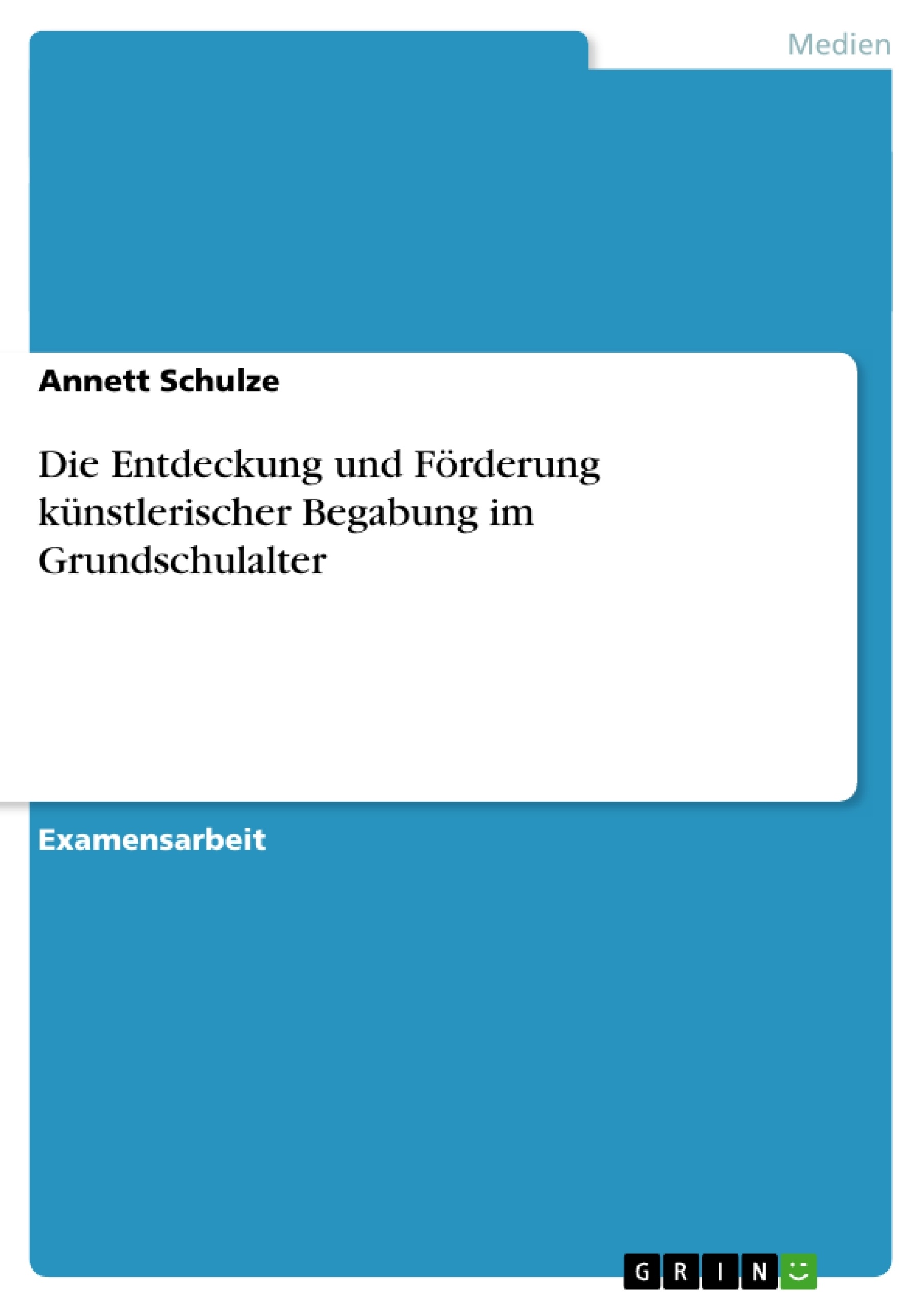„Keine Gesellschaft kann es sich leisten, ihre begabtesten Mitglieder zu ignorieren, und alle Gesellschaften müssen sich ernsthaft damit auseinandersetzen, wie sie besondere Talente am besten fördern und ausbilden können.“ (WINNER 1998, 9)
Als ich mich, angeregt durch eine Lehrveranstaltung im Lernbereich Kunst und Gestaltung, mit dem Leben verschiedener Künstler beschäftigte, war ich fasziniert von den zeichnerischen Fähigkeiten, über die sie schon als Kinder verfügten. Pablo Picasso, z.B., zählte zu den Wunderkindern. Bereits mit sieben Jahren fertigte er akademische Zeichnungen an, deren minuziöse Genauigkeit ihn selbst erschreckten (vgl. WALTHER 1999, 8). Auch über Claude Monet wird berichtet, dass sich sein Zeichentalent früh zeigte (vgl. ZEIDLER 1998, 7). Mein so entstandenes Interesse an der künstlerischen Begabung im Kindesalter wurde verstärkt, als mir Kinderzeichnungen eines Erwachsenen aus meinem persönlichen Umfeld in die Hände fielen. Ich fragte mich, ob da vielleicht auch eine künstlerische Begabung vorhanden war, die aber leider nicht entdeckt und somit nicht gefördert werden konnte, wie vielleicht bei vielen anderen Kindern auch. Um in meiner zukünftigen Tätigkeit als Grundschullehrerin sensibilisiert für die künstlerische Begabung zu sein, entschied ich mich für das Thema: „Die Entdeckung und Förderung künstlerischer Begabung im Grundschulalter“.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Theoretische Grundlagen
- 1.1. Begabung
- 1.1.1. Definition von Begabung
- 1.1.1.1. Intelligenz
- 1.1.1.2. Kreativität
- 1.1.1.3. Motivation
- 1.1.2. Formen der Hochbegabung
- 1.1.3. Identifikation der Hochbegabten
- 1.1.4. Förderungsmöglichkeiten für begabte Kinder
- 1.1.1. Definition von Begabung
- 1.2. Zwischenzusammenfassung
- 1.1. Begabung
- 2. Zum bildnerischen Verhalten des Kindes
- 2.1. Die Kinderzeichnung als Gegenstand der Forschung
- 2.2. Die Entwicklung der zeichnerischen Fähigkeiten beim Kind
- 2.3. Die Entwicklung der Raumdarstellung
- 3. Die künstlerische Begabung
- 4. Zur künstlerischen Teilbegabung - Die visuell-räumliche Intelligenz
- 5. Die eigene Untersuchung zur Entdeckung einer künstlerischen Teilbegabung im Grundschulalter
- 5.1. Zur Untersuchungsklasse
- 5.2. Kriterien für die künstlerische Teilbegabung
- 5.3. Methodische Vorüberlegungen zur Entdeckung einer künstlerischen Teilbegabung
- 5.4. Zur Durchführung der Untersuchung
- 5.5. Allgemeine Auswertung der Zeichnungen
- 5.6. Vorstellung der Kinder und Auswertung ihrer Zeichnungen bei Verdacht auf eine künstlerische Teilbegabung
- 6. Förderungsmöglichkeiten für die Entfaltung der künstlerischen Teilbegabung
- 6.1. Allgemeine Hinweise
- 6.2. Zum Kennzeichnen von Raumtiefe mit Linien
- 6.3. „Ich beobachte die Segelschiff-Regatta”
- 6.4. Perspektivisches Zeichnen
- 6.4.1. „Unsere Stadt”
- 6.4.2. „Kubismus für Kinder”
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entdeckung und Förderung künstlerischer Begabung im Grundschulalter. Ihr Ziel ist es, die Kriterien für eine künstlerische Begabung bei Grundschulkindern zu ermitteln und zu überprüfen, ob es in einer Rostocker Grundschulklasse Kinder mit künstlerischer Begabung gibt. Die Arbeit untersucht außerdem, wie diese Fähigkeiten gefördert werden können.
- Definition von künstlerischer Begabung
- Entwicklung künstlerischer Fähigkeiten im Kindesalter
- Identifikation und Förderung von Kindern mit künstlerischer Begabung
- Methoden zur Erkennung und Förderung der visuell-räumlichen Intelligenz
- Praktische Anwendung der Erkenntnisse im Grundschulunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und stellt die Relevanz der künstlerischen Begabung für die Entwicklung von Kindern heraus. Kapitel 1 behandelt die theoretischen Grundlagen der Begabung, einschließlich Definitionen, Formen und Identifikationsmethoden. Es werden verschiedene Förderungsmöglichkeiten für begabte Kinder diskutiert. Kapitel 2 widmet sich dem bildnerischen Verhalten des Kindes und beleuchtet die Entwicklung der zeichnerischen Fähigkeiten und der Raumdarstellung. Kapitel 3 und 4 befassen sich mit der künstlerischen Begabung und der visuell-räumlichen Intelligenz, die als Teilbereich der künstlerischen Begabung betrachtet wird. In Kapitel 5 wird die eigene Untersuchung zur Entdeckung einer künstlerischen Teilbegabung im Grundschulalter vorgestellt, einschließlich der Methoden, Kriterien und Ergebnisse. Kapitel 6 befasst sich mit den Förderungsmöglichkeiten für die Entfaltung der künstlerischen Teilbegabung. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasst und einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder bietet.
Schlüsselwörter
Künstlerische Begabung, visuell-räumliche Intelligenz, Kinderzeichnung, Grundschulalter, Förderung, Identifikation, Raumdarstellung, Methoden, Untersuchung, Ergebnisse
- Arbeit zitieren
- Annett Schulze (Autor:in), 2002, Die Entdeckung und Förderung künstlerischer Begabung im Grundschulalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39709