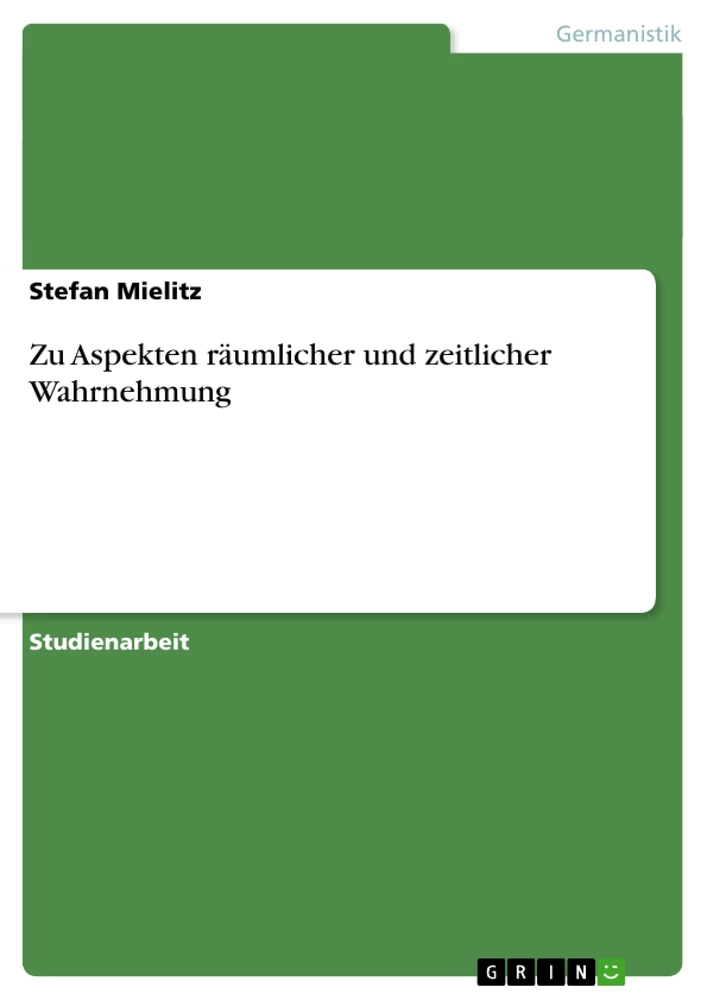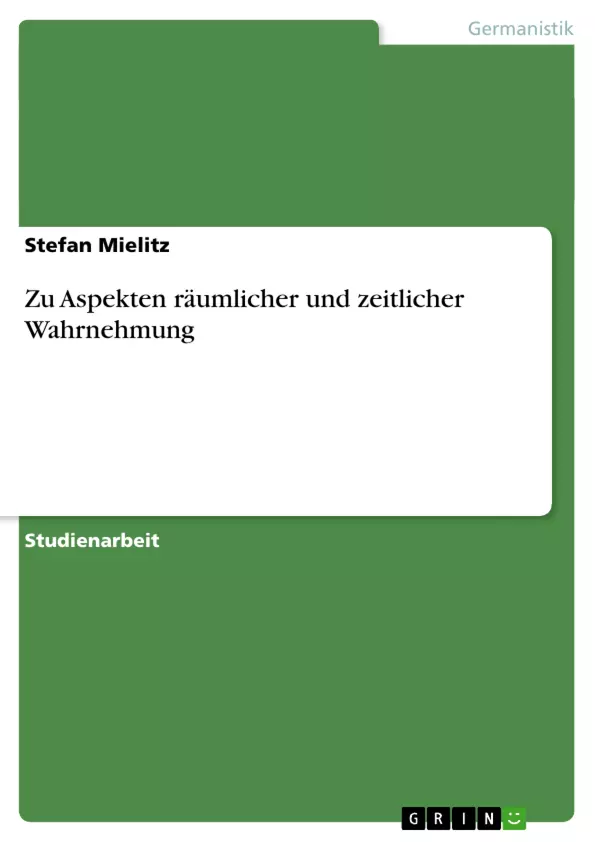[...] Wenn man weiter nachdenkt, könnte einem auffallen, dass wir täglich mit einer Raum- und Zeitbeziehungen beschreibenden Sprache operieren und somit in der Lage sein müssen, räumliche und zeitliche Konfigurationen sprachlich zu erfassen. Wir fragen beispielsweise nach einem Weg oder beschreiben jemandem einen eben solchen. Wir schildern Vorgänge, die sich an anderen Orten zu früheren Zeiten ereigneten. Wir erzählen Freunden von unserer Wohnung, beschreiben Bilder, Räume, Abläufe usw. und benutzen dabei noch eine metaphorisch strukturierte Sprache, „da unser Erleben und unser Alltagshandeln weitgehend eine Sache der Metapher ist.“ Die Überlegungen könnten zu dem hier noch sehr undeutlichen Befund kommen, dass der Mensch, da er von Raum und Zeit umgeben ist, gezwungen wird, diese kognitiv zu strukturieren und sprachlich zu verarbeiten. Dazu benutzt er, soweit die Forschung dies heute beurteilen kann, verschiedene sprachliche und kognitive Repräsentationsmodelle, um diese Raum- und Zeitbeziehungen zu erfassen, zu beschreiben und zu artikulieren. Einige wenige jener Modelle, welche sich letztlich alle in gewisser Weise aufeinander beziehen und in ihrer Gesamtschau ein erhellendes Licht auf die angesprochene kognitive und sprachliche Repräsentation werfen könnten, sollen in dieser Arbeit in ihren Grundzügen dargestellt werden. Dazu werden in einem ersten Abschnitt Aspekte der Beziehung zwischen Raum, Zeit und sprachlicher Abbildung angesprochen. Ein wesentliches sprachliches Mittel dieser Abbildung bilden deiktische Ausdrücke, welchen sich der zweite Abschnitt widmen soll. Um überhaupt zu einer Artikulation jener Beziehungen gelangen zu können, bedarf es der internen kognitiven Repräsentation von Räumlichkeit. Diese findet mit Hilfe kognitiver Karten statt. Deren Funktion und Wirkungsweisen sollen in einem dritten Abschnitt beleuchtet werden, um sich im vierten der Raum- und Zeitmetaphorik widmen zu können. Die Metapher wird hier nicht mehr in einem klassischen Sinne als rein sprachinternes Phänomen, sondern vielmehr als ein Element der Strukturierung und Implementierung von Wirklichkeit verstanden, welche eng an kognitive Prozesse gebunden ist und jene darzustellen vermag.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Raum, Zeit und Sprache
- 1.1 Zum Verhältnis zwischen Raum und Zeit
- 1.2 Zur Struktur der Raum- und Zeitwahrnehmung
- 2. Deixis
- 2.1 Begriffsbestimmung
- 2.2 Die Zeigarten der Sprache
- 2.3 Die Modi im Zeigfeld
- 2.4 Anaphora
- 3. Kognitive Karten
- 3.1 Definitorisches
- 3.2 Räumliches Verhalten und kognitive Karten – die Lage von Phänomenen
- 3.3 Räumliches Verhalten und kognitive Karten – die Eigenschaften von Phänomenen
- 4. Raum- und Zeitmetaphorik
- 4.1 Zu Aspekten der kognitiven Metapherntheorie
- 4.1 Konzeptsysteme
- 4.1 Orientierungsmetaphern
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der kognitiven und sprachlichen Verarbeitung von Raum und Zeit. Sie untersucht die Beziehung zwischen diesen Konzepten und der Sprache sowie die Rolle von Deixis, kognitiven Karten und Metaphern bei der Repräsentation und Artikulation räumlicher und zeitlicher Beziehungen. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die kognitiven Prozesse zu entwickeln, die dem menschlichen Umgang mit Raum und Zeit zugrunde liegen.
- Das Verhältnis zwischen Raum, Zeit und Sprache
- Die Rolle von Deixis bei der sprachlichen Abbildung von Raum und Zeit
- Die Funktion kognitiver Karten bei der Repräsentation räumlicher Information
- Raum- und Zeitmetaphorik als Mittel der Strukturierung und Implementierung von Wirklichkeit
- Die Bedeutung von Raum- und Zeitkonzepten für das menschliche Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Relevanz der kognitiven und sprachlichen Verarbeitung von Raum und Zeit für den Menschen. Sie stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die behandelten Themengebiete.
- 1. Raum, Zeit und Sprache: Dieser Abschnitt untersucht das Verhältnis zwischen Raum und Zeit und erläutert ihre enge Verbindung, die sich sowohl in naturwissenschaftlichen als auch in geisteswissenschaftlichen Betrachtungsweisen zeigt. Die Relevanz dieser Verbindung für die Sprache wird hervorgehoben, und es werden Überlegungen zum Verhältnis von Raum und Zeit angestellt.
- 2. Deixis: In diesem Kapitel wird der Begriff der Deixis erläutert und die verschiedenen Zeigarten der Sprache vorgestellt. Die verschiedenen Modi im Zeigfeld und die Bedeutung von Anaphora im Kontext der Deixis werden ebenfalls behandelt.
- 3. Kognitive Karten: Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit der Funktion und Wirkungsweise kognitiver Karten als Mittel zur Repräsentation von Räumlichkeit. Die Bedeutung kognitiver Karten für das menschliche Verhalten im Raum wird untersucht.
- 4. Raum- und Zeitmetaphorik: Das vierte Kapitel widmet sich der Raum- und Zeitmetaphorik und betrachtet sie als ein Element der Strukturierung und Implementierung von Wirklichkeit. Die enge Verknüpfung von Metapher mit kognitiven Prozessen wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Raum, Zeit, Sprache, Deixis, kognitive Karten, Metapher, räumliche Wahrnehmung, zeitliche Wahrnehmung, kognitive Prozesse, sprachliche Repräsentation, Wirklichkeitskonstruktion.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Raum, Zeit und Sprache zusammen?
Der Mensch nutzt Sprache, um räumliche und zeitliche Konfigurationen kognitiv zu strukturieren und zu artikulieren, etwa bei Wegbeschreibungen oder Erzählungen.
Was bedeutet Deixis im sprachlichen Kontext?
Deixis bezeichnet sprachliche Mittel (Zeigwörter), mit denen auf Personen, Orte oder Zeitpunkte im Umfeld der Sprechsituation verwiesen wird.
Was sind kognitive Karten?
Kognitive Karten sind interne mentale Repräsentationen von Räumen, die uns helfen, uns zu orientieren und die Lage von Objekten zu speichern.
Welche Rolle spielen Metaphern bei der Wahrnehmung von Raum und Zeit?
Metaphern dienen nicht nur der Dekoration, sondern strukturieren unsere Wirklichkeit und helfen uns, abstrakte Zeitkonzepte durch räumliche Begriffe begreifbar zu machen.
Was ist eine Anaphora?
Im Kontext der Deixis bezieht sich eine Anaphora auf sprachliche Rückverweise auf bereits im Text erwähnte Sachverhalte oder Objekte.
- Quote paper
- Stefan Mielitz (Author), 2004, Zu Aspekten räumlicher und zeitlicher Wahrnehmung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40702