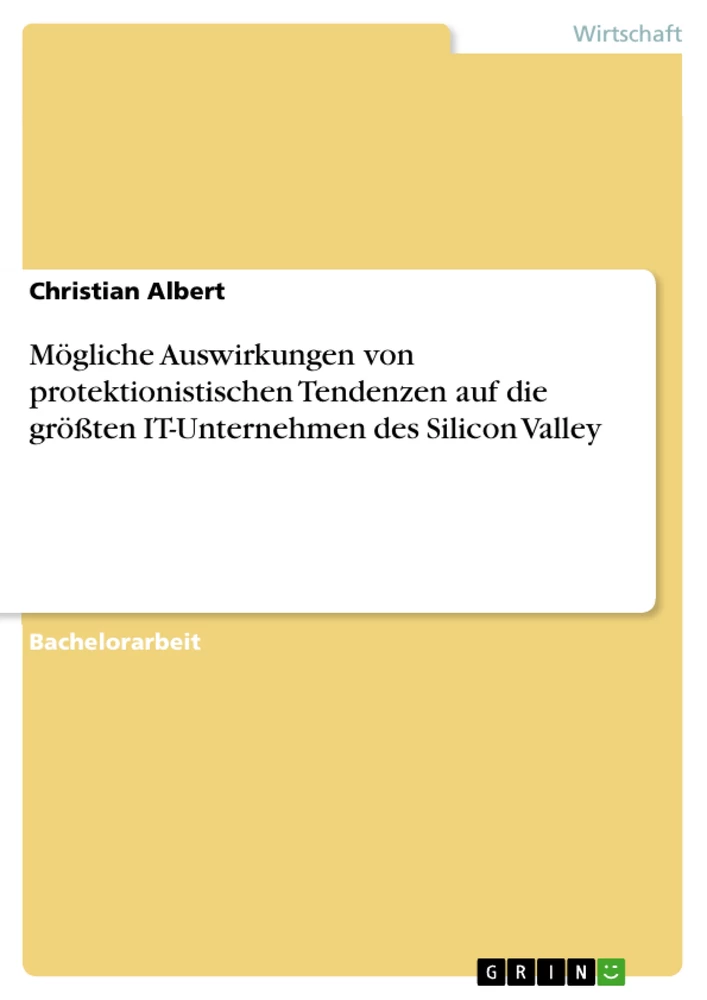Ein gewöhnlicher Tag irgendwo auf dem Planeten: Menschen arbeiten mit Hilfe von Microsoft Software, chatten mit ihrem Apple Smartphone mit Freunden über Facebook oder dem zum gleichen Konzern gehörigen WhatsApp, und kauften sich ihr iPhone möglicherweise über Amazon, nachdem sie sich mit Hilfe der Google Suche darüber informiert haben. So oder so ähnlich spielt sich der Alltag von Milliarden von Menschen jeden Tag ab. Dieses Beispiel zeigt welchen Anteil die größten IT-Unternehmen des Silicon Valley mittlerweile am Alltag des 21. Jahrhunderts haben. Alle hier behandelten IT-Riesen haben entweder ihren Hauptsitz an einem bestimmten Ort, oder profitieren zumindest von dessen Innovationsgeist: dem Silicon Valley. Das in der Nähe von San Francisco gelegene Tal gilt wie wohl kein anderer Ort auf der Welt als Schmiede für innovative Ideen, freies Denken und das Zusammenspiel verschiedenster genialer Visionäre. Es ist dabei vollkommen belanglos aus welchem Teil der Welt diese kommen, welcher Religion sie angehören oder welche Hautfarbe sie haben.
Am 19. Januar 2017 wurde in Washington D.C. mit Donald Trump allerdings ein Mann als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt, dessen Habitus mit der weltoffenen Einstellung des Silicon Valley vordergründig eher wenig gemein hat.
Diese Thesis hat mehrere Ziele. Zum einen soll der Leser ein Verständnis dafür erhalten, was Protektionismus ist und welche Chancen und Risiken er mit sich bringen kann. Außerdem soll sie zeigen, dass nicht nur Staaten protektionistisch handeln, sondern auch die hier behandelten Unternehmen. Des Weiteren soll am Beispiel Chinas aufgezeigt werden, welche Auswirkungen protektionistische Politik auf große, einheimische IT-Konzerne haben kann. Die wichtigste Aufgabe dieser Bachelor Thesis besteht jedoch darin, einen Blick auf mögliche Auswirkungen der Abschottung auf Alphabet/Google, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft zu werfen.
Deshalb wurden neben den (möglichen) Auswirkungen des bereits von Trump verabschiedeten „Travel Ban“ vor allem die beiden Instrumente, die mit Importbeschränkungen einhergehen, namentlich tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse, näher betrachtet. Deren Auswirkungen wurden auf die genannten Unternehmen übertragen. Nachdem die Konzerne allerdings in sehr vielen Feldern des IT-Marktes aktiv sind, wurden ihre Aktivitäten noch in Marktsegmente unterteilt. Anschließend wurden mögliche Auswirkungen protektionistischer Tendenzen auf eben jene Segmente herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Die unterschiedlichen Welten Donald Trumps und des Silicon Valley
2 Vorstellung der behandelten Unternehmen
2.1 Alphabet
2.2 Amazon
2.3 Apple
2.4 Facebook
2.5 Microsoft
3 Protektionismus allgemein
4 Auswirkungen protektionistischer Maßnahmen
4.1 Tarifäre Handelshemmnisse
4.2 Nicht-tarifäre Handelshemmnisse
4.3 Strengere Einreisebestimmungen
5 Strategien der IT-Konzerne
5.1 Effekte der Netzwerkökonomien
5.1.1 Netzwerkeffekte
5.1.2 Lock-In-Effekt
5.1.3 Skaleneffekte
5.1.4 Anwendung durch die behandelten IT-Unternehmen
5.2 Akquisitionen, Eigenentwicklungen und direkte Angriffe auf die Konkurrenz
5.3 Nutzung von Schwachstellen in Steuersystemen
6 Erfolgreiche IT-Unternehmen in einem protektionistischen Umfeld am Beispiel Chinas
7 Fazit
Literaturverzeichnis
Anlagen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Instrumente protektionistischer Handelspolitik
Abbildung 2 "Ringe der Macht" in der Internet Ökonomie
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Mögliche Auswirkungen tarifärer Handelshemmnisse
Tabelle 2 Mögliche Auswirkungen nicht-tarifärer Handelshemmnisse
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Die unterschiedlichen Welten Donald Trumps und des Silicon Valley
Ein gewöhnlicher Tag in irgendeiner Stadt irgendwo auf dem Planeten: Menschen arbeiten mit Hilfe von Microsoft Software, chatten mit ihrem Apple Smartphone mit Freunden über Facebook oder dem zum gleichen Konzern gehörigen WhatsApp, und kauften sich ihr iPhone möglicherweise über Amazon nachdem sie sich mit Hilfe der Google Suche darüber informiert haben. So oder so ähnlich spielt sich der Alltag von Milliarden von Menschen jeden Tag ab. Dieses Beispiel zeigt welchen Anteil die größten IT-Unternehmen des Silicon Valley mittlerweile am Alltag des 21. Jahrhunderts haben. Alle hier behandelten IT-Riesen haben entweder ihren Hauptsitz an einem bestimmten Ort, oder profitieren zumindest von dessen Innovationsgeist: dem Silicon Valley. Das in der Nähe von San Francisco gelegene Tal gilt wie wohl kein anderer Ort auf der Welt als Schmiede für innovative Ideen, freies Denken und das Zusammenspiel verschiedenster genialer Visionäre. Es ist dabei vollkommen belanglos aus welchem Teil der Welt diese kommen, welcher Religion sie angehören oder welche Hautfarbe sie haben.
Am 19. Januar 2017 wurde in Washington D.C. mit Donald Trump allerdings ein Mann als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt, dessen Habitus mit der weltoffenen Einstellung des Silicon Valley vordergründig eher wenig gemein hat. Das bewies er unter anderem bei seiner Antrittsrede als er verlauten ließ:
“We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. Protection will lead to great prosperity and strength.”[1]
Die Wahl Donald Trumps zum mächtigsten Mann der Welt spiegelt dabei jedoch nur einen Trend wider, der auch in anderen westlichen Demokratien sichtbar ist: starke protektionistische Tendenzen und der Wille zur Abschottung hervorgerufen durch die Furcht davor, dass das eigene Land durch ausländische Akteure geschädigt wird.
Diese Bachelorarbeit hat mehrere Ziele. Zum einen soll der Leser ein Verständnis dafür erhalten, was Protektionismus ist und welche Chancen und Risiken er mit sich bringen kann. Außerdem soll die Thesis zeigen, dass nicht nur Staaten protektionistisch handeln, sondern auch die hier behandelten Unternehmen. Des Weiteren soll am Beispiel Chinas aufgezeigt werden, welche Auswirkungen protektionistische Politik auf große, einheimische IT-Konzerne haben kann. Die wichtigste Aufgabe dieser Bachelor Thesis besteht jedoch darin, einen Blick auf mögliche Auswirkungen der Abschottung auf Alphabet/Google, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft zu werfen.
Deshalb wurden neben den -möglichen- Auswirkungen des bereits von Trump verabschiedeten „Travel Ban“ vor allem die beiden Instrumente, die mit Importbeschränkungen einhergehen, namentlich tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse näher betrachtet. Deren Auswirkungen wurden auf die genannten Unternehmen übertragen. Nachdem die Konzerne allerdings in sehr vielen Feldern des IT-Marktes aktiv sind, wurden ihre Aktivitäten noch in Marktsegmente unterteilt. Anschließend wurden mögliche Auswirkungen protektionistischer Tendenzen auf eben jene Segmente herausgearbeitet.
Nachdem der US-Präsident bisher jedoch noch keine die Wirtschaft direkt betreffenden protektionistischen Maßnahmen getroffen hat, und vollkommen ungewiss ist ob, wie und in welchem Ausmaß er die Wirtschaft tatsächlich zu schützen gedenkt, werden hier, wie der Titel bereits schließen lässt, -mögliche- Auswirkungen behandelt, falls Trump Handelshemmnisse einführen beziehungsweise diese verstärken sollte.
2 Vorstellung der behandelten Unternehmen
Der Grund für die Auswahl von Alphabet beziehungsweise Google, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft als Untersuchungsgegenstände dieser Arbeit ist, dass sie laut der Fortune Global 500 List zu den umsatzstärksten IT-Konzernen der Welt gehören und alle ihren Hauptsitz oder zumindest Entwicklungszentren im Silicon Valley haben.[2]
2.1 Alphabet
Die Geschichte des heute zweitwertvollsten Konzerns der Welt beginnt im Jahr 1998 in Menlo Park, Kalifornien, als die beiden Stanford Studenten Sergey Brin und Larry Page ihr Unternehmen „Google“ gründen.[3] [4] Sie entwerfen, mit Hilfe eines in ihrer Doktorarbeit entwickelten Algorithmus, eine neuartige Suchmaschine. Diese erfasst sämtliche Webseiten und schlägt dem Nutzer als erstes die Seiten vor, welche am häufigsten auf anderen Webseiten verlinkt wurden.[5] Heute ist Google die mit Abstand meistgenutzte Suchmaschine der Welt mit knapp 87 % Marktanteil. Der frühere Branchenprimus Yahoo liegt mit vier Prozent nur auf Platz 3, noch hinter der Suche von Microsoft, Bing genannt, mit fünf Prozent weltweitem Marktanteil (Stand August 2017).[6] Jedoch bietet Google weit mehr als nur eine Suchmaschine. Mittlerweile zählen unter anderem ein eigener Browser, Google Chrome, ein eigener Kartendienst, Google Maps, der meist genutzte E-Mail Dienst der Welt, Gmail, mit Android das meistgenutzte Smartphone Betriebssystem des Planeten, sowie das Videoportal YouTube zum Portfolio.[7] [8] Außerdem forscht Google in anderen Abteilungen an sogenannten „Moonshots“, IT-fernen Projekten wie beispielsweise einer Kontaktlinse die den Blutzuckerspiegel messen kann.[9]
2015 wurde die Organisation Googles umstrukturiert. Es wurde eine Tochtergesellschaft der neu gegründeten Alphabet Holding.[10]
2.2 Amazon
Der heute größte Onlinehändler der Welt wurde 1994 von Jeff Bezos in Seattle, Washington gegründet. Zu Beginn beschränkte sich Bezos darauf, nur Bücher online zu verkaufen. Mittlerweile ist das Unternehmen nicht nur Marktführer im Online-Buchhandel, sondern auch in weiten Teilen anderer Bereiche des Online-Handels in vielen Teilen der Welt geworden.[11] Der IT-Konzern handelt dabei aber nicht nur als Zwischenhändler oder Verkaufsplattform, sondern bietet auch eigene Produkte an. So finden sich im Sortiment des Online-Riesen unter anderem ein E-Book Reader (Kindle), ein Tablet-PC (Kindle Fire) und ein eigener Smart-Home Speaker (Echo). Außerdem verkauft Amazon unter seinem Label „Amazon Basics“ Produkte aus Kategorien verschiedenster Art von Smartphone-Zubehör über Bad-Utensilien bis hin zu Reisezubehör.[12] Allerdings bietet Amazon nicht nur physische Produkte zum Kauf an. Die Mitglieder des Stammkundenprogramms Amazon Prime können gegen eine jährliche Gebühr unter anderem den Videostreamingdienst Prime Video und den Musiksharingdienst Prime Music nutzen.[13] Zu guter Letzt ist Amazon mit seiner Sparte „Amazon Web Services“ der größte Anbieter von Cloud-Dienstleistungen weltweit. 2016 betrug der Marktanteil laut einer Gartner Studie gut 44 %.[14] [15]
2.3 Apple
Das heute wertvollste Unternehmen der Welt wurde im April 1976 von Steve Jobs und Steve Wozniak gegründet.[16] Der erste Coup Apples war der Apple II Computer.[17] Nach einer Krise bei Apple musste Jobs den Konzern verlassen, wurde aber 1997 wieder zum CEO ernannt und führte ihn mit der Vorstellung des ersten iMac zurück auf Erfolgskurs.[18] In den Folgejahren stellte Apple unter anderem die sehr erfolgreichen Produkte iPod, iPhone und iPad vor und profitierte durch geschickte Provisionsverträge von dem Verkauf von Onlinemedien im iTunes-, Appstore sowie in iBooks.[19] [20] [21] [22]
2.4 Facebook
Das heute größte soziale Netzwerk der Welt wurde 2004 von Mark Zuckerberg gegründet. Facebook war zwar nicht das erste Netzwerk seiner Art, es war jedoch das erste soziale Netzwerk welches global erfolgreich wurde.[23] Heute hat alleine Facebook monatlich mehr als zwei Milliarden monatliche Nutzer.[24] Der Konzern besteht allerdings heutzutage nicht mehr nur aus dem eigentlichen sozialen Netzwerk Facebook, sondern akquirierte unter anderem auch den Instant Messaging Dienst WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar und das auf Bildern und Videos basierende Netzwerk Instagram für eine Milliarde US-Dollar.[25] [26]
2.5 Microsoft
Das Unternehmen, das heute mit Windows das meistgenutzte Betriebssystem der Welt vertreibt, wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen in Albuquerque, New Mexico gegründet.[27] [28] Nach einer Vereinbarung mit dem damals größten Hersteller von PCs, IBM, lieferte dieser seine PCs mit dem damaligen Microsoft Betriebssystem MS-DOS aus.[29] Vier Jahre später erschien die erste Version des bis heute von vielen Personen genutzten Betriebssystems „Microsoft Windows“. 1989 veröffentlicht Microsoft das Textverarbeitungsprogramm Microsoft Office. Unter anderem durch diese Produkte war Microsoft das erste IT-Unternehmen, welches einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar erzielen konnte.[30] Mittlerweile ist es nicht mehr nur im Bereich der Software aktiv. Es produziert unter anderem eigene PCs, die Surface-Reihe, hat mit der „Xbox“ eine eigene Spielkonsole auf dem Markt, ist durch die 8,5 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von Skype in der Videotelefonie tätig und erschloss sich zuletzt durch die 26 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von LinkedIn sowohl den Markt für soziale Netzwerke als auch für E-Learning.[31] [32]
3 Protektionismus allgemein
Protektionismus ist ein ökonomischer Grundsatz mit dem Ziel, die einheimischen Märkte und Unternehmen vor ausländischen Kräften, wie Unternehmen oder Produkten, zu schützen. Dies kann unter anderem durch „Tarifäre Handelshemmnisse“ wie Zölle, oder durch „Nicht-tarifäre Handelshemmnisse“ wie Importquoten verwirklicht werden.[33] Auf die beiden Formen der Handelshemmnisse wird in Kapitel 4 noch näher eingegangen.
Protektionismus kann somit als Gegenentwurf zum freien Außenhandel gesehen werden. Letzterer führt zwar, laut Meinung der meisten Ökonomen, zu mehr Wohlstand in einer Gesellschaft.[34] Es gibt aber durchaus nachvollziehbare Gründe, warum Länder protektionistische Politik exerzieren.
Einer der Gründe warum Protektionismus bei manchen Bevölkerungsschichten Anklang findet ist, dass der Freihandel zwar den Wohlstand einer Nation erhöht, jenes jedoch mit Einkommensverteilungen zu Lasten dieses Bevölkerungsteils einhergeht. Oder umgangssprachlich formuliert, der höhere Wohlstand kommt bei diesen Schichten nicht an. Zwar entstehen durch den Freihandel absolut gesehen mehr neue Arbeitsplätze, allerdings kommt es in Industrien, die ihre Preise auf Grund der internationalen Konkurrenz senken müssen, zu Einkommenseinbußen. Als Beispiel kann hierfür die Kleidungsfertigung dienen.[35] Die Einbußen können dazu führen, dass die Betriebe Kosten einsparen und damit Mitarbeiter entlassen müssen, welche dann unter Umständen keine neue Anstellung mehr finden oder lange arbeitslos sind. In einem reichen Industriestaat wie den USA sind hiervon vor allem Arbeiter mit einem niedrigen Bildungsniveau betroffen.[36]
Weitere Gründe für eine protektionistische Politik sind der Schutz junger, international noch nicht konkurrenzfähiger Industriezweige, welche mit Hilfe von sogenannten Erziehungszöllen geschützt werden. Zudem der Schutz etablierter Wirtschaftszweige, deren Protektion durch Schutzzölle gewährleistet werden soll, sowie die Verhinderung von Dumping Preisen ausländischer Hersteller, was durch die Verhängung von Anti-Dumping Zöllen stattfindet. Auf die genannten Zollarten wird in Kapitel 4.1 noch näher eingegangen.
Die WTO möchte jedoch sämtliche Handelsbarrieren zwischen Staaten abbauen und damit den Freihandel fördern.[37] Die Organisation, deren mittlerweile 164 Mitglieder gut 98 % des weltweiten Handelsvolumen auf sich vereinen, erlaubt momentan tarifäre Handelshemmnisse in einem gewissen Rahmen, sie sollten allerdings stetig minimiert werden.[38] [39] Jedes Land hat in Zusammenarbeit mit der WTO branchenspezifische, prozentuale Zollhöhen verhandelt, welche nicht überschritten werden dürfen.[40] Außerdem duldet die Organisation bei entsprechender Begründung die Einführung der bereits erwähnten Anti-Dumping Zölle, ist aber sowohl gegen eine Exportförderung der Länder als auch gegen die Einführung nicht-tarifärer Handelshemmnisse.[41] Das ist deshalb der Fall, da diese verglichen mit tarifären Handelshemmnissen schwerer zu kontrollieren und Verstöße komplizierter zu ahnden sind.[42] Die Ahndung von Verstößen, also die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der WTO, ist das vielleicht mächtigste Werkzeug der Organisation. Wenn ein Land von einem anderen des Verstoßes gegen Handelsregeln bezichtigt und für schuldig befunden wird, hat dies Folgen. Der schuldige Staat muss danach die beanstandete Praxis einstellen oder das klagende Land entschädigen. Dem geschädigten Land ist es außerdem gestattet, Vergeltungsmaßnahmen vorzunehmen, wenn dem Urteilsspruch nicht nachgekommen wird.[43] Der Organisation mit Hauptsitz in der Schweiz könnte jedoch Ungemach drohen. Die Regierung von US-Präsidenten Trump hat bereits angekündigt, die Regeln der WTO in Zukunft nicht mehr als bindend ansehen zu wollen, falls sie der Meinung ist, dass sie die Souveränität der USA gefährden.[44]
Populär ist protektionistische Politik vor allem bei Staatenlenkern, da sie zu einer Ankurbelung der Nachfrage nach einheimischen Produkten führt und dadurch voraussichtlich neue Arbeitsplätze in der heimischen Volkswirtschaft entstehen beziehungsweise weniger Jobs abgebaut werden müssen.[45] [46] Allerdings ist ein solcher Zustand nur von kurzfristiger Natur, da sich langfristig ein Wohlstandsverlust einstellt. Dieser entsteht durch eine langfristige Erhöhung der Preise. Zum einen werden die Herstellungskosten für die Güter teurer, deren Produktionsstoffe zumindest teilweise aus dem Ausland bezogen werden. Durch protektionistische Maßnahmen wie beispielsweise Zölle verteuern sich die Stoffe und den heimischen Herstellern entstehen höhere Selbstkosten, da sie die Rohstoffe trotz des gestiegenen Preises kaufen müssen. Diese Kosten werden sie auf den Verbraucher umlegen. Zum anderen steigen die Preise dadurch, dass durch die Einschränkung von importierten Gütern weniger Waren zur Verfügung stehen, die Nachfrage jedoch auf dem gleichen Niveau bleibt. Da jene Preiserhöhungen aber schleichend vonstattengehen, bemerkt die Bevölkerung meist nicht, dass sie durch die protektionistische Politik ihrer Regierung verursacht werden. Das Gegenteil ist der Fall: die nach dem kurzzeitigen Hoch auf dem Arbeitsmarkt eintretende Flaute führt zu Forderungen nach noch stärkeren protektionistischen Maßnahmen. Wird dies verwirklicht entzieht sich das Land noch stärker der internationalen Arbeitsteilung und verarmt allmählich. Ein extremes Beispiel für die massiven Nachteile des Protektionismus ist Nordkorea.
Ein konkretes Beispiel für die versteckten Mehrkosten des Protektionismus bot sich in den USA. Dort stand zu befürchten, dass viele Arbeitnehmer auf Grund der ausländischen Konkurrenz in der Automobilindustrie ihre Jobs verlieren würden. Ein Weg die Jobs zu retten, wären Subventionen der Regierung für einheimische Automobilkonzerne gewesen. Die Führung in Washington entschied sich jedoch für einen anderen Weg und verhängte Einfuhrkontingente für ausländische Automobile. Die Kosten dafür waren allerdings höher als die möglichen Aufwendungen für Subventionen. Das war deshalb der Fall, da eine Wettbewerbsverzerrung stattfand und die amerikanischen Konsumenten auf Grund des geringeren Angebots mehr für ein Automobil zahlen mussten. Der Grund, warum die Regierung trotzdem letzteren Weg wählte war, dass die Kosten der Importquoten für die Bevölkerung weniger offensichtlich sind.[47] Es sei aber angemerkt, dass auch Subventionen die heimischen Waren bevorzugen, und im Umkehrschluss ausländische Produkte und Unternehmen benachteiligen. Subventionen als Form der Exportförderung sind, wie bereits bemerkt, im internationalen Handelsrecht verboten. Der WTO sind bei der Ahndung solcher Praktiken jedoch oft die Hände gebunden.[48]
Eine Erhöhung der Preise im Inland ist allerdings nicht der einzige Nachteil protektionistischer Politik. Diese kann außerdem zu Vergeltungsmaßnahmen der betroffenen Exportländer führen. Sie verhängen beispielsweise selbst die in Kapitel 4.1 noch näher beschriebenen Retorsionszölle, welche auf Güter aus Ländern, die protektionistische Maßnahmen gegen sie getroffen haben, verhängt werden oder erschweren Importe aus diesen Staaten auf anderen Wegen.[49] Die Tatsache, dass Protektionismus den Wettbewerbsdruck von den einheimischen Unternehmen nimmt ist auch keineswegs nur positiv zu sehen. Durch die fehlende internationale Konkurrenz auf dem Markt müssen die einheimischen Betriebe nicht kontinuierlich Innovationen an ihren Produkten vornehmen und sie zu einer angemessenen Qualität und zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis verkaufen. Den Konsumenten bleibt, mangels Alternativen, nichts anderes übrig als die im internationalen Vergleich langfristig vermutlich schlechteren Produkte zu kaufen. Und auch für die heimischen Unternehmen ist Protektionismus auf Dauer nicht förderlich, da ihnen Märkte außerhalb der heimischen Volkswirtschaft, beispielsweise durch Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder, oft nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen zugänglich sind.[50]
Die negativen Auswirkungen protektionistischer Handelspolitik zeigten sich in den USA während der Depression in den 1930er Jahren. Der damalige US-Präsident Hoover verabschiedete das sogenannte „Smoot-Hawley-Zollgesetz“ um seine Wirtschaft vor deren Auswirkungen zu schützen. Dieses erlaubt ihm die Zölle auf sämtliche zu verzollenden Produkte auf durchschnittlich über 60 % anzuheben. Außerdem war es der amerikanischen Zollkommission gestattet die Zollsätze flexibel an die Differenz zwischen In- und Auslandspreis anzupassen. Zu guter Letzt gingen die USA in Form von Zöllen auch gegen Subventionsmaßnahmen ihrer ausländischen Handelspartner vor. Diese reagierten mit Vergeltungsmaßnahmen. Sie verhängten Handelsrestriktionen und werteten teilweise ihre eigenen Währungen ab um ihre Exporte wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Infolge dessen sanken die US-amerikanischen Exporte innerhalb von vier Jahren von 5,2 auf 1,6 Milliarden US-Dollar, der Anteil der USA an den Weltexporten sank von 16 auf elf Prozent und der Handelsumfang weltweit ging in dieser Zeit sogar um 40 Prozent zurück.[51] Letzteres zeigt, dass die Vision des sogenannten „Optimalzolls“ eine trügerische ist. In der Theorie können Länder vom Protektionismus profitieren, wenn sie eine so große Wirtschaftsmacht besitzen, dass sie die weltweiten Preisverhältnisse durch Zölle zu ihren Gunsten ändern können. Dadurch würden solche Länder profitieren, während andere darunter leiden würden.[52] Die von den Zöllen geschädigten Länder würden dann jedoch, wie im obigen Beispiel, zu Gegenmaßnahmen greifen. Dies würde die Vorteile des Zolls zunichtemachen, vor allem wenn sich wirtschaftlich ebenso starke Nationen wehren.[53]
4 Auswirkungen protektionistischer Maßnahmen
Charakteristisch für den bereits in Kapitel 3 beschriebenen Protektionismus sind verschiedene Instrumente, um die eigene Wirtschaft vor ausländischen Konkurrenten zu schützen. Die Instrumente sind in zwei Kategorien, Exportförderung und Importbeschränkungen, unterteilbar, wie auch Abbildung 1 verdeutlicht. Exportfördernde Maßnahmen betreffen beispielsweise Subventionen für einheimische Unternehmen, die ins Ausland exportieren. Nachdem sich diese Arbeit jedoch besonders mit Unternehmen des in den USA befindlichen Silicon Valley beschäftigt und der derzeitige Präsident Donald Trump bereits Abstand von exportfördernden Maßnahmen genommen hat, werden sie hier nicht näher behandelt.[54] Die hingegen von Präsident Trump bereits ins Gespräch gebrachten Importbeschränkungen lassen sich wiederum in zwei Unterkategorien einteilen, nicht-tarifäre Handelshemmnisse und tarifäre Handelshemmnisse.[55] [56] Auf die Feinheiten dieser beiden Unterkategorien wird in den beiden nachfolgenden Unterkapiteln eingegangen, deren Zweck oder Schaden für die Volkswirtschaft eines Landes wurde allerdings bereits in Kapitel 3 diskutiert. Der US-Präsident führte jedoch ebenfalls Maßnahmen, die nicht in das Schema der tarifären beziehungsweise nicht-tarifären Handelshemmnisse passen, durch. Darunter unter anderem der Einreisebann für Muslime aus bestimmten Ländern. Die Auswirkungen socher Maßnahme auf die größten IT-Konzerne des Silicon Valley werden in diesem Kapitel ebenfalls behandelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 Instrumente protektionistischer Handelspolitik[57]
Um die Auswirkungen protektionistischer Politik auf die IT-Riesen genauer und übersichtlicher darzustellen, wurden die Unternehmen nach Tätigkeitsfeldern in verschiedene Marktsegmente aufgeteilt. Es sei dabei angemerkt, dass alle behandelten IT-Konzerne, mit Ausnahme von Facebook, in mehreren Marktsegmenten aktiv sind und daher von protektionistischen Maßnahmen in mehrerer Hinsicht betroffen sein können. Ein Marktsegment ist ein Teilmarkt, in dem die Anbieter im Wettbewerb um eine bestimmte Kundengruppe in Konkurrenz zueinander treten. Die Kundengruppen dieser Teilmärkte sind homogener als die des Gesamtmarktes.[58]
Die fünf Unternehmen wurden in insgesamt sechs Marktsegmente unterteilt. Das Erste der Marktsegmente sind die „digitalen Handelswaren“. Dort werden die Auswirkungen protektionistischen Handels auf die behandelten IT-Riesen zusammengefasst, die digitale Handelswaren wie Filme, Musik oder E-Books verkaufen und/oder in Form von Streaming anderweitig zur Verfügung stellen. Zu dieser Gruppe gehören Alphabet beziehungsweise Google, Amazon sowie Apple. Zu dem Marktsegment „Hardware“ zählen Google, Amazon, Apple und Microsoft, da sie in Eigenregie Hardware, wie beispielsweise Computer oder Smartphones entwickeln und selbst herstellen respektive herstellen lassen. In dem Segment „Online-Handel“ ist nur Amazon zu finden, da es das Einzige der fünf behandelten Unternehmen ist, welches in jenem Markt aktiv ist. Ein weiterer Teilmarkt in dem manche der IT-Unternehmen tätig sind, sind die „Social Networks“. Einer der Konzerne ist nachvollziehbarerweise Facebook, welches neben dem nach Nutzerzahlen größten sozialen Netzwerk „Facebook“ mit Instagram und WhatsApp auch zwei weitere Größen im Bereich des Social Networks sein Eigen nennen kann.[59] Nachdem auch Google mit Google Plus und Microsoft mit LinkedIn soziale Netzwerke betreiben, wurden sie ebenfalls diesem Segment zugeordnet. Google und Microsoft finden sich, neben Apple, auch in dem Marktsegment „Software“ wieder. Da ein protektionistischer Politikstil auf Bezahlsoftware jedoch andere Auswirkungen hat als auf Gratissoftware, wird eine Unterscheidung zwischen den beiden vorgenommen. Bei Bezahlsoftware ist vor allem Microsoft mit seinen zahlreichen gegen Entgelt erwerbbaren Softwarelösungen betroffen, während Apple und Google vor allem Gratissoftware direkt anbieten. Das letzte der Marktsegmente „Suchmaschinen“, beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit den Auswirkungen auf Unternehmen die Suchmaschinen betreiben. Dazu zählt natürlich neben dem Betreiber der größten Suchmaschine der Welt Google, auch Microsoft welche mit Bing ebenfalls eine Suchmaschine betreibt. Eine Übersicht über die jeweiligen Auswirkungen von tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnissen befindet sich unter den jeweiligen Unterkapiteln.
4.1 Tarifäre Handelshemmnisse
Unter tarifären Handelshemmnissen versteht man alle Formen von Zöllen. Sie sollen sowohl die heimische Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz schützen als auch als Einnahmequelle der Länder dienen. Sie schützen einheimische Produzenten dadurch, indem sie Unternehmen, die Waren importieren möchten, dazu zwingen eine Zwangsabgabe zu leisten und so deren Waren entweder verteuern oder, bei sehr hohen Zollsätzen, ganz vom Markt ausschließen.[60] Die Zollerlöse fließen dem Staat zu. Die Popularität dieser Art von Handelshemmnissen lässt jedoch stetig nach, da Länder heutzutage verstärkt auf nicht-tarifäre Handelshemmnisse zum Schutz ihrer Wirtschaft setzen.[61]
Die Einführung von Zöllen kann verschiedene Gründe haben. Einer der Gründe kann beispielsweise der Schutz etablierter Wirtschaftszweige vor ausländischer Konkurrenz sein, die ihre Waren günstiger anbieten können als heimische Betriebe und so einen Wettbewerbsvorteil genießen. Der damit im Umkehrschluss einhergehende Wettbewerbsnachteil für heimische Firmen soll durch eine künstliche Preiserhöhung für Importeure in Form eines sogenannten „Schutzzolls“ ausgeglichen werden.[62] Eine andere Zollart, die ebenfalls unter anderem alteingesessene Unternehmen schützen soll, ist der sogenannte Anti-Dumping oder Ausgleichszoll. Dieser kann verhängt werden, wenn ausländische Produzenten ihre Produkte im Exportland zu Kosten unterhalb der Herstellungskosten vertreiben um dort Vorteile gegenüber lokalen Produzenten zu erhalten. Die Verluste, die den Exporteuren dadurch entstehen, werden durch höhere Gewinnmargen auf deren Heimatmarkt kompensiert. Um einen solchen Nachteil für die heimische Wirtschaft auszugleichen, dürfen die betroffenen Länder Anti-Dumping Maßnahmen, in Form von Anti-Dumping Zöllen, ergreifen. Die Höhe des Zolls berechnet sich aus der Differenz zwischen dem „unfairen“ Verkaufspreis und dem für nationale Mitbewerber „fairen“ Preis.[63] [64]
Der sogenannte „Erziehungszoll“ dient dazu, junge Industrien solange zu schützen und ihnen Vorteile gegenüber ausländischen Konkurrenten zu gewähren, bis sie genügend Know-how und Kapazitäten entwickelt haben um international konkurrenzfähig zu sein.[65] Sobald dies der Fall ist sollte der Schutz aufgehoben werden, was allerdings häufig nicht passiert.[66]
Die Zölle die als Gegenreaktion auf angeordnete Zwangsabgaben angeordnet werden, werden Retorsionszölle genannt. Sie gelten auch nicht, wie die meisten anderen Zollarten, gegenüber allen Ländern, sondern nur gegen bestimmte Länder, die Exporte in ihren Markt erschweren, wenn nicht gar verhindern wollen.[67] Eine Verhängung dieses Zolls auf amerikanische Produkte ist, falls Trump seine Ankündigungen wahr macht, durchaus im Bereich des Möglichen und würde Exporte amerikanischer Produkte aller Art erschweren.[68] Davon würden auch die Produkte der größten IT-Unternehmen des Silicon Valley nicht verschont werden.
Anders als bei digitalen Handelswaren, wo tarifäre Handelshemmnisse keine konkreten Auswirkungen auf die Unternehmen hätten, wären die IT-Konzerne, die eigens entwickelte Hardware in ihrem Portfolio haben, von solchen Maßnahmen direkt betroffen. Im Moment lassen Google, Apple, Amazon und Microsoft viele ihrer Produkte unter anderem in China fertigen.[69] [70] [71] Gründe dafür sind die, verglichen mit den USA, deutlich geringeren Arbeitskosten[72]. In China kostet eine Arbeitsstunde gut 6 €, während sie in den USA mit mehr als dem Fünffachen, nämlich 34 €, zu Buche schlägt.[73] Sollten die USA allerdings sehr hohe Einfuhrzölle verhängen, um eine Produktion im Inland zu forcieren, würden die Produkte, die auf Grund der Produktion im Ausland nach wie vor importiert würden, für amerikanische Verbraucher sehr teuer werden oder die Margen der IT-Unternehmen würden sinken. Selbst wenn nur die Komponenten aus dem Ausland stammen und die Endmontage im Inland stattfinden würde, wären die Kosten, auf Grund der Zölle für die Komponenten, höher als bisher. Falls die Zwangsabgaben so hoch sein sollten, dass eine Produktion im Ausland nicht mehr sinnvoll ist, müsste die Produktion ins Inland verlegt werden. Das hätte zwar für die Bevölkerung zumindest kurzfristig den Vorteil, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die Kosten die den Unternehmen entstehen, wären aber deutlich höher. Angenommen die behandelten IT-Riesen würden weiterhin auf das altgediente System setzen und die Fertigung der Komponenten würde wie bisher zu großen Teilen bei Zulieferern stattfinden, so müssten die bisherigen Zulieferbetriebe erst eigene Produktionsstandorte in den USA errichten. Dies wäre zeit- und kostenintensiv. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass sich die Konzerne von amerikanischen Unternehmen beliefern lassen. Das Problem hierbei ist jedoch, dass die meisten amerikanischen Zulieferer ihre Werke nach Asien outgesourct haben und somit nicht mehr in den USA produzieren.[74] Außerdem wären die Arbeitskosten, wie bereits beschrieben, deutlich höher. Bei den Herstellungskosten könnten zudem höhere Einkaufskosten zu Buche schlagen, wenn amerikanische Rohstoffe, verglichen mit den vorher verwendeten, teurer wären oder der Import von Rohmaterialien auf Grund von höheren Transportkosten und Zöllen kostenintensiver würden. Die USA drohten unter anderem schon damit Strafzölle auf chinesisches Aluminium zu verhängen.[75] Dass die behandelten IT-Riesen ihre Produkte komplett in Eigenregie produzieren, wäre nahezu unvorstellbar, da auch sie die gleichen Kosten wie ihre dann in den USA produzierenden Zulieferer hätten und zusätzlich noch das Know-how entwickeln müssten um ihre Komponenten bei mindestens gleicher Qualität selbst zu produzieren. Des Weiteren könnten protektionistische Maßnahmen zu Gegenreaktionen der betroffenen Länder führen. Sollten diese die Maßnahmen beispielsweise eins-zu-eins auf Artikel aus den USA anwenden, wäre es für amerikanische Unternehmen schwieriger ihre Produkte in den durch Zölle geschützten Ländern zu veräußern.
All die unterschiedlichen Auswirkungen hätten jedoch die gleichen Konsequenzen. Die Kosten der Produkte für die behandelten IT-Riesen würden steigen, wodurch, bei gleichbleibenden Verkaufspreisen, die Marge sinken oder, bei einer Beibehaltung des Gewinnanteils und damit steigenden Endpreisen, die Nachfrage und damit auch der Marktanteil sinken würden. Der verlorene Marktanteil würde wiederum von Konkurrenten eingenommen werden.
Die hohen Einfuhrzölle hätten allerdings auch Vorteile für die amerikanischen Unternehmen, denn es würden sich nicht nur ihre Preise erhöhen, sondern auch die der ausländischen Konkurrenten die in die USA exportieren möchten. Wie bereits bei den Gegenmaßnahmen der betroffenen Länder beschrieben, hätten die in die USA exportierenden Unternehmen dadurch entweder geringere Margen, oder sie müssten die zu zahlenden Zölle auf die Produktpreise aufschlagen, was wiederum zu höheren Preisen für die Kunden, und somit zu geringeren Absatzzahlen und geringeren Marktanteilen führen würde. Diese Marktanteile könnten wiederum heimische Betriebe für sich erobern, wenn sie ihre Produkte zu niedrigeren Preisen als die ausländische Konkurrenz anbieten könnten.
Ein weiteres Marktsegment in dem eines der behandelten Unternehmen aktiv ist, ist der Online-Handel. Wie bereits bei Hardware, wäre Amazon auch hier von einer Einführung beziehungsweise Erhöhung von Zöllen betroffen. Amazons Geschäftsmodell besteht zu Teilen darin, Produkte einzukaufen und mit Gewinn zu veräußern.[76] Produkte die Amazon importiert, würden sich durch die Zölle verteuern. Wie bereits in dem Segment Hardware, hätte das zur Folge, dass Amazon beim Weiterverkauf dieser Produkte entweder auf Marge verzichten oder die Preise erhöhen müsste. Außerdem würden sich auch die Produkte verteuern, die Amazon unter seinem eigenen Label „Amazon Basics“ verkauft, falls sie von ausländischen Zulieferern hergestellt und in die USA importiert würden. Von stärkeren tarifären Handelshemmnissen wäre jedoch nicht nur Amazon betroffen, sondern auch die Unternehmen, die Amazon als Handelsplattform nutzen, um ihre Produkte an Verbraucher zu veräußern. Wenn die Verkäufer aus dem Ausland agieren, wären Zölle für sie ein Hemmnis ihre Ware zu verkaufen. Auch ihre Preise würden sich erhöhen und sie könnten in Erwägung ziehen ihre Geschäfte und damit ihre Importe in die USA einzuschränken, wenn nicht gar komplett aufzugeben. Für Amazon hätte dies die Folgen, dass es durch weniger Händler stärker an Attraktivität bei den Kunden verliert und weniger Einnahmen durch Provisionen erhält. Die Verkäufer führen einen Teil ihres Verkaufserlöses als Provision an Amazon ab.[77] Auch Vergeltungsmaßnahmen anderer Staaten könnten negativen Einfluss auf Amazon haben. Sollte es beispielsweise Produkte aus den USA in Länder exportieren, die Vergeltungsmaßnahmen getroffen haben, würden sich auch dort die Kosten der Produkte erhöhen, was wiederum zu geringeren Margen oder höheren Preisen führen würde, wodurch Marktanteile verloren gingen. Amazon könnte das allerdings unter Umständen umgehen, wenn es in diesen Ländern eigene Niederlassungen hat respektive diese aus anderen Ländern als den USA beliefert und so nichts oder nur wenig aus den USA versenden beziehungsweise importieren muss.
Auch in diesem Marktsegment hätten tarifäre Handelshemmnisse nicht nur Nachteile für amerikanische Unternehmen. Wie die ausländischen Marktakteure die Produkte über Amazon verkaufen, müssten auch E-Commerce-Händler die unabhängig von dem Internetriesen agieren die auf Grund der Zölle steigenden Kosten handhaben. Auch sie würden, im Umkehrschluss zu den Vergeltungsmaßnahmen, die Amazon treffen könnten, Marktanteile in den USA verlieren, welche Amazon möglicherweise einnehmen könnte.
Drei andere Marktsegmente, in denen Amazon aber nicht präsent ist, sind Soziale Netzwerke, Software sowie Suchmaschinen. Mit Ausnahme der Bezahlsoftware haben tarifäre Handelshemmnisse keine direkten Auswirkungen auf diese Segmente. Sie könnten jedoch durch indirekte Auswirkungen von Handelshemmnissen beeinflusst werden. Zum einen könnten sich die betroffenen Länder dazu entschließen, die noch näher in Kapitel 5.3 behandelten Steuerpraktiken der IT-Riesen zu untersuchen, was den Ländern unter Umständen zu höheren Steuereinnahmen gereichen beziehungsweise. bei den IT-Unternehmen höhere Kosten verursachen würde. Zum anderen könnte es zum Verlust von Nutzerzahlen kommen, da Nutzer, auf Grund der US-amerikanischen Politik, möglicherweise Abstand von amerikanischen Diensten nehmen. Dieses wird allerdings in Kapitel 4.3 noch näher erläutert.
Die Unternehmen könnten aber auch indirekt durch die Konsequenzen für andere Marktsegmente Schaden nehmen. So wäre unter anderem Google auch indirekt davon betroffen, wenn die Absatzzahlen von Hardwareprodukten wie Smartphones oder Tablets durch Handelshemmnisse rückläufig wären. Googles Betriebssystem Android, welches auf Smartphones und Tablet-PCs installiert werden kann, ist zwar laut eigener Aussage für jeden Hersteller kostenlos verfügbar, Google erzielt aber dennoch mit dem Betriebssystem Einnahmen.[78] So müssen Hersteller, falls sie die sogenannten Google Mobile Services, also Google Mail, Google Maps und den App Store Google Play in Android anbieten wollen, ein Zertifikat von Google erwerben. Die Kosten für diese Zertifikate variieren je nach Anzahl der vom Hersteller mit Android ausgestatteten Geräte.[79] Wenn nun also weniger Geräte verkauft werden würden, die mit Android ausgestattet sind, hätte das nicht nur Auswirkungen auf die betroffenen Hardwarehersteller, sondern auch auf Google selbst, da es dadurch zum einen weniger mit dem Verkauf von Zertifikaten verdienen würde, zum anderen aber auch geringere Erlöse beispielsweise durch Verkäufe im Play Store generieren könnte. Letzteres würde auch auf Apple mit seinem Betriebssystem iOS zutreffen. Aktuell wird Android unter anderem vom koreanischen Hersteller Samsung verwendet, welcher Marktführer im Bereich der Smartphones ist.[80] [81]
Von den rückläufigen Verkaufszahlen wären jedoch nicht nur Hersteller von Gratissoftware indirekt betroffen, sondern auch die, die ihre Software gegen Lizenzentgelt an Hardwarehersteller veräußern. Unter den behandelten Unternehmen ist hier vor allem Microsoft zu nennen, dessen Betriebssystem Windows mit seinen verschiedenen Variationen weltweit das am meisten verwendete ist.[82] Microsoft produziert allerdings selbst, mit Ausnahme der Surface Reihe, keine eigenen PCs, sondern wendet das OEM Modell an.[83] Bei diesem Modell darf ein Hersteller das Produkt eines Zulieferers, in dem Fall das Produkt Windows von Microsoft, in sein Erzeugnis integrieren und zahlt dafür dem Zulieferer eine Lizenzgebühr.[84] Wenn also bei den kooperierenden PC-Herstellern die Verkaufszahlen rückläufig sind, wird auch hier der Softwareentwickler Auswirkungen in Form einer rückläufigen Nachfrage der Softwarelizenzen zu spüren bekommen und somit weniger Lizenzgebühr erhalten. Verglichen mit den Anbietern von Gratissoftware könnte bei Anbietern von Bezahlsoftware jedoch noch eine weitere negative Auswirkung protektionistischen Handelns eintreten. Bei Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder würde sich die Software im Ausland verteuern. Die Hersteller könnten dann entweder auf Marge verzichten um ihren Verkaufspreis beizubehalten oder die Zölle auf die Verbraucher umlegen. In diesem Fall könnten die amerikanischen Hersteller Umsatzeinbrüche und damit Verluste von Marktanteilen erleiden. Außerdem muss bedacht werden, dass Anwender ab einem bestimmten Preis lieber auf Gratissoftware zurückgreifen könnten.
Die Hersteller von Bezahlsoftware, im Fall der behandelten IT-Riesen vor allem Microsoft, hätten aber auch Vorteile durch tarifäre Handelshemmnisse. Diese bestünden darin, dass sich durch die Zölle die anfallenden Kosten für ausländische Entwickler erhöhen würden wodurch sie entweder, wie bereits bei den Hardwareherstellern, geringere Margen hätten oder ihre Preise erhöhen müssten. Dadurch würden, wie schon des Öfteren bemerkt, Marktanteile verloren gehen. Sollten sich ausländische Hersteller vollkommen aus dem US-amerikanischen Markt zurückziehen, wäre damit weniger Konkurrenz vorherrschend und die Preise könnten erhöht werden. Bei Preiserhöhungen könnten Nutzer ab einem gewissen Preis jedoch auf unter Umständen qualitativ schlechtere, dafür aber kostenlos erhältliche Software zurückgreifen.
Tabelle 1 Mögliche Auswirkungen tarifärer Handelshemmnisse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.2 Nicht-tarifäre Handelshemmnisse
Unter nicht-tarifären Handelshemmnissen versteht man alle Maßnahmen die ein Staat ergreift um seine Wirtschaft zu schützen, ausgenommen aller Arten von Zöllen. Laut der WTO gibt es über 800 solcher Hemmnisse. In diesen enthalten sind unter anderem Importquoten. Sie verringern die maximal importierbare Menge eines Gutes aus anderen Volkswirtschaften und verringern so den Konkurrenzdruck auf heimische Unternehmen.[85] Außerdem zählt die länderspezifische Wahl von Normen und Formvorschriften zu diesen Handelshemmnissen. Das Hemmnis entsteht dadurch, dass jene Normen und Formvorschriften vorerst nur heimische Hersteller erfüllen können und ausländische Hersteller ihre Produkte erst für den Export anpassen müssen. Somit entstehen den ausländischen Herstellern Mehrkosten und der Export in den geschützten Markt wird sowohl erschwert als auch verzögert.[86] Des Weiteren zählen unter anderem auch Selbstbeschränkungsabkommen zu nicht-tarifären Handelshemmnissen. Bei diesen verpflichten sich ausländische Hersteller nur eine gewisse Menge eines bestimmten Gutes in den jeweiligen Markt zu exportieren. In der Regel kommt ein solches Abkommen jedoch auf Druck des Importlandes zustande, welches andernfalls die bereits beschriebenen Importquoten einführen würde. Eine solche Vereinbarung verstößt allerdings in der Regel gegen die Ethikstandards der WTO, da sie oft nur mit einem Land geschlossen wird und nur diesem gestattet wird, den Warentyp zu importieren. Drittländer bleiben außen vor.[87]
Wie auch bei den tarifären Handelshemmnissen gibt es bei der Einführung nicht-tarifärer Handelshemmnisse keine direkten Auswirkungen auf digitale Handelswaren. Bei dem Marktsegment Hardware würden die betroffenen Unternehmen aber Konsequenzen spüren. Eine mögliche Auswirkung wäre, falls die Produktion im Inland stattfindet oder dank Handelshemmnissen stattfinden muss, dass die Produktionsmenge heruntergefahren werden muss, weil es nicht mehr möglich ist die benötigten Rohstoffe oder Bauteile in der benötigten Menge und zur geplanten Zeit durch den Zoll ins Land zu importieren. Das würde nicht nur die IT-Riesen betreffen, sondern auch deren Zulieferer falls diese beziehungsweise deren Heimatländer mit solchen Hemmnissen bedacht wären. In anderen Branchen könnte man in dem Fall, dass Zulieferer nicht rechtzeitig in der gewünschten Menge liefern können, Lieferanten aus dem Inland oder aus einem von den Hemmnissen nicht betroffenen ausländischen Staat wählen um die Zulieferer zu ersetzen und Produktions- und damit Lieferengpässe zu vermeiden. Im Fall der IT-Konzerne ist das jedoch nicht ohne weiteres möglich, da zum einen ein hoher Spezialisierungsgrad bei den Zulieferern vorliegt und zum anderen alleine an einem Smartphone circa 270 Zulieferer beteiligt sind.[88] Zur Produktion von Smartphones beziehungsweise deren Komponenten wird beispielsweise eine Vielzahl seltener Erden benötigt. 85 % der weltweiten Förderung dieser Rohstoffe findet in China statt, eine Förderung in den USA ist auf Grund strenger Umweltvorschriften nicht möglich.[89] Sollten die Vereinigten Staaten also neben den bereits angedrohten Strafzöllen auch durch nicht-tarifäre Handelshemmnisse gegen China vorgehen, hätte das massiven Einfluss auf die Zulieferer, die diese Rohstoffe weiterverarbeiten und sich auf ihrem Gebiet spezialisiert haben. Bei einer vollständigen Produktion im Ausland bestünde zwar dieses Problem für die Zulieferer nicht, es könnte aber dazu kommen, dass die IT-Unternehmen weniger oder gar keine im Ausland montierten Produkte importieren können. In beiden Fällen würde es zu einer Mengenverknappung, damit einhergehenden Umsatzeinbrüchen und einem dadurch hervorgerufenen Verlust von Marktanteilen kommen.
Die in dem Marktsegment aktiven Unternehmen, also Google, Amazon, Apple und Microsoft, müssten solche Konsequenzen aber nicht nur bei der Einführung dieser Art von Hemmnissen im eigenen Land befürchten, sondern auch wenn andere Länder als Konsequenz auf diese eigene nicht-tarifäre Handelshemmnisse gegen US-Produkte verhängen. Es ist allerdings fraglich, ob die Produkte überhaupt als amerikanische Erzeugnisse definiert wären, da sie zwar unter dem Namen US-amerikanischer Unternehmen verkauft werden, ihre Produktion jedoch nicht zwingend in den USA stattfand.
Auf der anderen Seite hätten die Hardwarehersteller nicht nur Nachteile, da auch ausländische Mitbewerber von den Hemmnissen betroffen wären. Auch diese wären nicht mehr ohne weiteres in der Lage ihre Produkte in die USA zu importieren und müssten mit Umsatzeinbußen und dem Verlust von Marktanteilen rechnen. Diese Marktanteile könnten dann heimische Produzenten für sich vereinnahmen. Die künstliche Verknappung würde außerdem dazu führen, dass die Produzenten ihre Produkte mit höheren Margen verkaufen könnten, da die Nachfrage gleich bliebe, die Angebotsmenge jedoch sänke. Um die nicht-tarifären Handelshemmnisse aber zu einem eigenen Vorteil nutzen zu können, müssten allerdings auch die Produkte der behandelten Unternehmen als amerikanisch deklariert werden, die im Ausland produziert werden. Ob das mit der Trump Administration möglich ist, ist allerdings fraglich. Dazu wäre es möglicherweise nötig die Endprodukte in den USA zu fertigen. Die Schwierigkeiten die damit verbunden sind, wurden bereits bei den Auswirkungen tarifärer Handelshemmnisse behandelt.
Auch in dem Segment „Online Handel“ hätten nicht-tarifäre Handelshemmnisse Auswirkungen auf die Unternehmen. Sie könnten in dem Segment dazu führen, dass die Online-Händler, im Fall dieser Arbeit vor allem Amazon, weniger ausländische Produkte importieren können und so ihr Sortiment sowohl in der Tiefe als auch in der Breite kleiner würde. Die geringere Auswahl würde sich auf die Kunden auswirken, die dann unter Umständen die gewünschten Produkte bei Konkurrenten von Amazon bestellen würden, welche die Waren vorrätig haben. Dies würde zu Umsatzverlusten führen. Außerdem könnte diese Form von Handelshemmnissen, je nach gewählter Form, dazu führen, dass Produkte später als gewöhnlich bei den Konsumenten in den USA ankommen. Das wäre zum einen der Fall, wenn die Produkte von Amazon direkt versendet würden und die Ware erst später bei dem Unternehmen aus Seattle eintreffen würde. Zum anderen, wenn das Produkt von einem anderen Händler versendet wird, der die Ware entweder erst eigens aus dem Ausland importiert oder selbst aus dem Ausland agiert. Vor allem bei letzteren Händlern könnte Amazon an Attraktivität einbüßen, da diese sich möglicherweise, wie bei tarifären Handelshemmnissen, teilweise oder gänzlich wegen der steigenden Hürden aus dem amerikanischen Markt zurückziehen. Das würde, wie bereits das geringere Warenangebot, zu unzufriedeneren Kunden führen sowie zu den bereits in Kapitel 4.1 angesprochenen, sinkenden Provisionseinnahmen. Wie bereits bei der Verhängung von tarifären Handelshemmnissen müsste Amazon auch bei einer Verhängung von nicht-tarifären Handelshemmnissen mit Auswirkungen durch Vergeltungsmaßnahmen rechnen, wie beispielsweise ein erschwerter Export von Waren aus den USA in Länder, die diese Gegenmaßnahmen beschlossen haben. Wie bereits bei den tarifären Handelshemmnissen könnte Amazon allerdings von solchen Maßnahmen mit Hilfe seiner auch außerhalb der USA gelegenen Distributionscenter verschont bleiben.
[...]
[1] Trump (2017)
[2] Vgl. Fortune Global 500 List 2017 (2017).
[3] Vgl.Handelsblatt GmbH (2017).
[4] Vgl. About Us | Google 2017.
[5] Vgl. Schulz (2015), S. 41 f. .
[6] Vgl. Statista GmbH (2017i).
[7] Vgl. Schulz (2015), S. 13.
[8] Vgl. Our Products | Google (2017).
[9] Vgl. Schulz (2015), S. 96 f. .
[10] Vgl. Boie und Huber (2015).
[11] Vgl. Leisegang (2014), S. 35.
[12] Vgl. AmazonBasics-Shop @ Amazon.de.
[13] Vgl. Amazon Prime.
[14] Vgl van der Meulen und Pettey (2017).
[15] Vgl. Knop (2013), S. 88.
[16] Vgl.Handelsblatt GmbH (2017).
[17] Vgl. Jacobsen (2014), S. 4.
[18] Vgl. Kane und Kurbasik (2015), S. 25 ff. .
[19] Vgl. Jacobsen (2014), S. 26.
[20] Vgl. Jacobsen (2014), S. 30 ff. .
[21] Vgl. Jacobsen (2014), S. 36 ff. .
[22] Vgl. Jacobsen (2017), S. 22.
[23] Vgl. Görig (2011), S. 45 f. .
[24] Vgl. Statista GmbH (2017h).
[25] Vgl. Schulz (2015), S. 26.
[26] Vgl. Upbin (2012).
[27] Sämtliche Jahreszahlen und Produkte in diesem Absatz wurden der offiziellen Homepage der Microsoft Corporation entnommen (Vgl. Microsoft Corporation (2017)).
[28] Vgl. Statista GmbH (2017a).
[29] Vgl. Borchers (2011).
[30] Vgl. Handelsblatt GmbH.
[31] Vgl. Buxmann et al. (2015), S. 76.
[32] Vgl. Hecking (2016).
[33] Vgl. Burris (2010), VII.
[34] Vgl. Armbruster (2017).
[35] Vgl. Siber und Rodrik (2011), S. 89 f. .
[36] Vgl. Siber und Rodrik (2011), S. 93.
[37] Vgl. Enders (2016), S. 136.
[38] Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2017).
[39] Vgl. World Trade Organization (2017a).
[40] Vgl. SPIEGELnet GmbH (2017b).
[41] Vgl. World Trade Organization (2017b).
[42] Vgl. Enders (2016), S. 139.
[43] Vgl. Siber und Rodrik (2011), S. 117 ff.
[44] Vgl. SPIEGELnet GmbH (2017b).
[45] Die folgende Erläuterung der Gründe und Auswirkungen protektionistischer Politik stammen zu großen Teilen aus dem Buch „Anwendungsorientierte Außenwirtschaft: Theorie & Politik“ von Wolfgang Eibner (Vgl. Eibner (2010), S. 106).
[46] Vgl. Koch (2006), S. 125.
[47] Dieses Beispiel stammt aus dem Buch International Economics. Theory and policy von Krugman, Obstfeld und Melitz; (Vgl. Krugman et al. (2015), S. 277 f.).
[48] Vgl. Langhorst und Mildner (2009), S. 6 f.
[49] Vgl. Koch (2014), S. 133.
[50] Vgl. Koch (2014), S. 103.
[51] Dieses Beispiel stammt aus dem von der Konrad Adenauer Stiftung veröffentlichten Working Paper „Protektionismus und ökonomischer Nationalismus - Kein guter Rat zur Krisenbewältigung“ (Vgl. Langhorst und Mildner (2009), S. 4).
[52] Vgl. Eibner (2010), S. 157 ff. .
[53] Vgl. Armbruster (2017).
[54] Vgl. Petersen et al. (2017), S. 6.
[55] Vgl. Eibner (2010), S. 107.
[56] Vgl. Losse (2016).
[57] Eibner (2010), S. 107
[58] Vgl. Kirchgeorg.
[59] Vgl. Statista GmbH (2017h).
[60] Vgl. Koch (2006), S. 124 f. .
[61] Vgl. Krugman et al. (2015), S. 239.
[62] Vgl. Eibner (2010), S. 117.
[63] Vgl. Eibner (2010), S. 121.
[64] Vgl. Krugman et al. (2015), S. 221.
[65] Vgl. Eibner (2010), 115 f. .
[66] Vgl. Koch (2006), S. 125. .
[67] Vgl. Eibner (2010), S. 121.
[68] Vgl. Schmoll (2017).
[69] Vgl. Su (2016).
[70] Vgl. Merchant (2017).
[71] Vgl. Warren (2017).
[72] Als Arbeitskosten gelten alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Einsatz natürlicher Personen in einem Unternehmen entstehen. (Vgl. Weber und Schmidt).
[73] Vgl. Schröder (2016).
[74] Vgl. Denning (2011).
[75] Vgl. Hua (2017).
[76] Vgl. Ankenbrand und Lindner (2014).
[77] Vgl. Stone (2013), S. 130.
[78] Vgl. Google LLC. (2017).
[79] Vgl. Arthur und Gibbs (2014).
[80] Vgl. Schulz (2015), S. 237.
[81] Vgl. Statista GmbH (2017g).
[82] Vgl. Statista GmbH (2017a).
[83] Vgl. Handermann (2017).
[84] Vgl. Buxmann et al. (2015), S. 69 f. .
[85] Vgl. Koch (2006), S. 135.
[86] Vgl. Koch (2006), S. 141.
[87] Vgl. Koch (2006), S. 137.
[88] Vgl. Trentmann (2014).
[89] Vgl. Dörner et al. (2016).
-
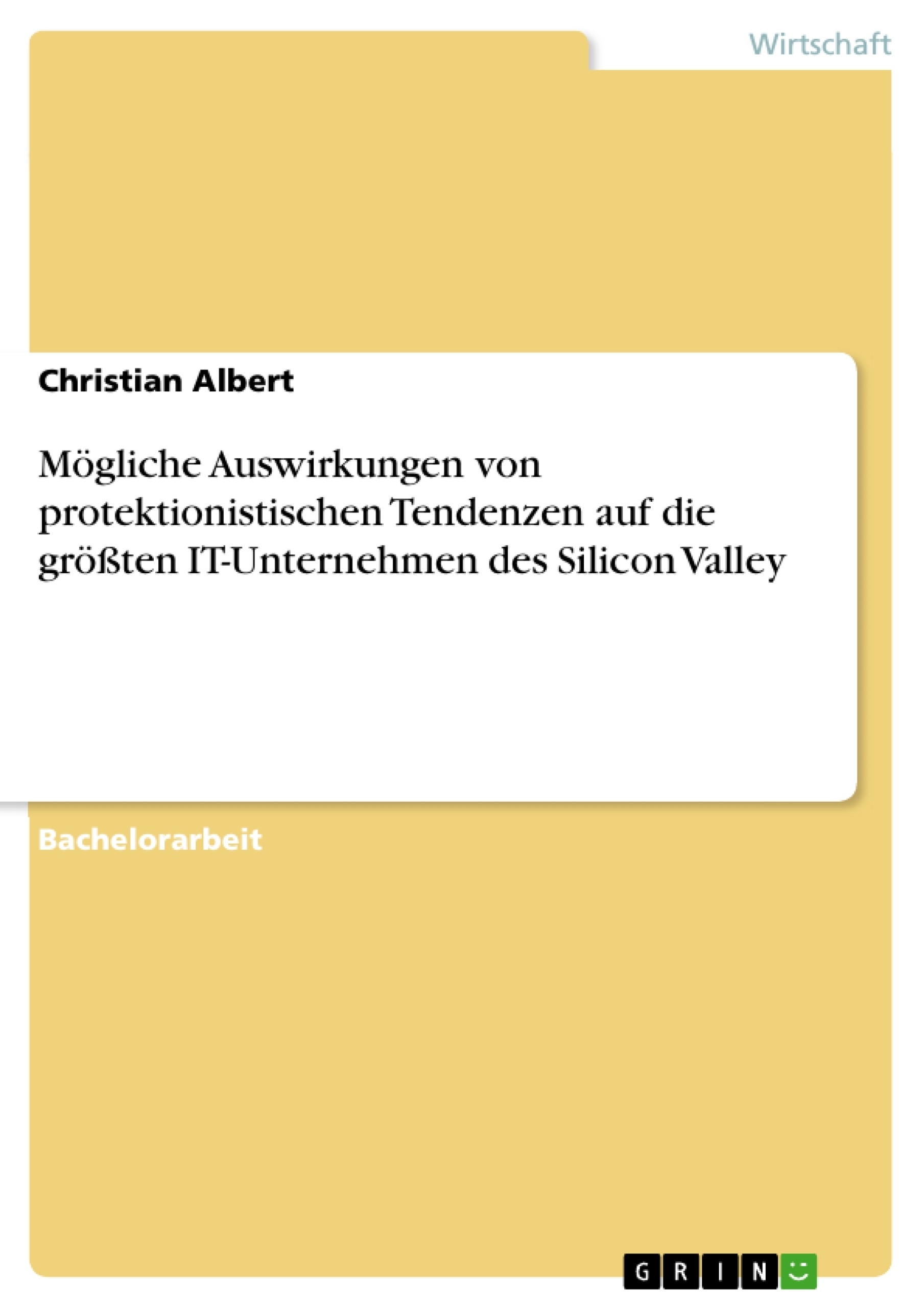
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.