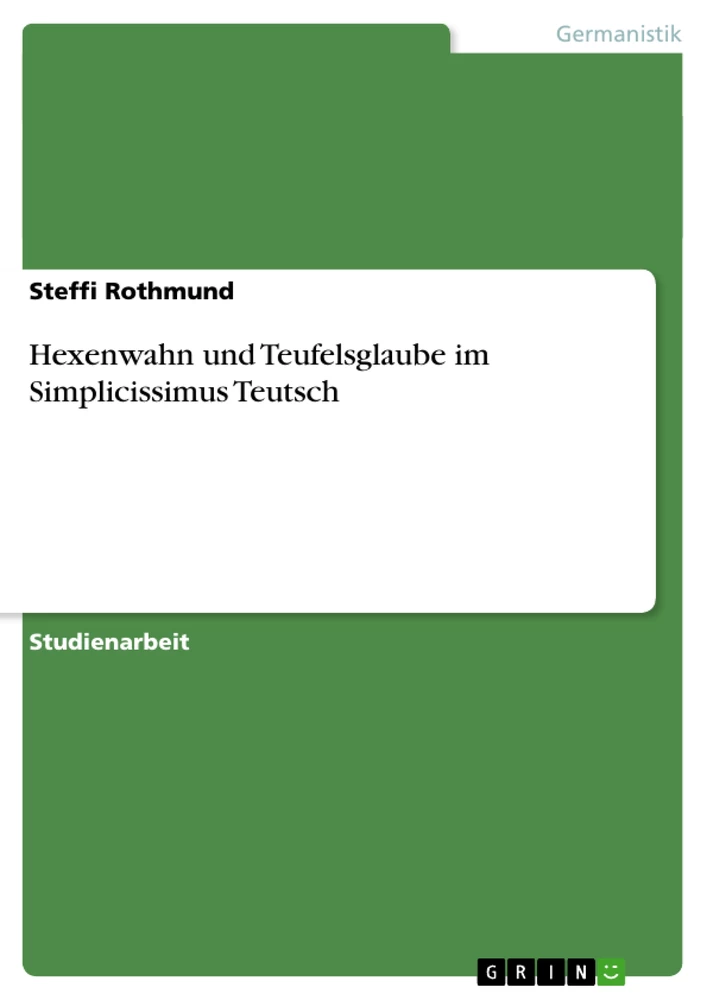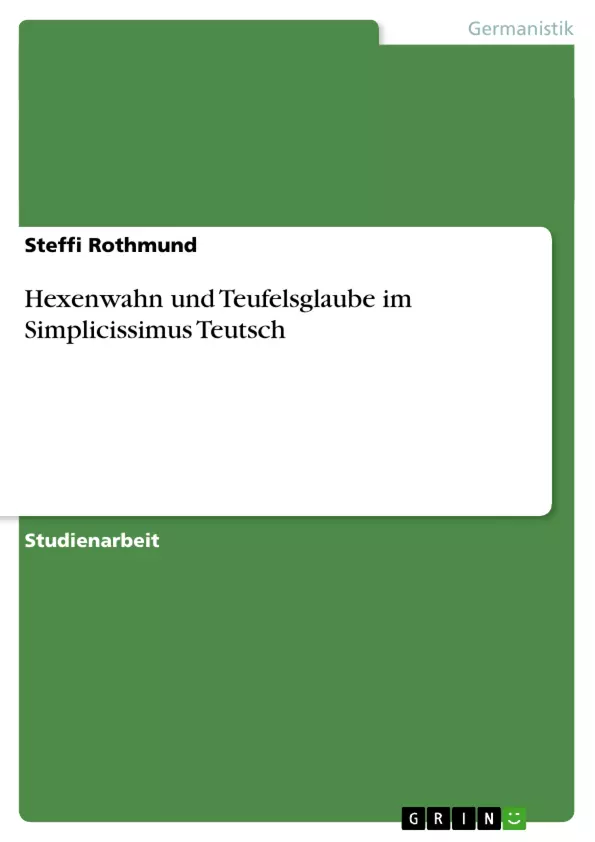Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen war bereits zu Lebzeiten mit seinem „Simplicissimus Teutsch“ ein namhafter Schriftsteller, der, wie seiner Zeit üblich, dem Leser eine rational angelegte Einsicht in das Wesen von Gut und Böse gewähren wollte.
So war die Intention des barocken Schriftstellers eng mit der Erkenntnisgewinnung des Lesers verbunden und lässt sich in Anlehnung an den Römer Horaz auf folgende Formel bringen: Prodesse et delectare. Literatur diente demnach nicht nur der Unterhaltung, sondern auch dem Nutzen. Zur Zeit des Barock, als der Dreißigjährige Krieg in vollem Gange war, lag der zu erzielende Nutzen meist in den sittlich religiösen Inhalten, die durch Übertreibung aller Dinge, die nicht ins damalige fromme Weltbild passte, als nonkonform darstellten und somit einen Gegenpol zur Religion schufen: den Aberglauben.
Alles ,was nicht der Sitte, der Moral oder christlichen Vorstellungen entsprach, wurde als vom Teufel oder von Hexen geschaffen, dargestellt, und galt demnach als schlecht. Dagegen wurde alles, was in das christliche Weltbild passte, wurde für gut gehalten. Den damaligen Leser auf diesen in der Welt existierenden Dualismus aufmerksam zu machen, das war wohl die Intention des barocken Schriftstellers.
Das mit dieser Arbeit angestrebte Erkenntnisinteresse liegt ergo in der Frage, inwieweit der Autor die Thematik des Aberglaubens in seinem Roman bearbeitet und welchen Nutzen diese für den damaligen Leser haben sollte. Um dieser Frage nachgehen zu können, scheint es erforderlich, zunächst ganz allgemein die Frömmigkeit und den Aberglauben in Form von Hexen- und Teufelsglauben zur Zeit des Barocks zu betrachten, um danach mit einem gewissen Grundwissen tiefer in das Werk einzudringen. Hierfür scheint es sinnvoll, zunächst die Frömmigkeitsbewegung innerhalb des Barock unter die Lupe zu nehmen und ausführlich auf Kirchenvater Augustinus und seine Lehre einzugehen, die den Barock bzw. das gesamte Mittelalter nachhaltig beeinflusste. Bevor wir schließlich ,in medias res’ gehen, verdient aber noch die Einstellung Grimmelshausens zu diesem Thema Betrachtung, vor allem aber, wie diese in seinem Werk vertreten ist.
Da sich nach sorgfältiger Stoffsammlung herausstellte, dass sich die Thematik des Aberglaubens besonders eindrücklich im zweiten Buch des Romans findet, werden schließlich im letzten Teil der Hausarbeit ausgewählte Textstellen zu diesem Thema dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Augustinische Frömmigkeit und Aberglaube im 17. Jahrhundert – Ein Wechselspiel
- Die Lehre des Heiligen Augustinus
- Augustinische Frömmigkeit im Barock
- Der Nährboden für den Barocken Aberglauben
- Hexenwahn und Teufelsglaube im „Simplicissimus Teutsch“
- Die Religiosität Grimmelshausens und das religiöse Konzept seiner Schriften
- Hexenwahn und Teufelsglaube im „Simplicissimus“ – das zweite Buch des Romans
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Aberglauben, insbesondere Hexenwahn und Teufelsglaube, im Roman „Simplicissimus Teutsch“ von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Das Ziel ist es, die Intention des Autors zu ergründen und den Nutzen dieser Thematik für den damaligen Leser zu beleuchten. Hierzu wird zunächst der Kontext des 17. Jahrhunderts, geprägt von augustinischer Frömmigkeit und herrschendem Aberglauben, analysiert.
- Augustinische Frömmigkeit und ihre Auswirkungen auf das Weltbild des Barock
- Das Verhältnis von christlicher Frömmigkeit und Aberglauben im 17. Jahrhundert
- Die Darstellung von Hexenwahn und Teufelsglaube in Grimmelshausens „Simplicissimus“
- Die Funktion des Aberglaubens als Gegenpol zur Religion im Werk
- Die Intention Grimmelshausens und der Nutzen für den Leser
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die Intention der Arbeit, die darin besteht, die Behandlung des Aberglaubens im „Simplicissimus Teutsch“ zu untersuchen und dessen Bedeutung für den damaligen Leser zu ergründen. Es wird die Intention Grimmelshausens, dem Leser eine rational angelegte Einsicht in Gut und Böse zu vermitteln, herausgestellt und der Aberglaube als Gegenpol zur vorherrschenden christlichen Frömmigkeit im Kontext des Dreißigjährigen Krieges positioniert. Der Fokus liegt auf der Erforschung des Dualismus zwischen dem christlichen Weltbild und den damals weit verbreiteten abergläubischen Vorstellungen. Die Arbeit beginnt mit einer allgemeinen Betrachtung der Frömmigkeit und des Aberglaubens im Barock, bevor sie sich detaillierter mit Grimmelshausens Werk auseinandersetzt, wobei der Schwerpunkt auf dem zweiten Buch des Romans liegt.
Augustinische Frömmigkeit und Aberglaube im 17. Jahrhundert – Ein Wechselspiel: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss des Heiligen Augustinus auf das religiöse und gesellschaftliche Denken des 17. Jahrhunderts. Es beschreibt Augustinus' Lehre, insbesondere seine Zwei-Welten-Lehre (civitas dei und civitas terrena), den Dämonenpakt und die Gnadenlehre. Die Kapitel analysieren, wie Augustinus' streng dualistisches Weltbild, der Kampf zwischen Gut und Böse und die Rolle der göttlichen Gnade, den Nährboden für Aberglauben schufen. Das Kapitel veranschaulicht, wie die Unvereinbarkeit von heidnischen Praktiken wie Wahrsagerei und Astrologie mit dem christlichen Glauben zu einer starken Abgrenzung und Verurteilung von allem führte, was nicht dem strengen christlichen Weltbild entsprach, und somit den Aberglauben als Gegenpol hervorbrachte. Die Verknüpfung von Erbsünde und Gnadenlehre wird ebenfalls erläutert, um das Verständnis des religiösen Kontextes des 17. Jahrhunderts zu vertiefen.
Schlüsselwörter
Simplicissimus Teutsch, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Barockliteratur, Aberglaube, Hexenwahn, Teufelsglaube, Augustinische Frömmigkeit, Zwei-Welten-Lehre, Gnadenlehre, Erbsünde, Dreißigjähriger Krieg, Religiosität, Moral, Sitte.
Häufig gestellte Fragen zu "Augustinische Frömmigkeit und Aberglaube im 17. Jahrhundert – Ein Wechselspiel im Simplicissimus Teutsch"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Aberglauben, insbesondere Hexenwahn und Teufelsglaube, im Roman „Simplicissimus Teutsch“ von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Sie analysiert die Intention des Autors und beleuchtet den Nutzen dieser Thematik für den damaligen Leser im Kontext des 17. Jahrhunderts.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die augustinische Frömmigkeit und ihre Auswirkungen auf das Weltbild des Barock, das Verhältnis von christlicher Frömmigkeit und Aberglauben im 17. Jahrhundert, die Darstellung von Hexenwahn und Teufelsglaube in Grimmelshausens „Simplicissimus“, die Funktion des Aberglaubens als Gegenpol zur Religion im Werk und die Intention Grimmelshausens sowie den Nutzen für den Leser.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst ein Vorwort, ein Kapitel über augustinische Frömmigkeit und Aberglauben im 17. Jahrhundert, ein Kapitel über Hexenwahn und Teufelsglaube im „Simplicissimus Teutsch“, insbesondere im zweiten Buch des Romans, und ein Literaturverzeichnis. Das Vorwort erläutert die Intention der Arbeit und positioniert den Aberglauben als Gegenpol zur vorherrschenden christlichen Frömmigkeit im Kontext des Dreißigjährigen Krieges.
Was wird im Kapitel über augustinische Frömmigkeit und Aberglauben behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss des Heiligen Augustinus auf das religiöse und gesellschaftliche Denken des 17. Jahrhunderts. Es beschreibt Augustinus' Lehre (Zwei-Welten-Lehre, Dämonenpakt, Gnadenlehre) und analysiert, wie sein dualistisches Weltbild den Nährboden für Aberglauben schuf. Es wird die Unvereinbarkeit von heidnischen Praktiken mit dem christlichen Glauben und die daraus resultierende Abgrenzung und Verurteilung beleuchtet. Die Verknüpfung von Erbsünde und Gnadenlehre wird ebenfalls erläutert.
Was ist der Fokus des Kapitels über den „Simplicissimus Teutsch“?
Der Fokus liegt auf der Darstellung von Hexenwahn und Teufelsglaube im zweiten Buch des Romans. Die Arbeit untersucht die Religiosität Grimmelshausens und das religiöse Konzept seiner Schriften, um die Intention des Autors und die Bedeutung des Aberglaubens für den damaligen Leser zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Simplicissimus Teutsch, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Barockliteratur, Aberglaube, Hexenwahn, Teufelsglaube, Augustinische Frömmigkeit, Zwei-Welten-Lehre, Gnadenlehre, Erbsünde, Dreißigjähriger Krieg, Religiosität, Moral, Sitte.
Welche Intention verfolgt die Autorin/der Autor?
Die Intention der Arbeit besteht darin, die Behandlung des Aberglaubens im „Simplicissimus Teutsch“ zu untersuchen und dessen Bedeutung für den damaligen Leser zu ergründen. Es soll die Intention Grimmelshausens, dem Leser eine rational angelegte Einsicht in Gut und Böse zu vermitteln, herausgestellt werden.
- Quote paper
- Steffi Rothmund (Author), 2002, Hexenwahn und Teufelsglaube im Simplicissimus Teutsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41238