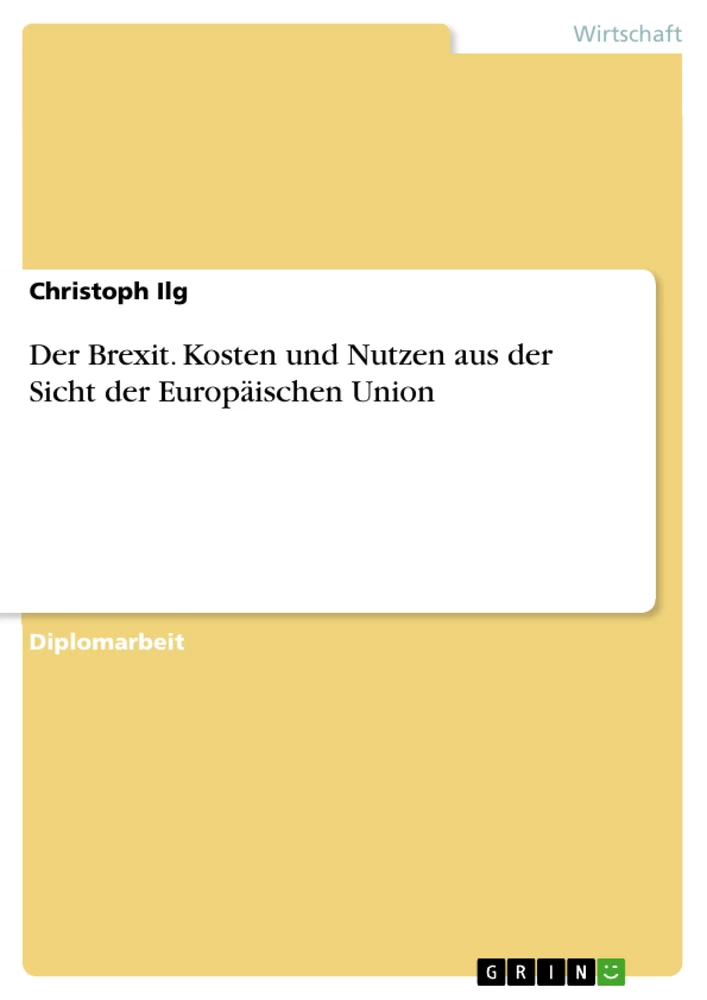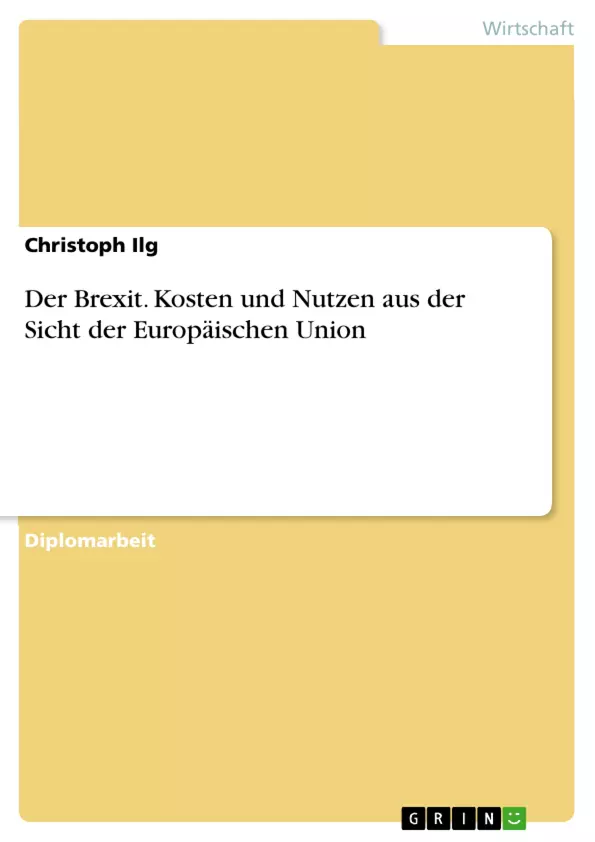Ein Kofferwort, oder auch Kontamination genannt, ist eine Zusammenziehung von morphologisch überlappenden Wörtern, die formal und/oder inhaltlich verwandt sind. Aus den Worten Britain und Exit wurde das Wort "Brexit".
Mit dem möglichen Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone gab es mit dem "Grexit" bereits 2009 einen äquivalenten Begriff. Griechenland ist weiterhin in der Europäischen Union und der Grexit wurde nie zur Realität.
Beim Brexit, dem Ausscheiden von Großbritannien aus der Europäischen Union, sieht es jedoch anders aus. Einen Präzedenzfall, worin ein EU-Mitglied aus der Union ausgetreten ist, gibt es bis dato noch nicht. In vielen Bereichen herrscht deshalb eine große Unsicherheit, da man sich auf keine Erfahrungswerte und Praktiken beziehen kann. In der folgenden Diplomarbeit werden zum einen die Kosten und zum anderen die Nutzenfaktoren des Brexit aus Sicht der Europäischen Union erläutert. Die Analyse basiert auf Prognosen von Ökonomen, Zeitungsartikeln und statistischen Werten von Forschungsinstituten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Kosten aus der Sicht der Europäischen Union
- Handelseinbußen
- Investitionseinbußen
- Kosten reduzierte Faktorwanderung - Migration
- Ausfall eines wichtigen Beitragszahlers
- Wegfall der britischen Stimme in EU-Gremien
- Nutzen aus der Sicht der Europäischen Union
- Handelsgewinne für andere EU-Mitglieder
- Finanzplatz Frankfurt am Main gewinnt
- Beschäftigungszuwachs im Finanzsektor
- Europa wächst zusammen
- Wegfall des Bremsers Großbritannien im EU-Gremium
- Ausblick
- Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den Kosten und Nutzen des Brexit aus der Sicht der Europäischen Union. Sie analysiert die Auswirkungen des Austritts Großbritanniens auf die EU, indem sie auf Prognosen von Ökonomen, Zeitungsartikel und statistische Werte von Forschungsinstituten zurückgreift.
- Bewertung der wirtschaftlichen Folgen des Brexit für die EU
- Analyse der Auswirkungen auf den Handel und die Investitionen
- Beurteilung der Folgen für die Arbeitsmigration und die Finanzmärkte
- Untersuchung der politischen und institutionellen Implikationen des Brexit
- Identifizierung von Chancen und Risiken für die EU nach dem Austritt Großbritanniens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung erläutert den Begriff „Brexit“ und stellt die historische Entwicklung des britischen Austritts aus der EU dar. Sie beleuchtet auch die Debatten und Meinungsverschiedenheiten innerhalb Großbritanniens über den Brexit und skizziert die wichtigsten Herausforderungen, die sich im Zuge des Austritts stellen.
- Kosten aus der Sicht der Europäischen Union: Dieses Kapitel analysiert die potentiellen Kosten des Brexit für die EU. Dazu gehören Handelseinbußen, Investitionseinbußen, Kosten durch reduzierte Faktorwanderung, der Ausfall eines wichtigen Beitragszahlers und der Verlust der britischen Stimme in EU-Gremien.
- Nutzen aus der Sicht der Europäischen Union: Dieses Kapitel beleuchtet die potenziellen Nutzen des Brexit für die EU. Dazu gehören Handelsgewinne für andere EU-Mitglieder, die Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt am Main, Beschäftigungszuwachs im Finanzsektor, ein verstärktes Zusammenwachsen Europas und der Wegfall des Bremsers Großbritannien im EU-Gremium.
Schlüsselwörter
Brexit, Europäische Union, Handel, Investitionen, Migration, Finanzmärkte, Politik, Institutionen, Chancen, Risiken
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wirtschaftlichen Kosten des Brexit für die EU?
Zu den Kosten zählen Handelseinbußen, geringere Investitionen, der Wegfall eines großen Beitragszahlers zum EU-Haushalt und die Einschränkung der Migration von Fachkräften.
Welche Vorteile (Nutzen) ergeben sich für die EU aus dem Brexit?
Ein Nutzen ist die Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt am Main, die Gewinnung von Arbeitsplätzen im Finanzsektor und der Wegfall Großbritanniens als politischer "Bremser" in EU-Gremien.
Wie wirkt sich der Brexit auf den Finanzsektor aus?
Viele Finanzdienstleister verlagern ihre Sitze von London in EU-Städte wie Frankfurt, was dort zu einem Beschäftigungszuwachs und einer höheren Bedeutung der lokalen Börsen führt.
Was bedeutet der Begriff "Brexit"?
Es ist ein Kofferwort aus "Britain" und "Exit" und bezeichnet den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.
Fördert der Brexit den Zusammenhalt der restlichen EU?
Es besteht die Prognose, dass die verbleibenden EU-Staaten ohne die Sonderwünsche Großbritanniens politisch enger zusammenwachsen und Entscheidungsprozesse effizienter werden könnten.
- Citar trabajo
- Christoph Ilg (Autor), 2017, Der Brexit. Kosten und Nutzen aus der Sicht der Europäischen Union, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412446