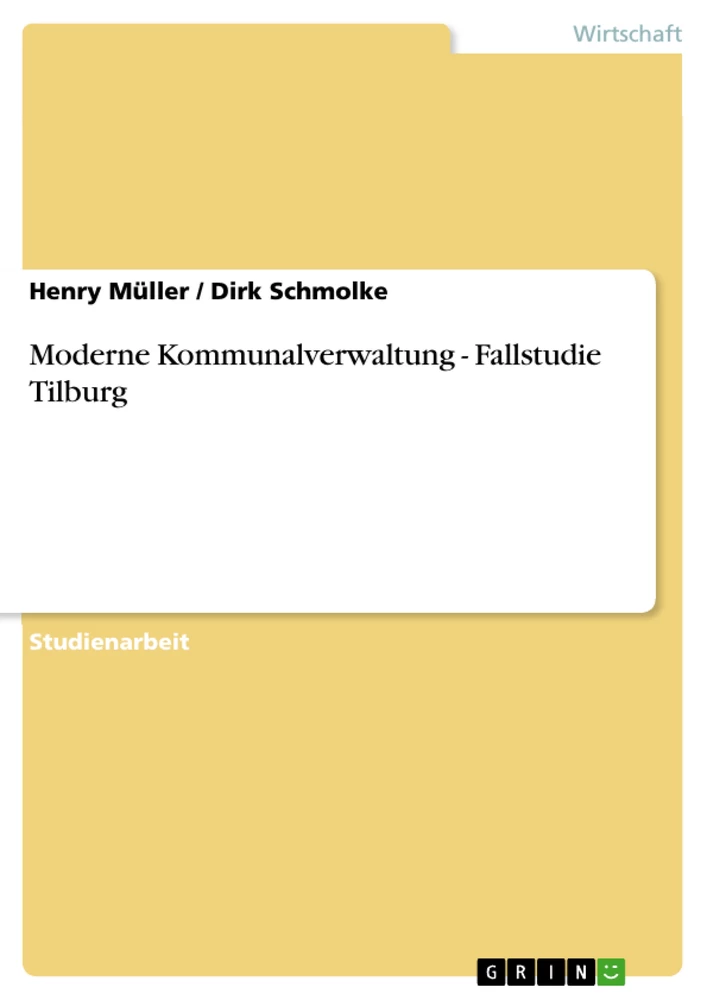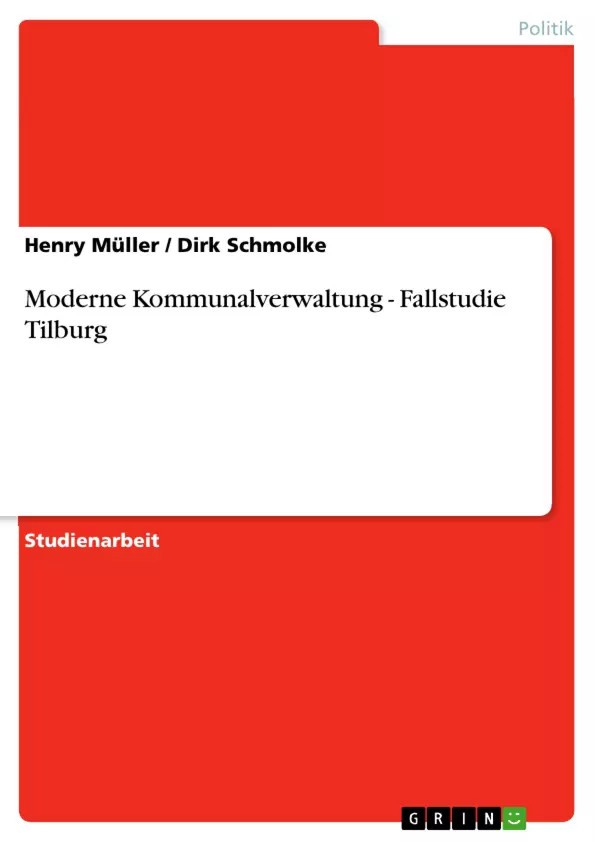Einleitung
1. Reformbedarf auf kommunaler Ebene
Die Kommunalverwaltungen sind nach den Reformprojekten und Entbürokratisierungsversuchen in den siebziger und achtziger Jahren sowie nach unterschiedlichen EDV-technischen Innovationen Schauplätze neuer Modernisierungsanläufe. Diese sind im wesentlichen binnenorganisatorisch ausgerichtet, sie gehen an die Substanz des bestehenden bürokratischen Systems und sind vom Effizienzgedanken beherrscht. Die international diskutierten und zum Teil bereits praktizierten Ansätze beinhalten tiefe Einschnitte in die Organisation und sind vor allem Steuerungskonzepte.
Vor dem Hintergrund einer tiefen Krise der Kommunalfinanzen und scharfer Kritik an der öffentlichen Verwaltung wurden in vielen Städten - u.a. in der niederländischen Stadt Tilburg - Reformen der Führungs- und Organisationsstruktur der Verwaltung eingeleitet. Die Einführung bereits aus der Privatwirtschaft bekannter betriebswirtschaftlicher Managementtechniken2 soll dazu beitragen, die Verwaltung stärker am Ergebnis und dem Nutzen der “Nachfrager”, d.h. der Bürger, zu orientieren. Das Tilburger Modell ist wie ähnliche Reformbemühungen dem Ziel verpflichtet, die Verwaltung von einer Behörde in ein Dienstleistungsunternehmen zu verwandeln.3 Zudem zwingt die finanzielle Mittelknappheit die Kommunen zu einem ressourcenschonenden Haushalten. Bei gleichbleibendem oder eher steigendem Anspruchsniveau der Bürger sind die Behörden gezwungen, innovative Ideen für die Kommunalverwaltung umzusetzen, damit sich keine Lücke bildet, die durch eine Effizienz- und Effektivitätssteigerung geschlossen werden könnte.4
Es läßt sich festhalten, daß alle Reformprogramme in vier oder fünf Elemente zerlegbar sind:
Dezentralisierung von Verantwortung und Kompetenzen.
Partizipation von Mitarbeitern und Kunden.
Markt- und Serviceorientierung der Dienstleistungen.
Leistungsmessung und -steuerung.
Gegebenenfalls: Suche nach neuen Planungs- und Budgetierungsinstrumenten.
Für die Umgestaltung der öffentlichen Verwaltung im kommunalen Bereich soll hier das Beispiel
der niederländischen Stadt Tilburg betrachtet werden, die das gesamte System des Kontraktmanagements
zur Ergebnisoptimierung in die Praxis umgesetzt haben.5
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- 1. Reformbedarf auf kommunaler Ebene
- 2. Handlungsbedarf der Stadt Tilburg
- II. DIE POLITISCHEN RAHMENBEDINGUNGEN UND GEMEINDE ORGANE IN DEN NIEDERLANDEN
- 1. Der Gemeinderat
- 2. Das Kollegium
- 3. Der Bürgermeister
- 4. Die Organisation der Gemeindeverwaltung
- III. DAS TILBURGER MODELL
- 1. Der Begriff „Konzern Stadt“
- 2. Die Prinzipien des Kontraktmanagements
- 2.1. Struktureller Aufbau der Kommunalverwaltung - Dezentralisierung der Kompetenzen
- 2.2. Steuerung nach Leitlinienentscheidungen
- 2.3 Das Produkt im Mittelgrund des Handelns
- 3. Einführung eines Berichtswesens mit Controllingelementen
- 3.1. Der Dienstbericht
- 3.2. Der Konzernbericht
- 3.3. Der Umgang mit Planabweichungen
- 4. Personalpolitik und -entwicklung
- 4.1. Das Lohnsystem
- 4.2. Beurteilungen und Mitarbeitergespräche
- 4.3. Andere Problemstellungen für das Personalwesen in Verbindung mit den Zielen der Reform
- 5. Die präventive Betriebsdurchleuchtung
- IV. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Fallstudie Tilburg analysiert die tiefgreifenden Reformen der niederländischen Stadt Tilburg, die die öffentliche Verwaltung als Dienstleistungsunternehmen umstrukturieren. Das Ziel der Reformen war es, die Kommunalverwaltung effizienter zu gestalten und die Bedürfnisse der Bürger stärker in den Vordergrund zu stellen. Die Studie beleuchtet die politischen Rahmenbedingungen und Gemeindeorgane in den Niederlanden, insbesondere die Rolle des Gemeinderates, des Kollegiums und des Bürgermeisters.
- Das Tilburger Modell als Beispiel für die Umwandlung einer Behörde in ein Dienstleistungsunternehmen.
- Die Prinzipien des Kontraktmanagements, insbesondere Dezentralisierung, Steuerung nach Leitlinien und outputorientiertes Handeln.
- Die Einführung eines Berichtswesens mit Controllingelementen zur Überwachung und Steuerung der Verwaltung.
- Die Auswirkungen der Reformen auf die Personalpolitik und -entwicklung.
- Die Bedeutung der präventiven Betriebsdurchleuchtung zur Sicherung der Effizienz und Transparenz der Verwaltung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit dem Reformbedarf auf kommunaler Ebene und dem Handlungsbedarf der Stadt Tilburg. Kapitel II beleuchtet die politischen Rahmenbedingungen und Gemeindeorgane in den Niederlanden, darunter der Gemeinderat, das Kollegium und der Bürgermeister. In Kapitel III wird das Tilburger Modell vorgestellt, das auf den Prinzipien des Kontraktmanagements basiert, um eine effiziente und outputorientierte Verwaltung zu schaffen. Dieses Kapitel beinhaltet Informationen über die Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung, die Steuerung nach Leitlinien, das Produkt im Mittelpunkt des Handelns und die Einführung eines Berichtswesens mit Controllingelementen. Kapitel IV, welches nicht zusammengefasst wird, enthält das Fazit der Studie.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Fallstudie beinhalten: Kommunalverwaltung, Dienstleistungsunternehmen, Kontraktmanagement, Dezentralisierung, Steuerung nach Leitlinien, Outputorientierung, Berichtswesen, Controllingelemente, Personalpolitik, Betriebsdurchleuchtung, Tilburg, Niederlande.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Tilburger Modell“?
Es ist ein Reformmodell der niederländischen Stadt Tilburg, das die Stadtverwaltung nach betriebswirtschaftlichen Managementtechniken in ein modernes Dienstleistungsunternehmen umwandelt.
Welche Rolle spielt das „Kontraktmanagement“ in Tilburg?
Kontraktmanagement basiert auf der Dezentralisierung von Verantwortung, der Steuerung nach Leitlinien und der Orientierung an messbaren Ergebnissen (Produkten).
Wie wird der Erfolg der Verwaltung im Tilburger Modell kontrolliert?
Durch die Einführung eines Berichtswesens mit Controllingelementen, wie Dienst- und Konzernberichte, die Planabweichungen frühzeitig aufzeigen.
Was bedeutet der Begriff „Konzern Stadt“?
Dieser Begriff beschreibt die Sichtweise der Stadtverwaltung als ein integriertes Unternehmen, das effizient und ressourcenschonend für seine „Kunden“ (die Bürger) agiert.
Wie verändert die Reform die Personalpolitik?
Die Reform führt neue Lohnsysteme, regelmäßige Beurteilungen und Mitarbeitergespräche ein, um die Motivation und Leistungsfähigkeit zu steigern.
- Arbeit zitieren
- Henry Müller (Autor:in), Dirk Schmolke (Autor:in), 1996, Moderne Kommunalverwaltung - Fallstudie Tilburg, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4147