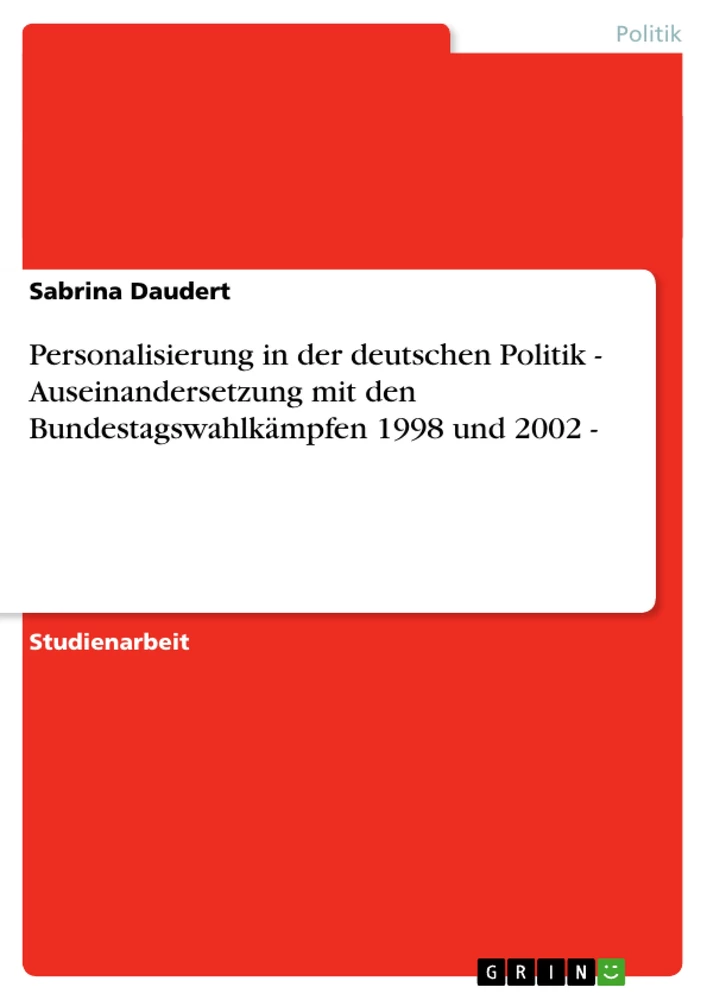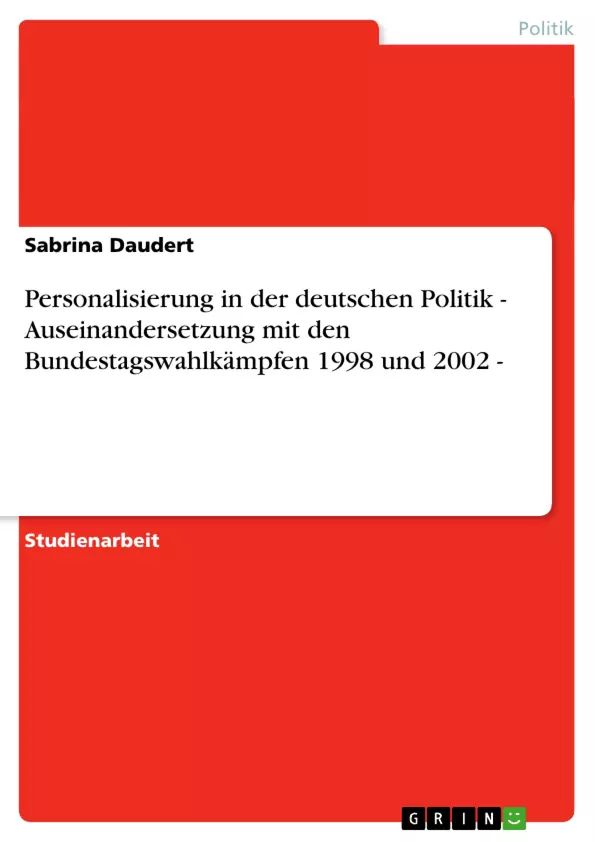Der Begriff „Personalisierung in der Politik“ lässt sich nach Brettschneider in drei verschiedene Komponenten aufteilen: die Personalisierung der Wahlkampfführung, die Personalisierung der Medienberichterstattung über Wahlkämpfe und schließlich die Personalisierung des Wählerverhaltens. Des Weiteren lassen sich eine allgemeine Komponente, welche die stärkere Betonung politischer Kandidaten in der Vermittlung von Politik umfasst, und eine spezifische Komponente, die die zunehmende Fokussierung in der Darstellung von Politikern auf deren persönliche Eigenschaften beinhaltet, differenzieren. Ob dies in Deutschland statt findet, soll hier geklärt werden.
Personalisierung erfüllt für Wähler im Allgemeinen eine komplexitätsreduzierende Funktion. Kandidateneigenschaften können in diesem Zusammenhang als „information shortcuts“ dienen. So ist das Wahrnehmen von Personen einfacher und auch alltagsnäher als das Studium „komplexer Parteiprogramme und das Abwägen von Sachargumenten“.
Während Spitzenpolitiker durchaus als eine materielle Ausdrucksform des politischen Angebots gesehen werden können, sind ihre Persönlichkeiten aber auch für die „objektive Qualität des Leistungsvollzugs“ relevant.
Aus der Sicht der Politiker erfüllt die Privatisierung der Politikdarstellung vier Funktionen: Vermenschlichung, Vereinfachung und Ablenkung, Emotionalisierung und Prominenzgewinn“. Ebenso nicht zu unterschätzen ist die Personalisierung als Option für Parteien, weil sich Einstellungen gegenüber Personen schneller ändern und somit auch „manipulierbarer sind als Wertorientierungen oder strukturell determinierte Parteipräferenzen“. Eine Chance besteht zudem in der Tatsache, dass während Parteien häufig eher negativ beurteilt werden, einzelne Führungspersönlichkeiten mit einer gewissen Ausstrahlungs- und Faszinationskraft durchaus das Potential besitzen können, Wählergruppen zu mobilisieren und Wähler ohne Parteibindung an die Partei zu binden. Nichtsdestotrotz muss von folgender Begebenheit ausgegangen werden: „Der Wähler wählt nicht Personen statt Programme, sondern Programme mit Personen. Er wählt nicht den Kandidat anstelle der Partei, sondern den Kandidaten (s)einer Partei.“
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Begriffsbestimmung Personalisierung
- Analyse der verschiedenen Personalisierungskomponenten
- Personalisierung des Wählerverhaltens
- Personalisierung der Medienberichterstattung
- Personalisierung der Wahlkampfführung
- Personalisierung in Deutschland
- Die Bundestagswahl 1998
- Die Bundestagswahl 2002
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Personalisierung in der deutschen Politik, insbesondere im Kontext der Bundestagswahlkämpfe von 1998 und 2002. Ziel ist es, die verschiedenen Komponenten der Personalisierung – vom Wählerverhalten bis hin zur Medienberichterstattung und Wahlkampfführung – zu analysieren und deren Bedeutung im deutschen Kontext zu beleuchten.
- Definition und verschiedene Komponenten der Personalisierung
- Personalisierung des Wählerverhaltens und die Rolle von Kandidatenorientierung
- Einfluss der Medienberichterstattung auf die Personalisierung
- Personalisierung in der Wahlkampfführung und ihre Auswirkungen
- Analyse der Bundestagswahlen 1998 und 2002 im Hinblick auf Personalisierungstrends
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs "Personalisierung in der Politik" und stellt verschiedene Komponenten wie die Personalisierung des Wählerverhaltens, der Medienberichterstattung und der Wahlkampfführung vor.
Im zweiten Kapitel wird die Personalisierung des Wählerverhaltens näher beleuchtet. Dabei werden die steigende Bedeutung von Kandidatenorientierungen und der Einfluss unpolitischer Merkmale auf den Wahlentscheid untersucht.
Schlüsselwörter
Personalisierung, Politik, Wahlkampf, Wählerverhalten, Medienberichterstattung, Bundestagswahlen, Kandidatenorientierung, Individualisierung, Dealignment, Professionalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Personalisierung in der Politik?
Es beschreibt die zunehmende Fokussierung auf einzelne Spitzenkandidaten und deren persönliche Eigenschaften statt auf komplexe Parteiprogramme.
Wie beeinflusst die Personalisierung das Wählerverhalten?
Kandidateneigenschaften dienen als "Information Shortcuts" (Abkürzungen), um politische Komplexität zu reduzieren und Entscheidungen alltagsnäher zu treffen.
Welche Rolle spielen Medien bei der Personalisierung?
Die Medienberichterstattung konzentriert sich oft auf die Privatsphäre und den Charakter von Politikern, was die emotionale Bindung der Wähler verstärken kann.
Wie zeigte sich dieser Trend in den Wahlkämpfen 1998 und 2002?
In diesen Jahren wurde in Deutschland eine deutliche Professionalisierung der Wahlkampfführung beobachtet, die stark auf die Strahlkraft der Kanzlerkandidaten setzte.
Wählen Menschen heute Personen statt Programme?
Laut Forschung wählen Wähler meist Programme mit Personen. Der Kandidat ersetzt nicht die Partei, sondern repräsentiert deren Angebot in greifbarer Form.
- Arbeit zitieren
- Sabrina Daudert (Autor:in), 2005, Personalisierung in der deutschen Politik - Auseinandersetzung mit den Bundestagswahlkämpfen 1998 und 2002 -, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41471