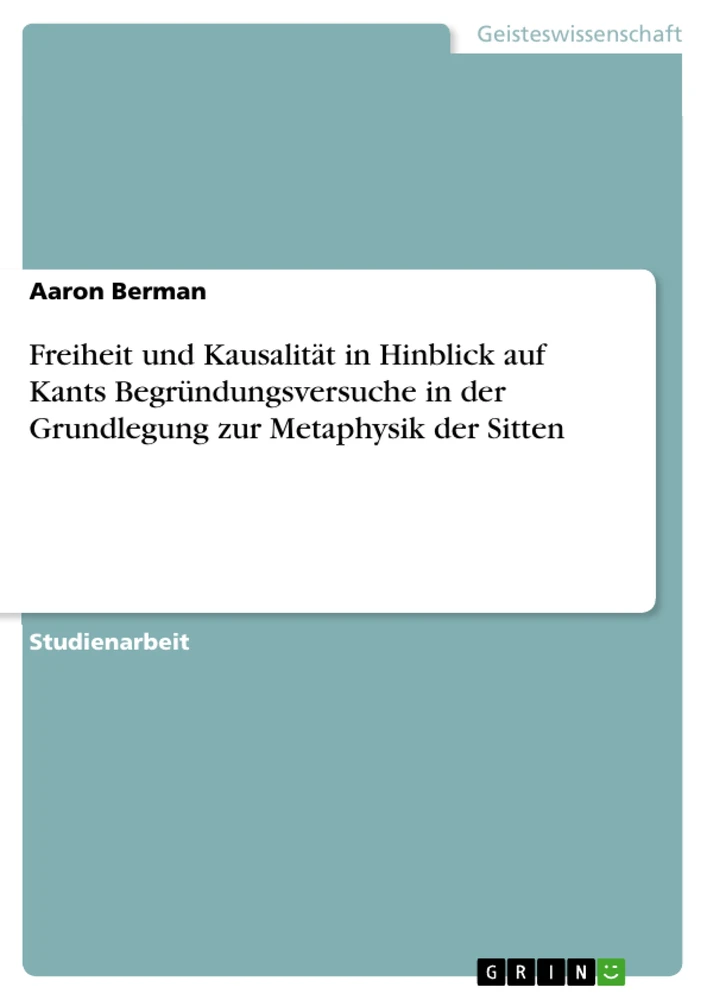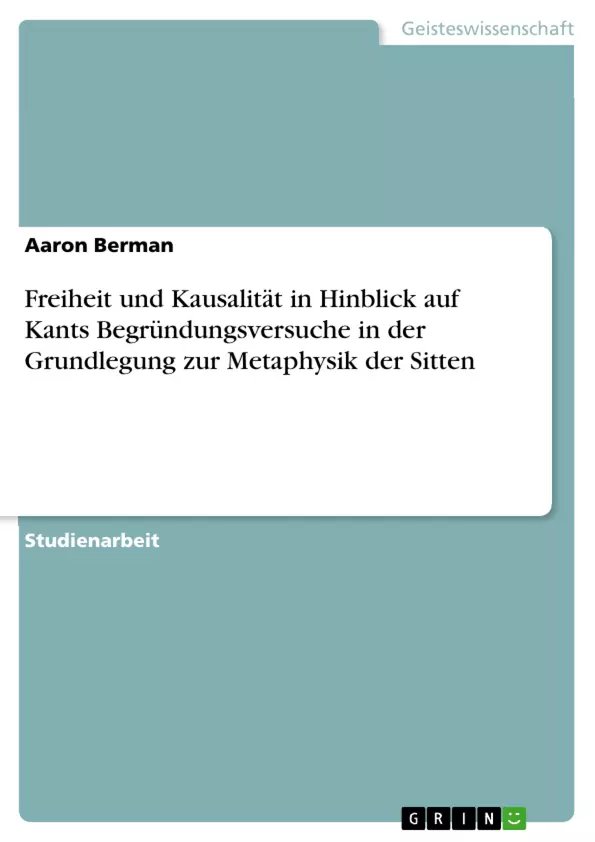Vorliegender Text rekonstruiert die Kantsche Deduktion des Begriffs der Moral, unter Rückgriff auf die Grundlagen der Metaphysik der Sitte und die Kritik der praktischen Vernunft.
Das in der vorliegenden Hausarbeit behandelte Problem von „Freiheit und Kausalität“ ist als Verhältnis von Selbstbestimmung und Determiniertheit von weitreichender philosophischer Brisanz.
Betrachtet man etwa das zur Zeit viel diskutierte Mind-body problem der Philosophy of mind deutet sich Kants Problem von Freiheit der Vernunft und Naturkausalität im Problem vom Verhältnis der mentalen Prozesse zum Körper ab und Thomas Nagels Fledermaus-Argument der nicht irreduziblen Erlebnisperspektive könnte sich inspiriert haben lassen von Kants Annahme eines notwendigen „Mehr“ als der bloßen Naturkausalität. (vgl GMS BA 119f) Nicht nur, aber vor allem auch in Kants eigener Moralphilosophie ist die Bestimmung der beiden Begriffe darüber hinausgehend von fundamentaler Bedeutung. Bloße und vollkommene Determiniertheit würde jedes moralische Handeln verunmöglichen einerseits, Kants Bestimmung des Sittengesetz als objektiv notwendig und universal erzwingt den Begriff der Gesetzmäßigkeit andererseits. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kants Antinomienlehre
- Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
- Werkimmanente Notwendigkeit der Freiheit in Kants GMS
- Die Kantsche Deduktion der Freiheit
- Von den äußersten Grenzen der praktischen Philosophie
- Ausblick: der Begriff des Gegebenen in der Kritik der praktischen Vernunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem komplexen Verhältnis von Freiheit und Kausalität im Kontext von Kants Moralphilosophie, insbesondere in seiner "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten". Ziel ist es, Kants Begründungsversuche für die Notwendigkeit der Freiheit im Rahmen seiner Moralphilosophie zu analysieren und die zentralen Argumente in Bezug auf das Problem der Kausalität zu beleuchten.
- Die Widersprüchlichkeit von Freiheit und Determiniertheit in Kants Antinomienlehre
- Die Notwendigkeit der Freiheit für die Begründung einer reinen praktischen Vernunft
- Die Deduktion der Freiheit in Kants "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten"
- Die Rolle des Begriffs "Gegebenheit" in Kants Kritik der praktischen Vernunft
- Der Primat des Praktischen in Kants Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit stellt das Problem von Freiheit und Kausalität als Kernfrage der Moralphilosophie vor und skizziert Kants Ansatz in der "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten".
- Kants Antinomienlehre: In diesem Kapitel wird Kants "dritter Widerstreit der transzendentalen Ideen" aus der "Kritik der reinen Vernunft" beleuchtet. Die Widersprüchlichkeit von Freiheit und Determiniertheit wird hier anhand von These und Antithese erörtert.
- Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: Dieses Kapitel widmet sich Kants "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" und untersucht die werkimmanente Notwendigkeit der Freiheit für die Begründung einer reinen praktischen Vernunft.
Schlüsselwörter
Freiheit, Kausalität, Determiniertheit, transzendentale Idee, Antinomie, "Kritik der reinen Vernunft", "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten", reine praktische Vernunft, Sittengesetz, Gegebenheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie löst Kant den Widerspruch zwischen Freiheit und Kausalität?
Kant unterscheidet zwischen der Welt der Erscheinungen (Naturkausalität) und der Welt der Dinge an sich, in der Freiheit als Selbstbestimmung der Vernunft möglich ist.
Warum ist Freiheit für Kants Moralphilosophie notwendig?
Ohne Freiheit gäbe es keine moralische Zurechnung; nur ein freies Wesen kann nach dem Sittengesetz handeln, das objektiv notwendig und universal ist.
Was ist der „dritte Widerstreit der transzendentalen Ideen“?
Es ist eine Antinomie in der „Kritik der reinen Vernunft“, die den Konflikt zwischen der Annahme einer Kausalität durch Freiheit und der reinen Naturgesetzlichkeit beschreibt.
Was bedeutet „Deduktion der Freiheit“ bei Kant?
Damit ist der Rechtfertigungsversuch gemeint, warum wir Freiheit als notwendige Voraussetzung für das Handeln vernünftiger Wesen annehmen müssen.
Welche Rolle spielt der Begriff „Gegebenheit“ in der Kritik der praktischen Vernunft?
Hier geht es um das „Faktum der Vernunft“, also die unmittelbare Gegebenheit des moralischen Gesetzes in uns, die uns unserer Freiheit bewusst macht.
- Quote paper
- Aaron Berman (Author), 2016, Freiheit und Kausalität in Hinblick auf Kants Begründungsversuche in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416111