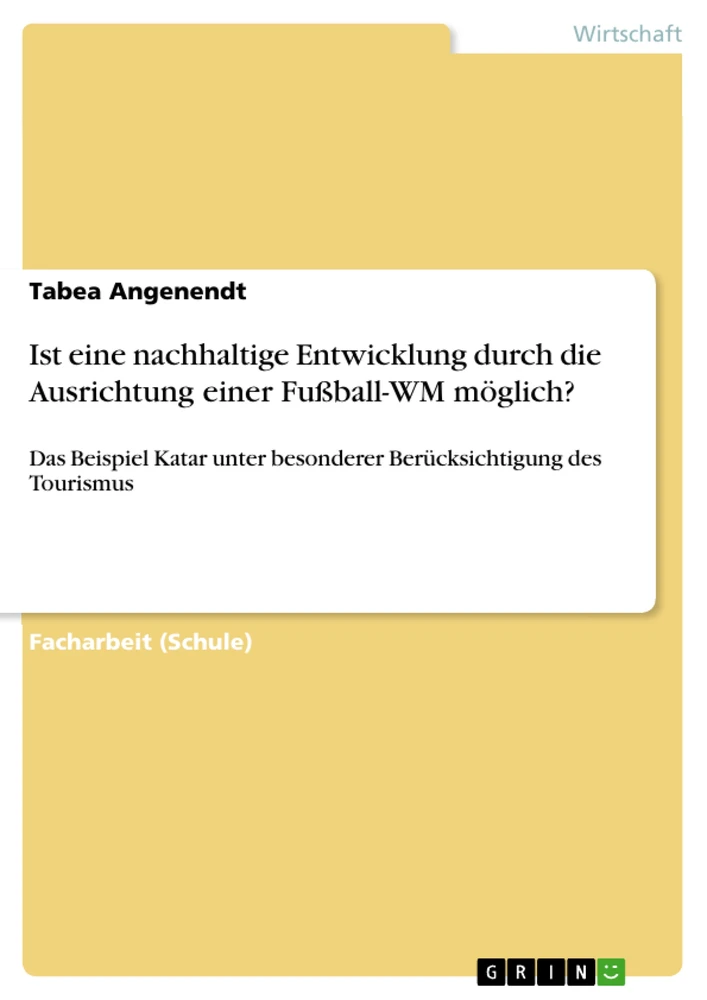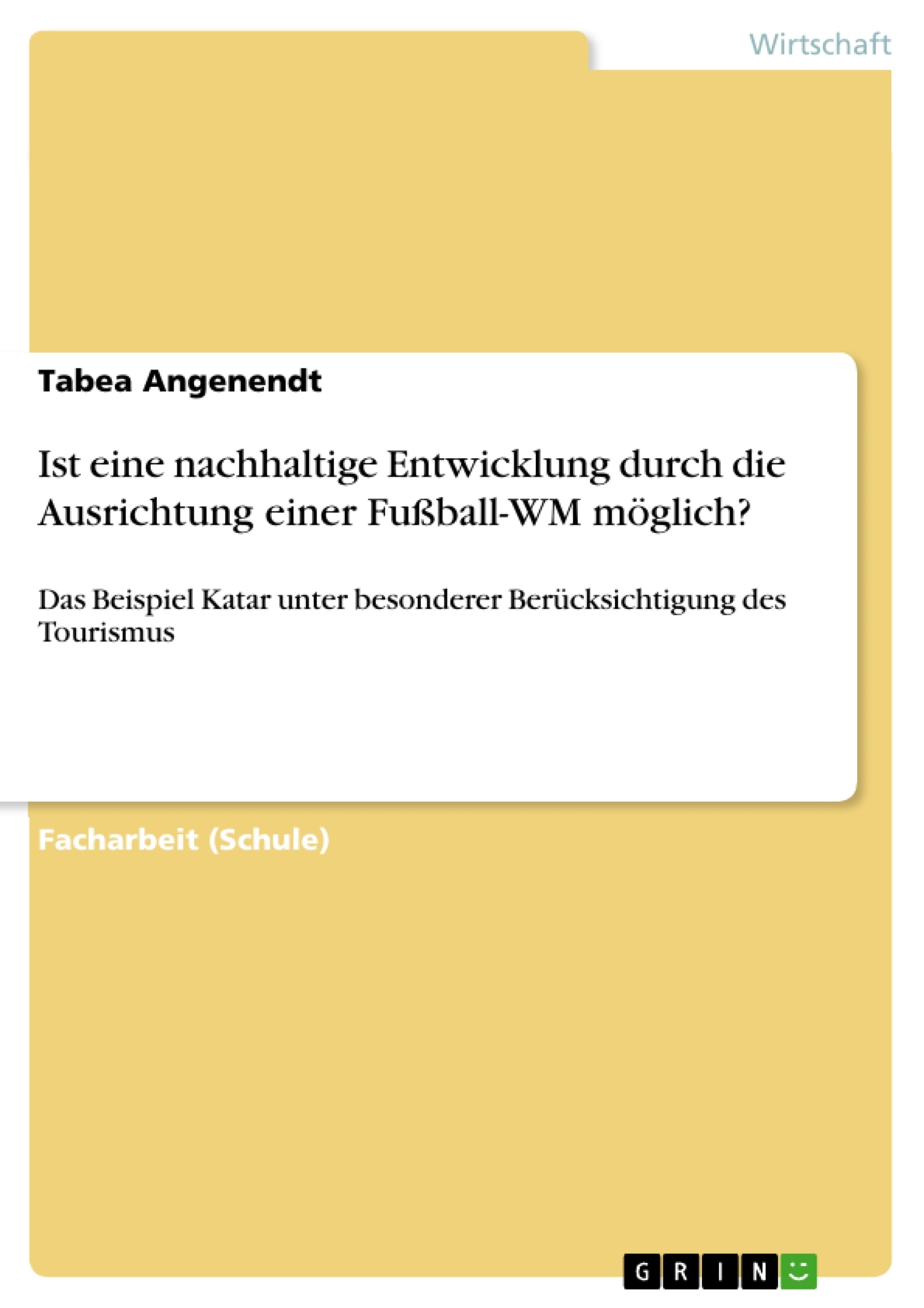Die Medien berichten immer wieder über die FIFA Weltmeisterschaft 2022. Auch als Nicht-Fußballfan wurde mein persönliches Interesse durch mediale Präsenz nur allzu oft auf das Thema WM und dessen Ausrichtung in Katar gelenkt. Dabei steht die Auswahl der Destination für dieses Sportgroßereignis im Fokus der Öffentlichkeit. Fest steht, dass die Fußballweltmeisterschaft 2022 eine polarisierende Sportveranstaltung ist. Die medialen Diskussionen missbilligen dabei das Auswahlverfahren für die Austragungsstätte bzw. des Austragungslandes. Mich hingegen interessiert eher die Frage der Auswirkungen ökonomischer, sozialer und ökologischer Art, welche durch ein solches populäres Sportgroßereignis wie die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft resultieren.
Ziel dieser Facharbeit ist es somit, zu klären, inwiefern die WM in Katar im konkreten Rahmen der Nachhaltigkeit positive und negative Effekte haben kann und wie diese zu gewichten sind. In meiner Fragestellung inbegriffen ist der Tourismus bzw. die touristische Nachfrage der Destination Katar simultan zu der Fußballweltmeisterschaft. Das lässt sich sehr gut mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit vereinbaren, denn so wird eruiert, welchen Nutzen der Tourismus während der WM für eine nachhaltige Entwicklung des Landes Katar haben kann.
In dieser Arbeit wird demnach die im Kern der Debatte stehende Fußball-Weltmeisterschaft 2022 thematisiert, Konsequenzen abgewogen, inwiefern eine anhaltende positive Entwicklung gefördert wird oder nicht. Auf der Grundlage der abzuleitenden Erkenntnisse ergeben sich mitunter auch mögliche Lektionen für andere FIFA WMs sowie Ansätze bezüglich der Übertragbarkeit der absehbaren Folgen auf andere Fälle, in denen eine Fußball-WM bereits stattgefunden hat oder noch stattfinden wird. Aus letzterem Grund ist diese Facharbeit von Relevanz, denn damit eine Fußball-WM das erfolgreiche Großevent bleibt, das von der Weltgemeinschaft bejubelt wird, sollte es intensiv vor- und nachbereitet werden. Auf diese Weise kann die Wiederholung bereits bekannter Fehler vermieden werden. Diese Facharbeit soll dazu einen kleinen Beitrag leisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Betrachtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit
- Ökonomische Dimension
- Soziale Dimension
- Ökologische Dimension
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Auswirkungen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf die nachhaltige Entwicklung des Landes, insbesondere im Hinblick auf den Tourismus. Das Ziel ist es, positive und negative ökonomische, soziale und ökologische Effekte zu identifizieren und gegeneinander abzuwägen.
- Ökonomische Auswirkungen der WM auf Katar und den Tourismussektor
- Soziale Folgen der WM für die Bevölkerung Katars
- Ökologische Belastung durch die WM und Möglichkeiten der Nachhaltigkeit
- Der Einfluss des Tourismus auf die nachhaltige Entwicklung Katars während und nach der WM
- Potenzielle Lehren aus der WM in Katar für zukünftige Großveranstaltungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ein und erläutert die Fragestellung der Arbeit. Der Fokus liegt auf den ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen des Events auf die nachhaltige Entwicklung Katars, wobei der Tourismus eine zentrale Rolle spielt. Die Arbeit zielt darauf ab, positive und negative Effekte zu identifizieren und zu bewerten, um daraus Lehren für zukünftige WM-Veranstaltungen zu ziehen.
Betrachtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit: Dieses Kapitel analysiert die WM 2022 in Katar im Kontext der Nachhaltigkeit, unterteilt in ökonomische, soziale und ökologische Dimensionen. Die ökonomische Dimension betrachtet die Auswirkungen auf den Tourismussektor, das Bruttoinlandsprodukt und die Investitionen. Die sozialen Aspekte befassen sich mit den Auswirkungen auf die Bevölkerung, während die ökologischen Folgen der hohen Besucherzahl und der Infrastruktur betrachtet werden. Der Kapitel analysiert verschiedene Quellen und Statistiken, um die komplexen Wechselwirkungen zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Nachhaltige Entwicklung, Fußball-Weltmeisterschaft, Katar, Tourismus, Ökonomische Dimension, Soziale Dimension, Ökologische Dimension, Bruttoinlandsprodukt (BIP), WM 2022, Positive und negative Effekte.
FAQ: Facharbeit zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar und nachhaltige Entwicklung
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht die Auswirkungen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf die nachhaltige Entwicklung des Landes, insbesondere im Hinblick auf den Tourismus. Sie analysiert die ökonomischen, sozialen und ökologischen Folgen der WM und bewertet positive sowie negative Effekte.
Welche Themen werden in der Facharbeit behandelt?
Die Arbeit betrachtet die ökonomischen Auswirkungen auf den Tourismussektor und das Bruttoinlandsprodukt, die sozialen Folgen für die Bevölkerung Katars und die ökologische Belastung durch die WM. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss des Tourismus auf die nachhaltige Entwicklung Katars während und nach der WM sowie auf potenziellen Lehren für zukünftige Großveranstaltungen.
Wie ist die Facharbeit strukturiert?
Die Facharbeit umfasst eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Betrachtung der WM 2022 unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit (unterteilt in ökonomische, soziale und ökologische Dimensionen), und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Dimensionen der Nachhaltigkeit werden betrachtet?
Die Facharbeit analysiert die ökonomische, soziale und ökologische Dimension der Nachhaltigkeit im Kontext der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die ökonomische Dimension umfasst beispielsweise die Auswirkungen auf den Tourismussektor und das BIP. Die soziale Dimension betrachtet die Folgen für die Bevölkerung, und die ökologische Dimension die Umweltbelastung durch die WM.
Welche Quellen werden in der Facharbeit verwendet?
Die bereitgestellte Vorschau nennt keine spezifischen Quellen. Die Zusammenfassung des Hauptkapitels erwähnt jedoch die Analyse verschiedener Quellen und Statistiken zur Beleuchtung der komplexen Wechselwirkungen zwischen der WM und der nachhaltigen Entwicklung Katars.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die bereitgestellte Vorschau enthält kein Fazit. Die Zusammenfassung der Einleitung deutet jedoch darauf hin, dass die Arbeit positive und negative Effekte identifizieren und bewerten wird, um daraus Lehren für zukünftige WM-Veranstaltungen zu ziehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Facharbeit?
Schlüsselwörter sind: Nachhaltige Entwicklung, Fußball-Weltmeisterschaft, Katar, Tourismus, Ökonomische Dimension, Soziale Dimension, Ökologische Dimension, Bruttoinlandsprodukt (BIP), WM 2022, Positive und negative Effekte.
- Quote paper
- Tabea Angenendt (Author), 2018, Ist eine nachhaltige Entwicklung durch die Ausrichtung einer Fußball-WM möglich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416149