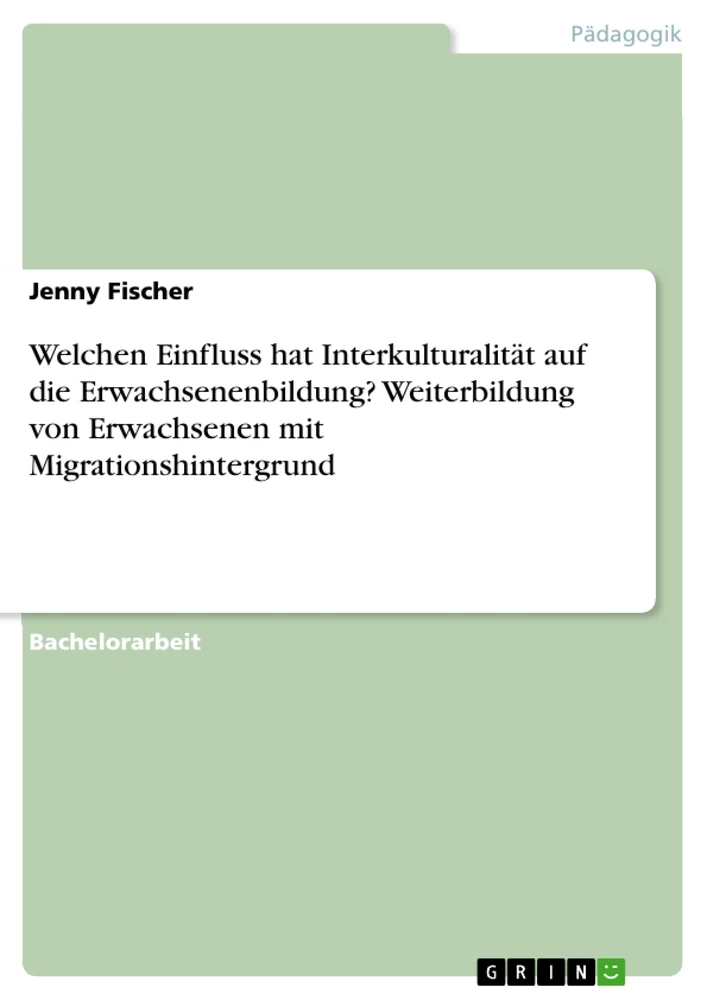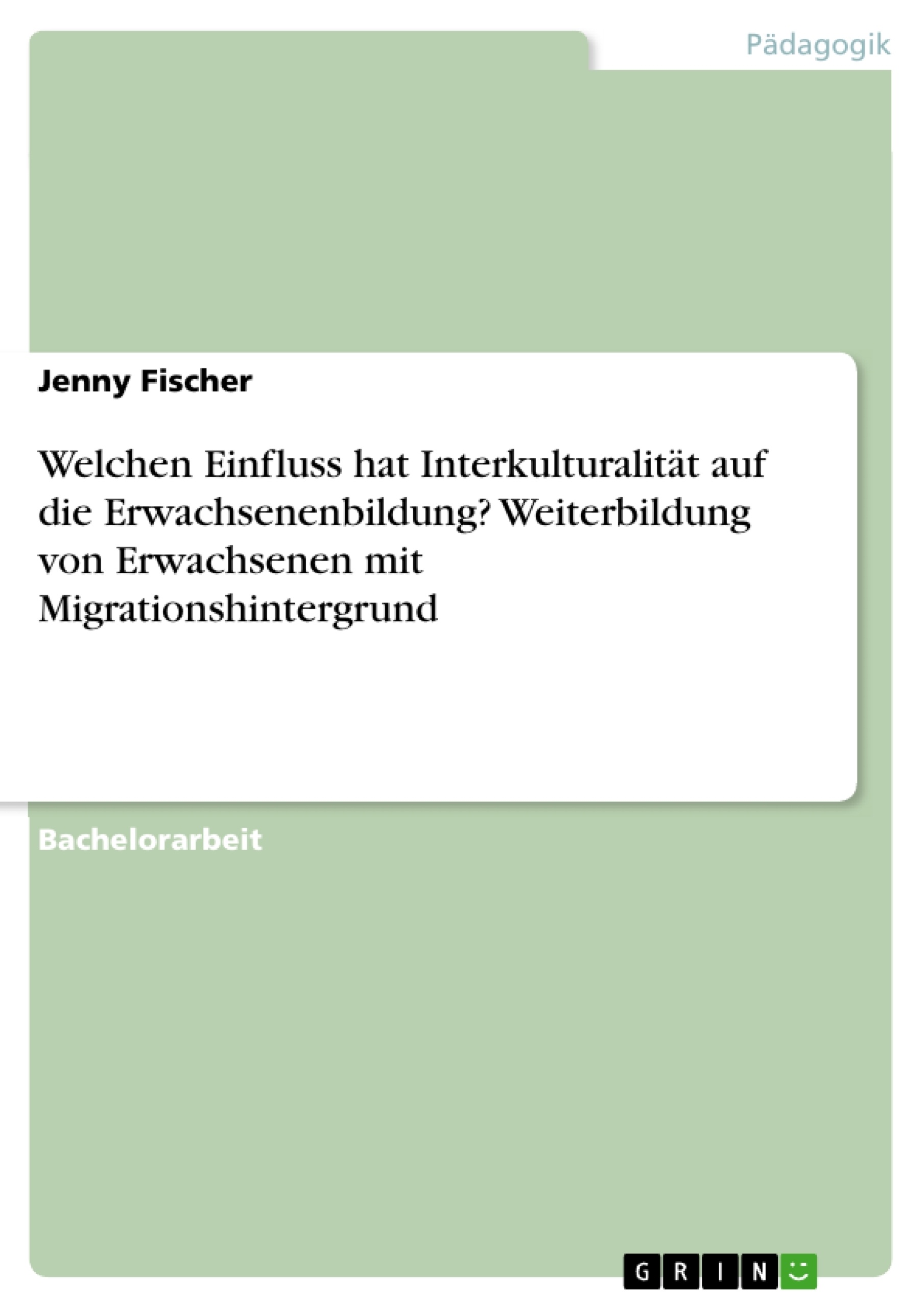In allen Bildungsbereichen wird zunehmend die Dringlichkeit der Förderung der interkulturellen Kompetenzen erkannt. Dies lässt auch die Erwachsenenbildung nicht unberührt. Mit der kulturellen Pluralisierung der modernen Gesellschaft ergibt sich die Notwendigkeit sich damit auseinanderzusetzen, wie mit kulturellen Unterschieden und deren Bedingungsfaktoren umzugehen ist.
Interkulturalität ist das neue Modewort. Die Suchmaschine „Google“ findet zur Suchanfrage „interkulturell“ 1.180.000 Treffer in nur 20 Sekunden. Bedingt wird dies durch die fortschreitende Globalisierung, sowie die Öffnung der Ländergrenzen. Deutlich wird es auch durch Slogans wie „global village“, die immer häufiger eingesetzt werden. Das Internet erlaubt die rasante Verbreitung von Nachrichten und die Kommunikation in weit entfernte Gebiete. Kulturbegegnungen durch Reisen hat es aber immer schon gegeben, genauso wie Migrationsbewegungen. Heute ist es aber um einiges leichter. „Internationales, ja globales Denken und Handeln werden gefordert. Diesem Trend kann sich unsere Gesellschaft und keiner, der in ihr lebt und arbeitet, mehr entziehen“.
Deutschland ist auch im Jahr 2013 das beliebteste Einwanderungsland. Menschen haben schon immer mit Interkulturalität und kultureller Vielfalt zu tun. Schon während den Kolonien, den internationalen Handelsbeziehungen, den Reisen und später den Geschäftsreisen wurden nationale Grenzen übertreten und interkulturell gehandelt. Doch erst heute, da das Aufeinandertreffen kultureller Vielfalten im Alltag nicht mehr wegzudenken ist, ist globales Denken und Handeln wichtiger denn je.
Die aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten stehen immer im globalen Kontext. Zunehmend mehr Menschen fragen sich, welche Auswirkung ihre Handlungen global ergeben. Doch die Frage für Deutschland ist, wie stellen sich die Menschen den Herausforderungen ein Einwanderungsland zu sein? Und wie kann man sie dabei unterstützen ihre Lebenssituation zu bewältigen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten der Arbeit
- Kulturelle Vielfalt
- Interkulturalität
- Interkulturelle Kompetenz
- Interkulturelle Kompetenzen in der Erwachsenenbildung
- Grundsätzliches zur Erwachsenenbildung
- Historischer Abriss der Erwachsenenbildung
- Definition der Erwachsenenbildung
- Bereiche der Weiterbildung
- Die Bildungsdimensionen
- Interkulturelle Projekte, Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten
- Projekt zur interkulturellen Kompetenz in der kulturellen Erwachsenenbildung
- Interkulturelle Öffnung und die Besonderheit ländlicher Strukturen
- Interkulturelle Kompetenz und Kulturelle Bildung für Fachkräfte im Elementarbereich
- Fehler und Lösungsmöglichkeiten bei der Erwachsenenbildung von Migranten
- Interkulturalität als Herausforderung für die Bildungsinstitutionen
- Kulturelle Vielfalt als Herausforderung an die Erwachsenenbildung
- Projekt zur interkulturellen Kompetenz in der kulturellen Erwachsenenbildung
- Institutionen der Bildungsforschung
- Der AES Trendbericht 2012
- Kulturelle Vielfalt in der Bildungsforschung am Beispiel der Hochschule
- Internationale Perspektiven der Erwachsenenbildung
- Internationaler Einfluss auf die Erwachsenenbildung
- Aktuelle Thematiken der internationalen Erwachsenenbildung
- Die Einflüsse des 21. Jahrhunderts
- Zielgruppenspezifische Erwachsenenbildung
- Neuzuwanderer
- Deutschförderung von Menschen mit Migrationshintergrund
- Pädagogische Rahmenbedingungen des ESF-BAMF Programms
- Entwicklungen seit 2008
- Praxisbeispiel des BAMF Konzepts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, einen Einblick in die Interkulturalität der Erwachsenenbildung zu geben. Sie behandelt die Notwendigkeit interkultureller Kompetenzen im Kontext der kulturellen Pluralisierung der modernen Gesellschaft. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Begriffsdefinitionen von kultureller Vielfalt, Interkulturalität und interkultureller Kompetenz, sowie deren Relevanz in der Erwachsenenbildung.
- Die Bedeutung von interkultureller Kompetenz in der heutigen Gesellschaft
- Die Herausforderungen der Interkulturalität für die Erwachsenenbildung
- Die Rolle von Institutionen der Bildungsforschung in der Interkulturellen Bildung
- Internationale Perspektiven der Erwachsenenbildung im interkulturellen Kontext
- Zielgruppenspezifische Erwachsenenbildung für Migranten und deren Einbindung in die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz von interkulturellen Kompetenzen in allen Bildungsbereichen, insbesondere in der Erwachsenenbildung, dar. Sie betont die Notwendigkeit des Umgangs mit kulturellen Unterschieden und deren Bedeutung in der globalisierten Welt.
- Begrifflichkeiten der Arbeit: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, darunter kulturelle Vielfalt, Interkulturalität und interkulturelle Kompetenz. Es beleuchtet die Komplexität dieser Begriffe und deren Verwendung in der wissenschaftlichen Diskussion.
- Grundsätzliches zur Erwachsenenbildung: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Erwachsenenbildung, einschließlich ihres historischen Abrisses, ihrer Definition, ihrer Bereiche und Bildungsdimensionen.
- Interkulturelle Projekte, Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten: Dieses Kapitel befasst sich mit konkreten Beispielen für interkulturelle Projekte in der Erwachsenenbildung und analysiert die damit verbundenen Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten. Es thematisiert insbesondere die Bedürfnisse von Migranten und die Entwicklung von entsprechenden Bildungskonzepten.
- Institutionen der Bildungsforschung: Dieses Kapitel stellt zwei relevante Institutionen der Bildungsforschung vor: den AES Trendbericht 2012 und eine Studie zur kulturellen Vielfalt an der Hochschule.
- Internationale Perspektiven der Erwachsenenbildung: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der internationalen Entwicklungen auf die Erwachsenenbildung und die damit verbundenen Herausforderungen.
- Die Einflüsse des 21. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beleuchtet die besonderen Herausforderungen, die die Globalisierung und der demographische Wandel für die Erwachsenenbildung darstellen.
- Zielgruppenspezifische Erwachsenenbildung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Bedürfnisse von Migranten und Neuzuwanderern und analysiert verschiedene Konzepte zur Deutschförderung und Integration.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themenfeldern der Interkulturalität und der Erwachsenenbildung. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören: kulturelle Vielfalt, Interkulturalität, interkulturelle Kompetenz, Migrationshintergrund, Deutschförderung, Integration, Bildungsforschung, internationale Erwachsenenbildung, Globalisierung, demographischer Wandel und Bildungskonzepte. Diese Begriffe beleuchten die vielfältigen Aspekte der Interkulturalität im Kontext der Erwachsenenbildung und verdeutlichen die Relevanz dieser Thematik für die Gesellschaft und die Bildungslandschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum braucht die Erwachsenenbildung interkulturelle Kompetenz?
Aufgrund der kulturellen Pluralisierung und Globalisierung müssen Bildungseinrichtungen lernen, professionell mit kulturellen Unterschieden umzugehen.
Was bedeutet Interkulturalität in der Bildung?
Es beschreibt den Austausch und das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen im Bildungsalltag sowie die Förderung von Verständnis und Integration.
Welche Herausforderungen haben Migranten in der Weiterbildung?
Herausforderungen liegen oft in Sprachbarrieren, fehlender interkultureller Öffnung der Institutionen und der Notwendigkeit zielgruppenspezifischer Angebote.
Was ist das ESF-BAMF Programm?
Es ist ein Programm zur Deutschförderung von Menschen mit Migrationshintergrund, das pädagogische Rahmenbedingungen für die berufliche Integration schafft.
Welchen Einfluss hat die Globalisierung auf die Bildung?
Globales Denken und Handeln werden zur Grundvoraussetzung, was neue Anforderungen an die Inhalte und Methoden der internationalen Erwachsenenbildung stellt.
- Quote paper
- Jenny Fischer (Author), 2014, Welchen Einfluss hat Interkulturalität auf die Erwachsenenbildung? Weiterbildung von Erwachsenen mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416220