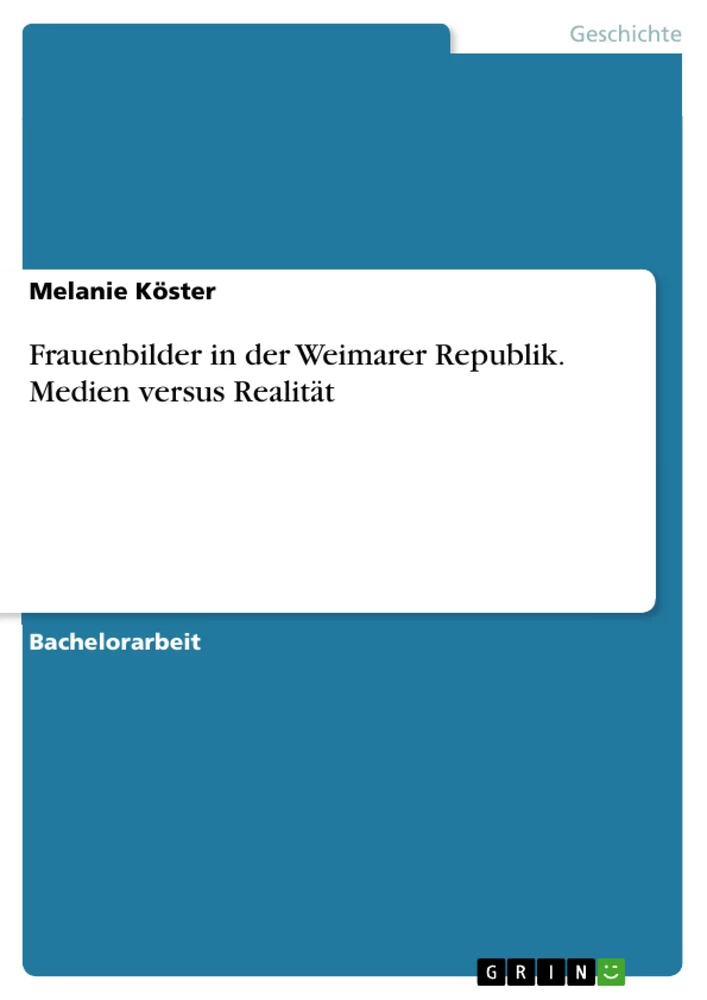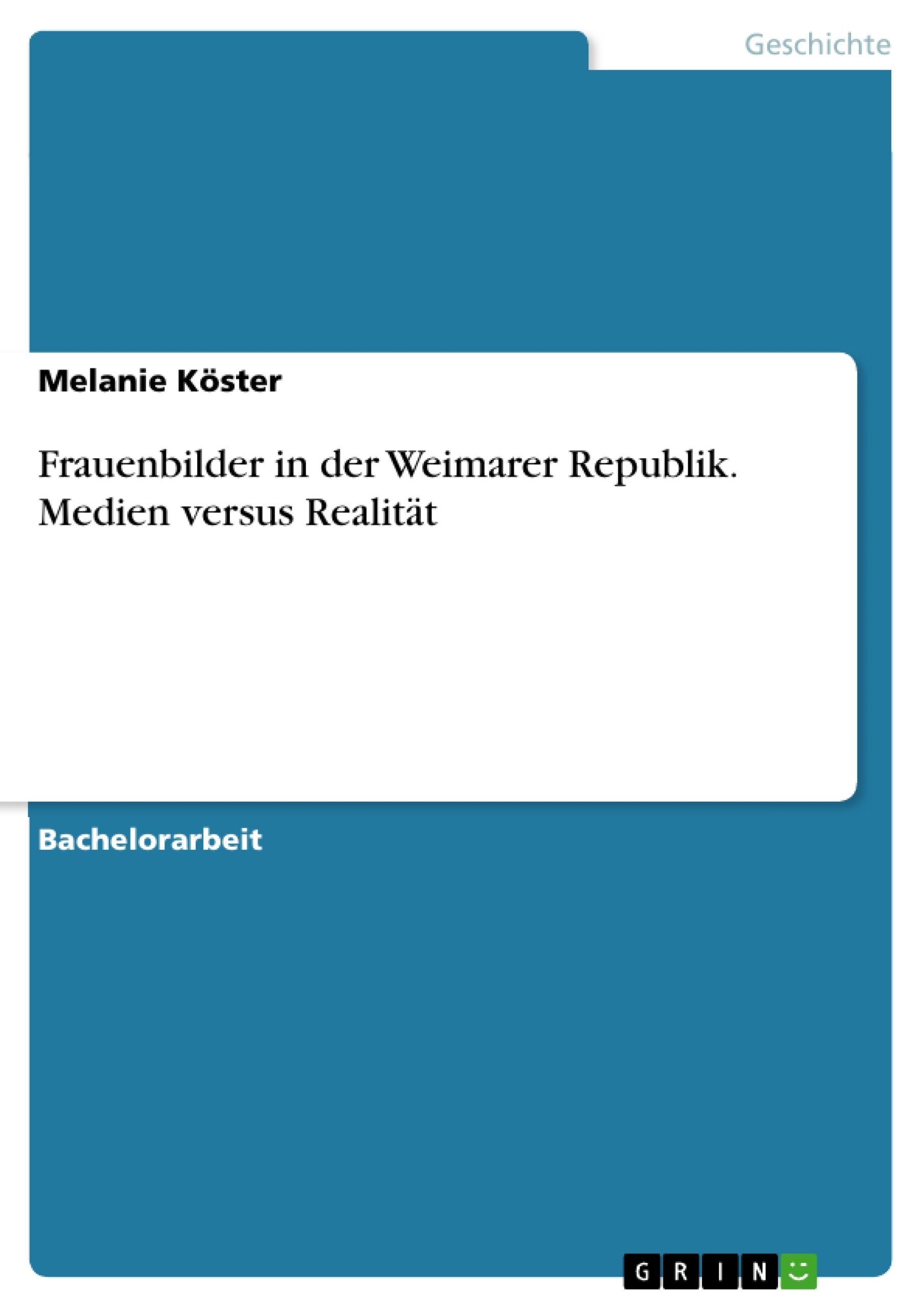Im Juli 1920 veröffentlichte die Zeitschrift "Die Dame" auf ihrer Titelseite eine Karikatur, die für das Frauenbild einer ganzen Zeit stehen sollte. In den zwanziger und frühen dreißiger Jahren verbreitete sich in Deutschland das nie dagewesene Ideal einer Frau, die unabhängig durch ihr Leben zu gehen scheint, beruflich erfolgreich und sich als "Vamp" selbstbestimmt nimmt, was sie will. Durch das eigene Auferlegen von typisch-männlichen Attributen zeigt sie provozierend, dass geschlechtsspezifische Vorurteile für sie keine Rolle spielen. Sie trägt den angesagten Bubikopf, fährt das Auto selbst, raucht und verdient ihr eigenes Geld in der Industrie, als Journalistin oder als schickes Tippfräulein.
In der vorliegenden Arbeit soll ein Frauenbild untersucht werden, zu dem die meisten Deutschen bis heute eine genaue Vorstellung haben, weil es mit seiner provokanten und attraktiven Weise immer noch fasziniert.Ich möchte herausfinden, warum die „Neue Frau“ in der Weimarer Republik soviel Aufmerksamkeit erfuhr und inwiefern sich dieses Bild, mit dem Erscheinungsbild und dem Lebensalltag der Frauen in der Zeit zwischen 1918 und 1933, deckt. Dabei werde ich meinen Fokus auf die Frauen in den deutschen Großstädten beschränken, da sich das neue Frauenbild vor allem hier durchsetzen ließ. Ein kleiner Exkurs über die demografischen Rahmenbedingungen, die Kultur - und Medienlandschaft der Zwischenkriegszeit sowie die Frauenbewegung soll aufzeigen, wie und weshalb sich das neue Frauenbild so rasant entwickeln konnte. Nachdem ein Überblick über das neue Frauenideal gegeben wird, welches von den Medien und der Werbeindustrie propagiert wurde, soll in dem darauffolgenden Abschnitt verglichen werden, inwiefern sich die Lebenswirklichkeit der Frauen in der Weimarer Republik mit dem neuen Bild deckte. Dazu wird zunächst untersucht, ob und wie es den Frauen gelang, die äußeren Merkmalen des neuen Ideals zu adaptieren und anschließend wird versucht zu erläutern, inwieweit die deutschen Großstadtfrauen die charakteristischen und objektiven Merkmale des Vamps, der Garçonne oder der Kameradin verkörperten. Dazu wird in verschiedenen Kategorien untersucht, wie emanzipiert, finanziell und gesellschaftlich unabhängig, gebildet und dem Mann überlegen oder zumindest gleichgestellt die durchschnittlichen Frauen der Weimarer Republik waren. Schließlich werde ich in einer Schlussfolgerung das Bild der „Neuen Frau“ als Konstruktion der Medienberichterstattung erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Voraussetzungen
- Demografische Rahmenbedingungen
- Weimars Unterhaltungskultur und Massenmedien
- Berlin als Zentrum der Moderne
- Die „neue\" Freizeit
- Massenmedien
- Die Frauenbewegung
- Das neue Frauenbild der zwanziger Jahre
- Zum Begriff der „Neuen Frau“
- Frauenbilder in der Weimarer Republik
- Vermarktung in der Weimarer Republik
- Neue Marketingstrategien und Massenkonsum
- Frauen in der Werbung
- Trends für die „Neue Frau“
- Die Realität der deutschen Frauen zum Vergleich
- Auf der Suche nach der äußeren Umsetzung des neuen Frauenbildes
- Mode und Frisur
- Körperwahn
- Die Lebenswirklichkeit der Frauen in der Weimarer Republik
- Frauen und Berufstätigkeit
- Frauen im Unterhaltungsbereich
- Eheleben
- Gesellschaftliche Kontroverse
- Auf der Suche nach der äußeren Umsetzung des neuen Frauenbildes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Frauenbild der Weimarer Republik, indem sie das medial vermittelte Bild der „Neuen Frau“ mit der Lebensrealität deutscher Frauen dieser Zeit vergleicht. Ziel ist es, die Entstehung und Verbreitung des neuen Frauenideals zu erklären und dessen Übereinstimmung mit der tatsächlichen Situation von Frauen zu analysieren.
- Das medial konstruierte Bild der „Neuen Frau“
- Die Rolle von Massenmedien und Werbung in der Gestaltung des Frauenbildes
- Der Einfluss der Frauenbewegung auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauen
- Der Vergleich zwischen medialem Bild und Lebensrealität deutscher Frauen
- Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Verhältnis zwischen dem medial vermittelten Bild der „Neuen Frau“ in der Weimarer Republik und der tatsächlichen Lebenswirklichkeit deutscher Frauen. Sie skizziert den Forschungsansatz, der den Fokus auf Großstadtfrauen legt, und benennt die relevanten Kontextfaktoren wie demografische Entwicklungen, die Medienlandschaft und die Frauenbewegung.
Voraussetzungen: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die demografischen Rahmenbedingungen der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg. Es beschreibt den Bevölkerungsrückgang, den hohen Anteil an Jugendlichen und den Geburtenrückgang. Weiterhin wird der Frauenüberschuss durch die hohen Kriegsverluste unter den Männern thematisiert, was die wirtschaftliche und soziale Situation der Frauen beeinflusste. Die Auswirkungen auf das Arbeitsmarkt und die gesellschaftliche Stimmung werden beleuchtet.
Das neue Frauenbild der zwanziger Jahre: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der „Neuen Frau“ als ein Idealbild, das in den Medien der Weimarer Republik propagiert wurde. Es wird untersucht, wie dieses neue Frauenbild von Unabhängigkeit, beruflichem Erfolg und Selbstbestimmung dargestellt wurde, und welche Rolle typisch männliche Attribute dabei spielten. Das Kapitel bildet die Grundlage für den Vergleich mit der Realität.
Vermarktung in der Weimarer Republik: Dieses Kapitel untersucht, wie das neue Frauenbild durch neue Marketingstrategien und Massenkonsum vermarktet wurde. Es analysiert die Rolle der Frauen in der Werbung und die Trends, die für die „Neue Frau“ propagiert wurden, um deren Image und den damit verbundenen Konsum zu fördern. Der Zusammenhang mit der Entwicklung des Frauenbildes wird deutlich herausgearbeitet.
Die Realität der deutschen Frauen zum Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht das medial konstruierte Bild der „Neuen Frau“ mit der tatsächlichen Lebenswirklichkeit deutscher Frauen in der Weimarer Republik. Es untersucht, inwieweit Frauen die äußeren Merkmale des neuen Ideals (Mode, Frisur) adaptierten und inwieweit sie die charakteristischen Merkmale des Vamps, der Garçonne oder der Kameradin verkörperten. Die Kapitel analysieren die berufliche Tätigkeit, die Ehesituation und die gesellschaftliche Stellung von Frauen und beleuchtet die gesellschaftlichen Kontroversen um die „Neue Frau“.
Schlüsselwörter
Neue Frau, Weimarer Republik, Frauenbild, Massenmedien, Werbung, Frauenbewegung, Emanzipation, Lebensrealität, Medienkonstruktion, Großstadt, Demografie, Gesellschaftliche Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Das Frauenbild in der Weimarer Republik"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Frauenbild der Weimarer Republik und vergleicht das medial vermittelte Bild der „Neuen Frau“ mit der tatsächlichen Lebenswirklichkeit deutscher Frauen dieser Zeit. Der Fokus liegt dabei auf der Entstehung und Verbreitung des neuen Frauenideals und dessen Übereinstimmung mit der Realität.
Welche Aspekte des Frauenbildes werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte des Frauenbildes, darunter das medial konstruierte Bild der „Neuen Frau“, die Rolle von Massenmedien und Werbung, den Einfluss der Frauenbewegung, den Vergleich zwischen medialem Bild und Lebensrealität, sowie die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Weimarer Republik.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Medien der Weimarer Republik, um das medial vermittelte Bild der „Neuen Frau“ zu rekonstruieren. Zusätzlich werden demografische Daten und soziokulturelle Kontextfaktoren berücksichtigt, um ein umfassendes Bild der Lebensrealität deutscher Frauen zu zeichnen. Die genauen Quellen werden im Haupttext detailliert aufgeführt (hier nur als Preview dargestellt).
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Voraussetzungen (demografische Rahmenbedingungen, Weimarer Unterhaltungskultur, Frauenbewegung), ein Kapitel zum neuen Frauenbild der zwanziger Jahre, ein Kapitel zur Vermarktung in der Weimarer Republik, und schließlich ein Kapitel, das das medial konstruierte Bild mit der Lebensrealität deutscher Frauen vergleicht (Berufstätigkeit, Ehesituation, gesellschaftliche Stellung etc.). Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und Schlüsselwörtern.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Neue Frau, Weimarer Republik, Frauenbild, Massenmedien, Werbung, Frauenbewegung, Emanzipation, Lebensrealität, Medienkonstruktion, Großstadt, Demografie und Gesellschaftliche Veränderungen.
Welche konkreten Themen werden innerhalb der einzelnen Kapitel behandelt?
Die Kapitel behandeln unter anderem: den Begriff der „Neuen Frau“, Frauenbilder in der Weimarer Republik, neue Marketingstrategien und Massenkonsum, Frauen in der Werbung, Trends für die „Neue Frau“, Mode und Frisuren der Zeit, Körperwahn, Frauen und Berufstätigkeit, Frauen im Unterhaltungsbereich, Eheleben, gesellschaftliche Kontroversen um die „Neue Frau“, Berlin als Zentrum der Moderne, die „neue“ Freizeit und Massenmedien der Weimarer Republik.
Welchen Vergleich stellt die Arbeit an?
Der zentrale Vergleich der Arbeit liegt zwischen dem idealisierten Bild der „Neuen Frau“, wie es in den Medien der Weimarer Republik präsentiert wurde, und der tatsächlichen Lebenswirklichkeit deutscher Frauen dieser Zeit. Es wird untersucht, inwieweit das medial konstruierte Ideal mit der Realität übereinstimmte oder davon abwich.
Für welche Zielgruppe ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich wissenschaftlich mit dem Frauenbild der Weimarer Republik auseinandersetzen möchten. Sie ist insbesondere für Studierende der Geschichtswissenschaft, Soziologie und Medienwissenschaft relevant, sowie für alle, die sich für die Geschichte der Frauen und der gesellschaftlichen Veränderungen im 20. Jahrhundert interessieren.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text dieser Arbeit ist [hier den Link zum vollständigen Text einfügen].
- Quote paper
- Melanie Köster (Author), 2016, Frauenbilder in der Weimarer Republik. Medien versus Realität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416300