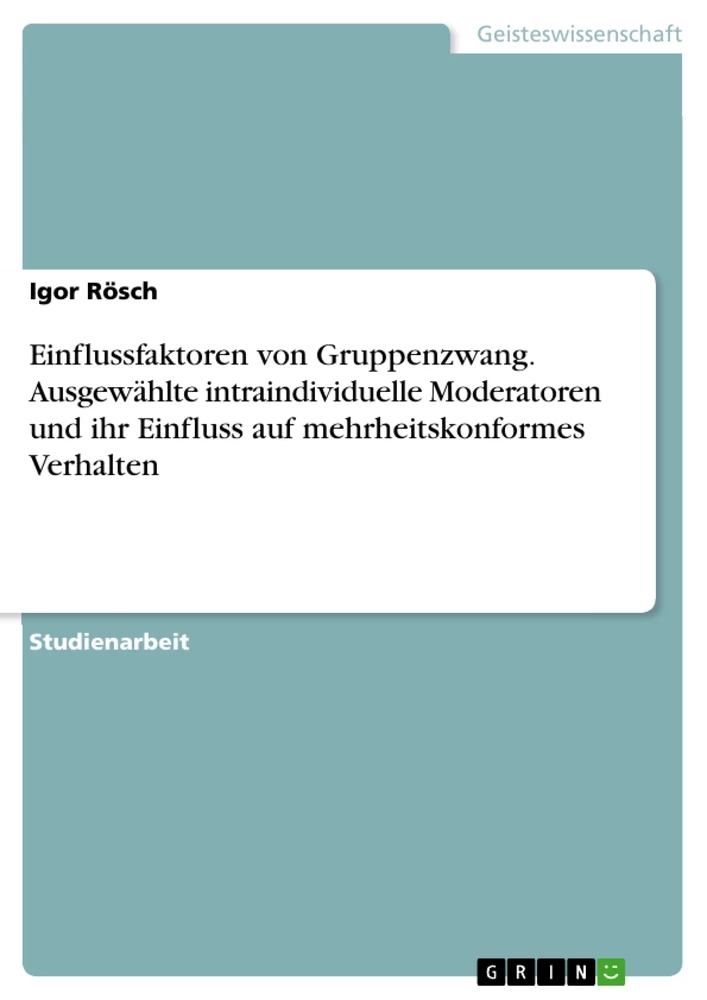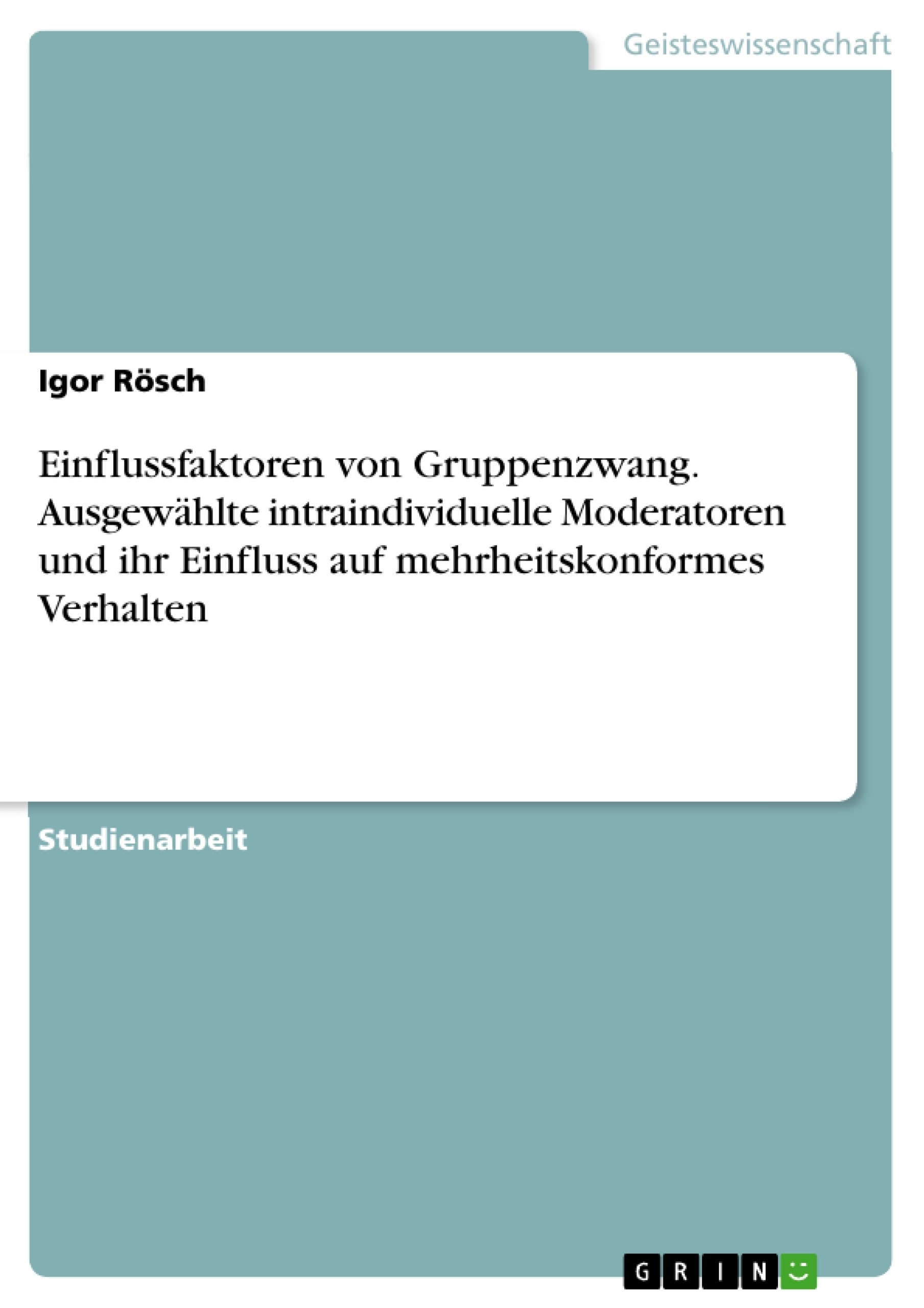Studien, die das Phänomen der Konformität in der Interaktion zwischen Mitgliedern einer Gruppe untersucht haben, fokussierten lange Zeit überwiegend auf externe Faktoren, die durch den Versuchsleiter oder, übertragen auf die Situation in Unternehmen, durch das Management gesteuert werden können. Dazu gehören Merkmale wie Gruppengröße- und zusammensetzung, die Versorgung der Gruppenmitglieder mit Information, Expertise in der Gruppe oder das Ausmaß an Autonomie, die den einzelnen Teammitgliedern gegeben wird. Andere Moderatoren, die in der Disposition des Einzelnen liegen und ungleich schwerer zu identifizieren sind, werden erst in jüngerer Zeit untersucht. Um anerkannte und aktuelle Forschungsergebnisse bestmöglich zu berücksichtigen, beschäftigt sich diese Arbeit mit drei ausgewählten intraindividuellen Merkmalen: Die kulturelle Prägung (1), der Umgang mit emotionalen Reaktionen (2) und die Neigung, sich mit anderen zu vergleichen (3). Ziel ist es, Hypothesen zu entwickeln, um untersuchen zu können, inwieweit diese personenbezogenen Faktoren die Neigung zur Konformität beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- I. Einleitung
- II. Stand der Forschung
- 1. Kulturelle Prägung
- 2. Umgang mit emotionalen Reaktionen
- 3. Neigung, sich mit anderen zu vergleichen
- III. Methoden
- IV. Diskussion
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, Hypothesen zu entwickeln, um die intraindividuellen Faktoren, die die Neigung zur Konformität beeinflussen, genauer zu untersuchen. Dabei werden insbesondere drei Merkmale betrachtet: die kulturelle Prägung, der Umgang mit emotionalen Reaktionen und die Neigung, sich mit anderen zu vergleichen.
- Kultureller Einfluss auf Konformitätsverhalten
- Bedeutung des Umgangs mit Emotionen für Konformität
- Einfluss des Vergleichsverhaltens auf die Neigung zur Konformität
- Intraindividuelle Moderatoren von mehrheitskonformem Verhalten
- Identifizierung von Faktoren, die Konformitätsverhalten beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Forschungsgeschichte zum Thema Konformität, beginnend mit den Experimenten von Solomon Elliott Asch. Es werden die zwei grundlegenden Bedürfnisse erläutert, die Konformitätsverhalten motivieren: die Reduzierung von Unsicherheit und die Vermeidung sozialer Sanktionen. Aschs Ergebnisse, die die Macht des Gruppendrucks aufzeigen, werden diskutiert, ebenso wie die Ergebnisse von Mori und Arai, die Aschs Studien replizierten. Anschließend werden verschiedene Forschungsschwerpunkte beleuchtet, die den Einfluss von Faktoren wie Gruppengröße, Beziehung zur Gruppe und Informationsverteilung auf Konformität untersuchen.
Der Abschnitt "Stand der Forschung" befasst sich mit drei intraindividuellen Einflussgrößen, die sich auf Konformität auswirken können: kulturelle Prägung, Umgang mit emotionalen Reaktionen und die Neigung, sich mit anderen zu vergleichen. Diese Faktoren lassen sich im Gegensatz zu externen Einflüssen wie Gruppengröße oder Informationsverteilung schwerer kontrollieren und bieten somit neue Herausforderungen für die Forschung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Einflussfaktoren von Gruppenzwang, insbesondere mit intraindividuellen Moderatoren, die die Neigung zum konformen Verhalten beeinflussen. Dabei werden die kulturelle Prägung, der Umgang mit emotionalen Reaktionen und die Neigung, sich mit anderen zu vergleichen, als zentrale Themen behandelt. Die Arbeit zielt darauf ab, diese Faktoren genauer zu untersuchen und ihre Auswirkungen auf mehrheitskonformes Verhalten zu beleuchten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind intraindividuelle Moderatoren von Konformität?
Dies sind Merkmale, die in der Person selbst liegen, wie kulturelle Prägung oder emotionale Reaktionen, im Gegensatz zu externen Faktoren wie der Gruppengröße.
Welche zwei Bedürfnisse motivieren konformes Verhalten?
Das Bedürfnis nach Reduzierung von Unsicherheit (informationaler Einfluss) und die Vermeidung von sozialen Sanktionen (normativer Einfluss).
Welchen Einfluss hat die kulturelle Prägung auf Gruppenzwang?
Die Arbeit untersucht, wie unterschiedliche kulturelle Hintergründe die Neigung eines Einzelnen beeinflussen, sich der Mehrheitsmeinung anzuschließen.
Wie wirkt sich das Vergleichsverhalten auf Konformität aus?
Die Neigung, sich ständig mit anderen zu vergleichen, kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, das eigene Verhalten an die Gruppe anzupassen.
Wer war Solomon Elliott Asch?
Ein Pionier der Sozialpsychologie, dessen Experimente in den 1950er Jahren zeigten, wie stark Gruppendruck Individuen dazu bringen kann, offensichtliche Fehlurteile zu übernehmen.
- Quote paper
- Dr. Igor Rösch (Author), 2018, Einflussfaktoren von Gruppenzwang. Ausgewählte intraindividuelle Moderatoren und ihr Einfluss auf mehrheitskonformes Verhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416944