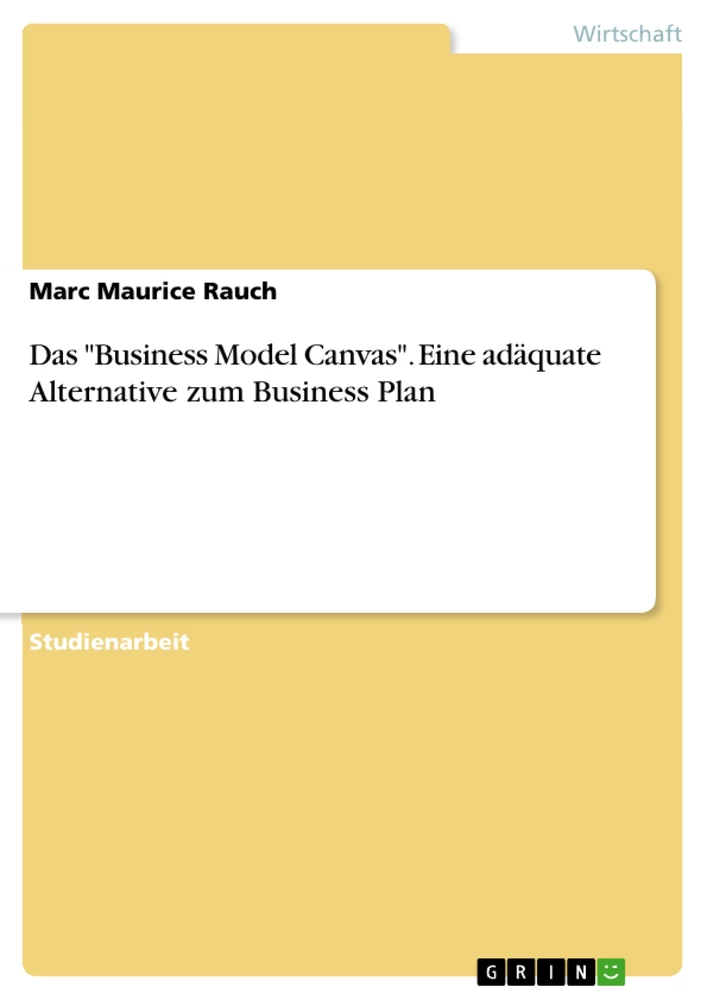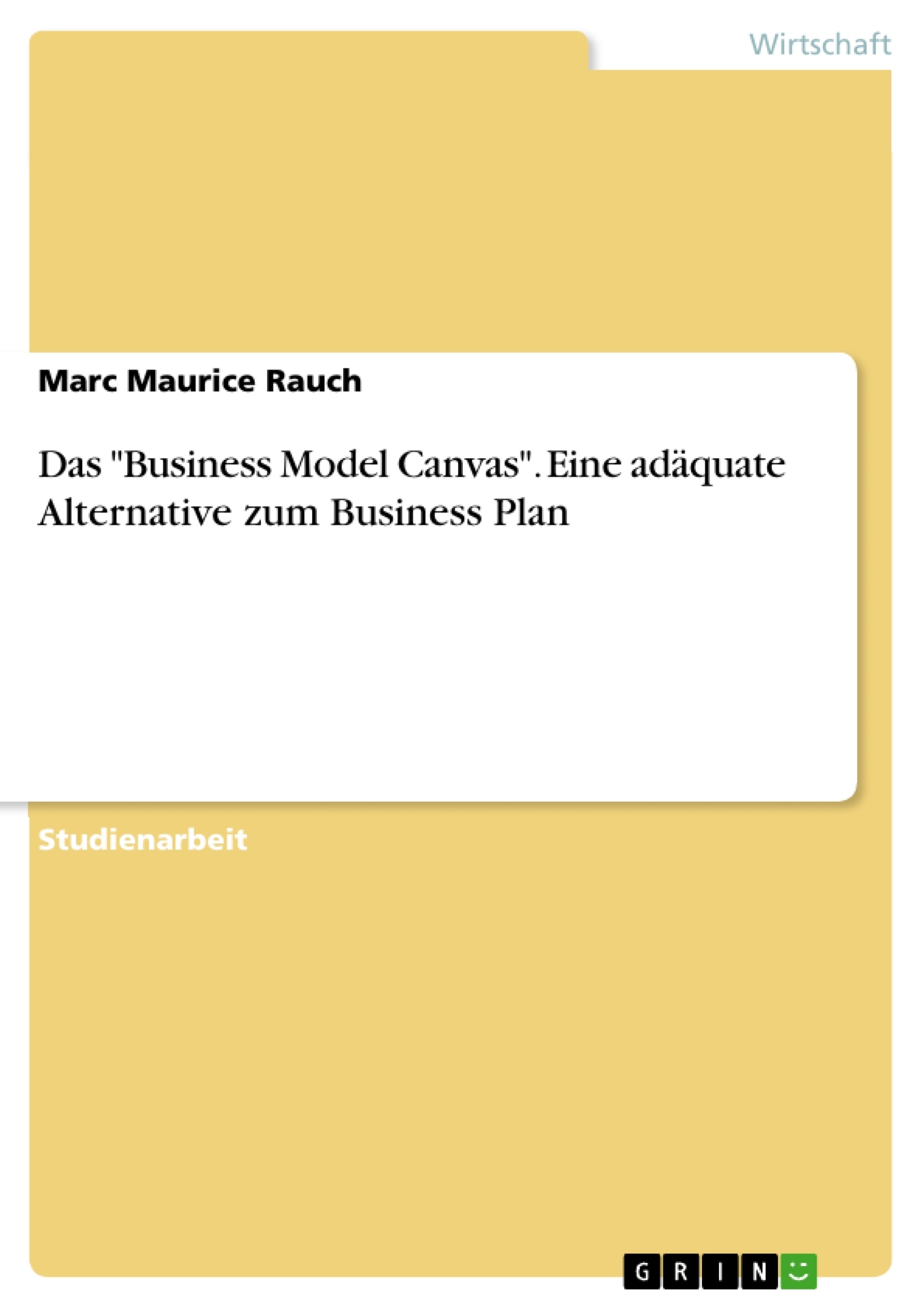Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, ob Business Model Canvas es schafft, als eine adäquate Alternative gegenüber herkömmlichen Geschäftsmodellkonzepten zu fungieren. Dabei werden die wesentlichen Punkte des Business Models Canvas dargestellt und auf ihre Funktionstüchtigkeit und Praxisrelevanz untersucht.
Hauptaugenmerk liegt auf dem Vergleich mit einem herkömmlichen Business Plan. Ferner werden die Begriffe Konzept-Innovation sowie das Geschäftsmodell und dessen Analyse näher beleuchtet. Schließlich findet ein Exkurs zum Mittelstand statt, in welchem die Vorteile von Business Model Canvas, am Beispiel der Digitalisierung, herausgearbeitet werden.
In dem zweiten Kapitel der Arbeit werden die Grundlagen beleuchtet, welche für die weitere Ausarbeitung und das Beantworten der Fragestellung essentiell sind. Dabei stehen die Begriffe Konzept-Innovation sowie das Geschäftsmodell und dessen Analyse im Mittelpunkt. Ziel hierbei ist es, zu verstehen, was eine Konzept-Innovation ist und welche zentralen Punkte dieser zu Grunde liegen. Bei dem Begriff des Geschäftsmodells wird zusätzlich, zu den bereits genannten Punkten, erläutert, warum das Geschäftsmodell die Prämisse für das erfolgreiche Bestehen eines Unternehmens ist und welchen strategischen Mehrwert ein fundiertes Geschäftsmodell bietet.
Im Dritten und damit auch dem Hauptabschnitt geht es um die Bedeutung und Implementierung von Canvas. Zu aller erst wird auf die zentralen Bestandteile des Business Models Canvas (BMC) eingegangen, um zu verstehen, wie es aufgebaut ist und die Anwendung erfolgt. Daraufhin stehen die Anwendungsgebiete von BMC im Zentrum, um herauszufinden, in welchen Feldern das Anwenden von Canvas einen Mehrwert bietet. Im dritten Segment wird der herkömmliche Businessplan mit dem Business Model Canvas verglichen und die wesentlichen Unterschiede werden herausgearbeitet.
Im vierten und damit letzten Schritt findet ein Exkurs zum Mittelstand statt, indem ich meine Auffassung darlege, wie in diesem Unternehmensumfeld BMC, am Beispiel der Digitalisierung, einen deutlichen Mehrwert bieten kann. Basierend auf der Ausarbeitung der Kapitel zwei und drei entsteht im letzten Kapitel dieser Arbeit das Fazit, welches die ursprüngliche Fragestellung wieder aufgreift und beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Gegenstand der Arbeit
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Grundlagen
- 2.1 Definition Konzept-Innovation
- 2.2 Das Geschäftsmodell und dessen Analyse
- 3. Canvas: Bedeutung und Implementierung
- 3.1 Business Model Canvas und seine Bestandteile
- 3.2 Anwendungsgebiete von Canvas
- 3.3 Canvas im Vergleich mit einem herkömmlichen Businessplan
- 3.4 Exkurs: BMC als Hilfestellung im Mittelstand
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob das Business Model Canvas eine adäquate Alternative zu herkömmlichen Geschäftsmodellkonzepten darstellt. Es werden die wesentlichen Punkte des Business Model Canvas dargestellt und auf ihre Funktionalität und Praxisrelevanz geprüft.
- Das Business Model Canvas als Alternative zu traditionellen Geschäftsmodellen
- Definition und Analyse von Konzept-Innovationen
- Bestandteile und Anwendungsgebiete des Business Model Canvas
- Vergleich des Business Model Canvas mit herkömmlichen Businessplänen
- Relevanz des Business Model Canvas für mittelständische Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Gegenstand der Arbeit: Dieses einführende Kapitel definiert die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der Eignung des Business Model Canvas als Alternative zu traditionellen Geschäftsmodellen. Es wird die Forschungsfrage formuliert und die Vorgehensweise, die in vier Kapitel gegliedert ist, skizziert. Die Kapitel zwei und drei bilden die Grundlage für das abschließende Fazit in Kapitel vier, welches die Forschungsfrage beantworten soll.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die weitere Analyse. Zunächst wird der Begriff der Konzept-Innovation definiert und von der Invention abgegrenzt. Die Bedeutung von Innovation für das wirtschaftliche Überleben von Unternehmen wird im Kontext der „schöpferischen Zerstörung“ nach Schumpeter erläutert. Anschließend wird das Geschäftsmodell als Grundlage für den Unternehmenserfolg definiert und analysiert, wobei die zunehmende Bedeutung in dynamischen Wettbewerbsumgebungen hervorgehoben wird. Die Vielzahl unterschiedlicher Definitionen für „Geschäftsmodell“ in der Literatur wird kurz angesprochen.
3. Canvas: Bedeutung und Implementierung: Der Hauptteil der Arbeit befasst sich mit dem Business Model Canvas (BMC). Es werden die zentralen Bestandteile des BMC detailliert beschrieben und seine Anwendung erläutert. Verschiedene Anwendungsgebiete des BMC werden vorgestellt, um seinen Mehrwert in unterschiedlichen Kontexten aufzuzeigen. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich des BMC mit traditionellen Businessplänen, der die jeweiligen Stärken und Schwächen herausarbeitet. Schließlich wird die besondere Bedeutung des BMC für mittelständische Unternehmen, z.B. im Kontext der Digitalisierung, diskutiert.
Schlüsselwörter
Business Model Canvas, Geschäftsmodell, Konzept-Innovation, Innovation, Businessplan, Mittelstand, Digitalisierung, Wettbewerbsvorteil, Markt, Schumpeter, Kreative Zerstörung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Business Model Canvas als Alternative zu traditionellen Geschäftsmodellen
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob das Business Model Canvas (BMC) eine geeignete Alternative zu herkömmlichen Geschäftsmodellen darstellt. Sie prüft die Funktionalität und Praxisrelevanz des BMC.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ist das Business Model Canvas eine adäquate Alternative zu herkömmlichen Geschäftsmodellkonzepten?
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Das BMC als Alternative zu traditionellen Geschäftsmodellen; Definition und Analyse von Konzept-Innovationen; Bestandteile und Anwendungsgebiete des BMC; Vergleich des BMC mit herkömmlichen Businessplänen; Relevanz des BMC für mittelständische Unternehmen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Gegenstand der Arbeit) definiert die Zielsetzung und Vorgehensweise; Kapitel 2 (Grundlagen) legt die theoretischen Grundlagen (Konzept-Innovation, Geschäftsmodell); Kapitel 3 (Canvas: Bedeutung und Implementierung) beschreibt detailliert das BMC, seine Anwendung und den Vergleich mit traditionellen Businessplänen; Kapitel 4 (Fazit) beantwortet die Forschungsfrage.
Was sind die zentralen Inhalte von Kapitel 2 (Grundlagen)?
Kapitel 2 definiert den Begriff der Konzept-Innovation, grenzt ihn von der Invention ab und erläutert die Bedeutung von Innovation im Kontext der „schöpferischen Zerstörung“ nach Schumpeter. Es analysiert das Geschäftsmodell als Grundlage für Unternehmenserfolg, insbesondere in dynamischen Wettbewerbsumgebungen.
Was sind die zentralen Inhalte von Kapitel 3 (Canvas: Bedeutung und Implementierung)?
Kapitel 3 beschreibt detailliert die Bestandteile des Business Model Canvas (BMC), erläutert seine Anwendung in verschiedenen Kontexten und vergleicht es mit traditionellen Businessplänen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Relevanz des BMC für mittelständische Unternehmen, z.B. im Kontext der Digitalisierung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Business Model Canvas, Geschäftsmodell, Konzept-Innovation, Innovation, Businessplan, Mittelstand, Digitalisierung, Wettbewerbsvorteil, Markt, Schumpeter, Kreative Zerstörung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Eignung des Business Model Canvas als Alternative zu traditionellen Geschäftsmodellen zu untersuchen und dessen Funktionalität und Praxisrelevanz zu prüfen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Die Arbeit ist relevant für alle, die sich mit Geschäftsmodellinnovation, dem Business Model Canvas und dem Vergleich verschiedener Geschäftsmodellkonzepte auseinandersetzen, insbesondere für Unternehmen im Mittelstand.
- Arbeit zitieren
- Marc Maurice Rauch (Autor:in), 2017, Das "Business Model Canvas". Eine adäquate Alternative zum Business Plan, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417802