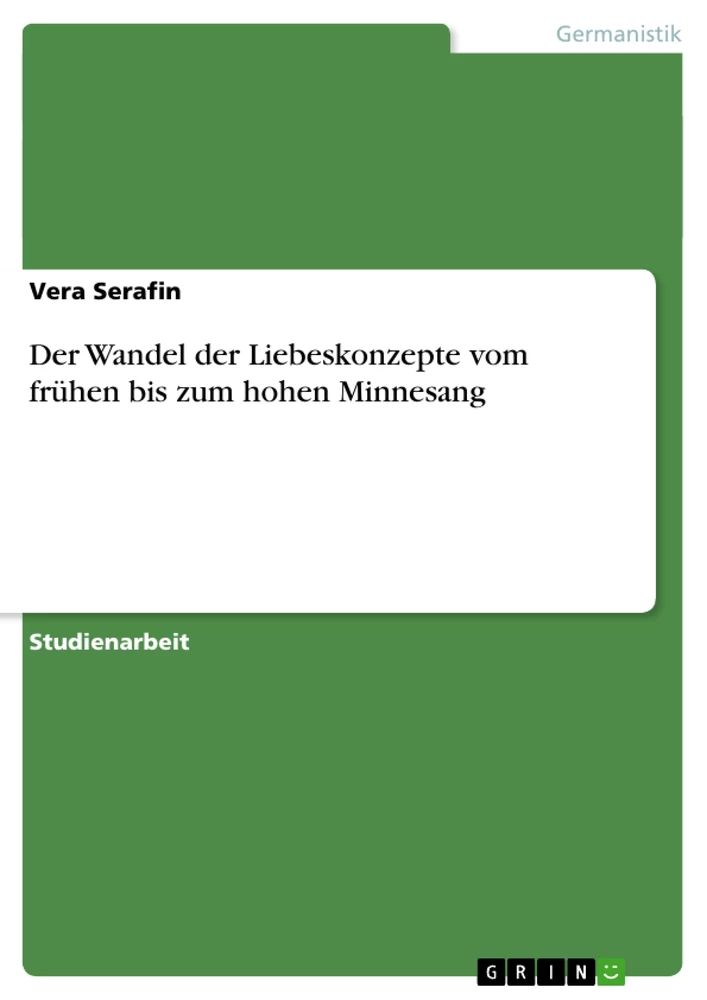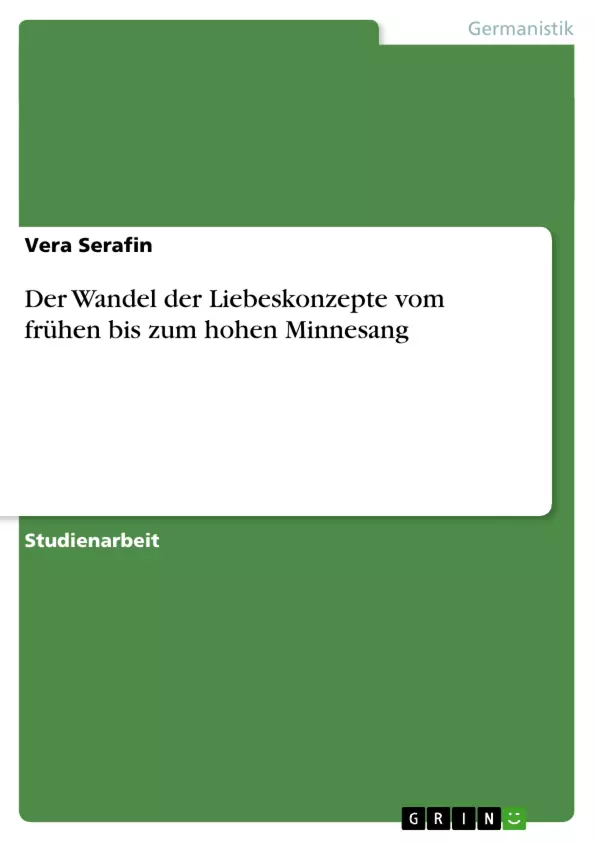Die unterschiedlichen Aspekte mittelalterlicher Minnekonzeption stellen ein beliebtes Thema der Forschungsliteratur dar. Hierbei reicht die Untersuchung von der Thematisierung von soziologischen sowie psychologischen Ansätzen zur Deutung der Dienstminne bis zu einer deutlichen Ethisierung der Liebe als veredelnder Kraft. Um die Frage nach der Liebeskonzeption des frühen und des hohen Minnesangs zu beantworten, soll in der vorliegenden Arbeit mit dem Thema „Der Wandel der Liebeskonzepte vom frühen bis zum hohen Minnesang“ die jeweilige Liebeskonzeption (als „die vom Autor intendierte Bewertung eines Liebesverhaltens“1) als Bestandteil einer Entwicklung betrachtet werden, die ihre Voraussetzungen zunächst in der Existenz des Minnesangs als höfischer Standesdichtung innerhalb einer bestimmten Gesellschaft samt der von ihr intendierten sozialen Regeln und Normen hat. Ausgehend von diesen Voraussetzungen sollen anschließend die Minnekonzeptionen des frühen und des hohen Minnesangs und deren Besonderheiten thematisiert werden, wobei dem Werk Dietmars von Aist in diesem Zusammenhang die Rolle des Übergangs zwischen beiden Konzeptionen zukommt. Dieser Sachverhalt relativiert zugleich die strenge Trennung zwischen frühem und hohem Minnesang.
Die vorliegende Arbeit stützt sich vor allem auf die Texte des Kürenbergers, Dietmars von Aist, Rudolf von Fenis, Friedrichs von Hausen, Reinmars des Alten sowie Heinrichs von Morungen, um die sich abzeichnenden Haupttendenzen der jeweiligen Minnekonzeption zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Voraussetzungen
- Die Minnekonzeption des frühen Minnesangs
- Geschlechterverhältnis, Emotionalität und sinnliche Beziehung beim Kürenberger
- Die Minnekonzeption Dietmars von Aist - Dietmars Werk als Übergang zum hohen Minnesang
- Natur als Spiegel der Minne
- Die Minnekonzeption des hohen Minnesangs
- Geschlechterverhältnis und Dienstminne
- Die Spiritualisierung der Minne
- Höfische Minne als Vorbild
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Liebeskonzeption vom frühen bis zum hohen Minnesang, wobei der Fokus auf der Entstehung und Veränderung der Minne als höfische Standesdichtung innerhalb einer bestimmten Gesellschaft liegt. Die Arbeit analysiert die Minnekonzeptionen des frühen und des hohen Minnesangs und untersucht die Besonderheiten jeder Epoche. Dabei wird das Werk Dietmars von Aist als Übergang zwischen beiden Konzeptionen betrachtet.
- Die Rolle der Minne im Kontext der höfischen Kultur des Mittelalters
- Die Entwicklung der Minnekonzeption vom frühen zum hohen Minnesang
- Die Bedeutung des Werks Dietmars von Aist als Übergang zwischen beiden Epochen
- Die Ausprägung des Geschlechterverhältnisses und der Dienstminne in den verschiedenen Epochen
- Die Spiritualisierung der Minne im hohen Minnesang
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Thematik und die Forschungsfrage der Arbeit, welche sich mit dem Wandel der Liebeskonzepte vom frühen bis zum hohen Minnesang beschäftigt. Die Arbeit betrachtet die Minnekonzeption als Bestandteil einer Entwicklung, die in der Existenz des Minnesangs als höfische Standesdichtung innerhalb einer bestimmten Gesellschaft mit ihren sozialen Regeln und Normen begründet ist.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Voraussetzungen für die Entstehung des Minnesangs. Es wird die weltliche Lyrik erotischen Inhalts im frühen Mittelalter sowie die Merkmale des Minnesangs im Vergleich zu anderen Liedformen wie den erotischen Brauchtumsliedern und Vagantenliedern analysiert. Die Bedeutung des Minnesangs innerhalb der höfischen Kultur und die Rolle der Frau als Allegorie unantastbarer Tugenden werden ebenfalls erörtert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Minnekonzeption des frühen Minnesangs. Es werden die Besonderheiten der Liebesbeziehung und das Geschlechterverhältnis anhand des Werks des Kürenbergers untersucht. Anschließend wird Dietmars von Aist als Übergang zum hohen Minnesang betrachtet und die Entwicklung der Minnekonzeption in seinem Werk analysiert. Das Kapitel schließt mit der Betrachtung der Rolle der Natur als Spiegel der Minne im frühen Minnesang.
Das vierte Kapitel behandelt die Minnekonzeption des hohen Minnesangs. Es werden das Geschlechterverhältnis und die Dienstminne im hohen Minnesang analysiert. Anschließend wird die Spiritualisierung der Minne und die Entwicklung der höfischen Minne als Vorbild in dieser Epoche untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf den Wandel der Liebeskonzeption im Minnesang, insbesondere auf die Entwicklung von der sinnlichen Liebe des frühen Minnesangs zur spirituellen Minne des hohen Minnesangs. Zu den zentralen Schlüsselbegriffen zählen: Minne, höfische Kultur, Geschlechterverhältnis, Dienstminne, Spiritualisierung, Kürenberger, Dietmar von Aist, Rudolf von Fenis, Friedrich von Hausen, Reinmar der Alte, Heinrich von Morungen.
- Quote paper
- Vera Serafin (Author), 2005, Der Wandel der Liebeskonzepte vom frühen bis zum hohen Minnesang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41834