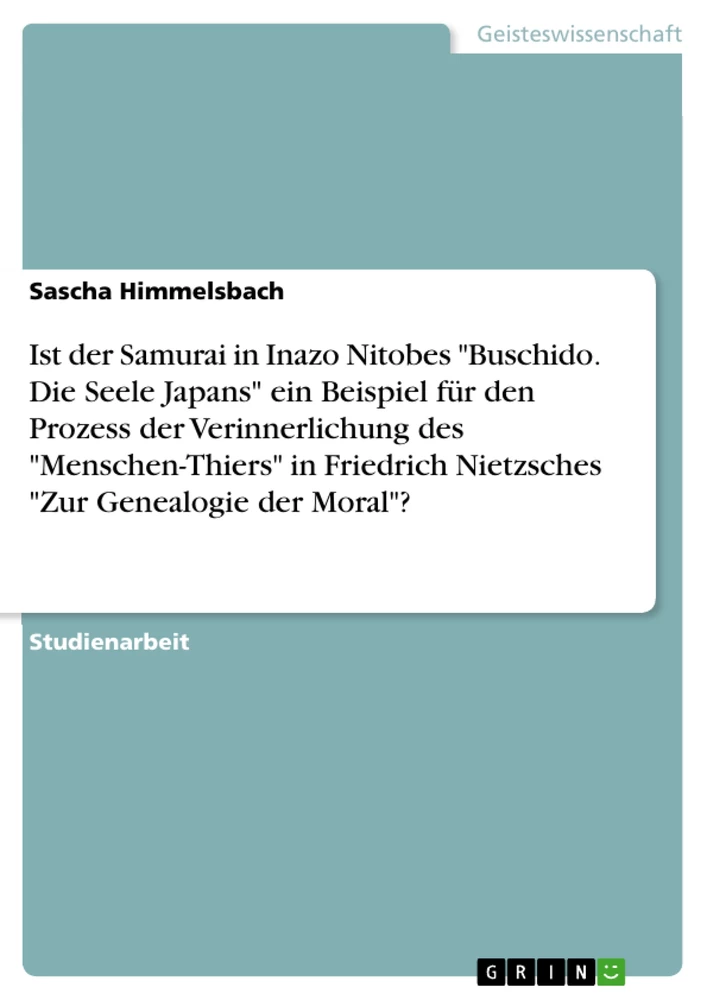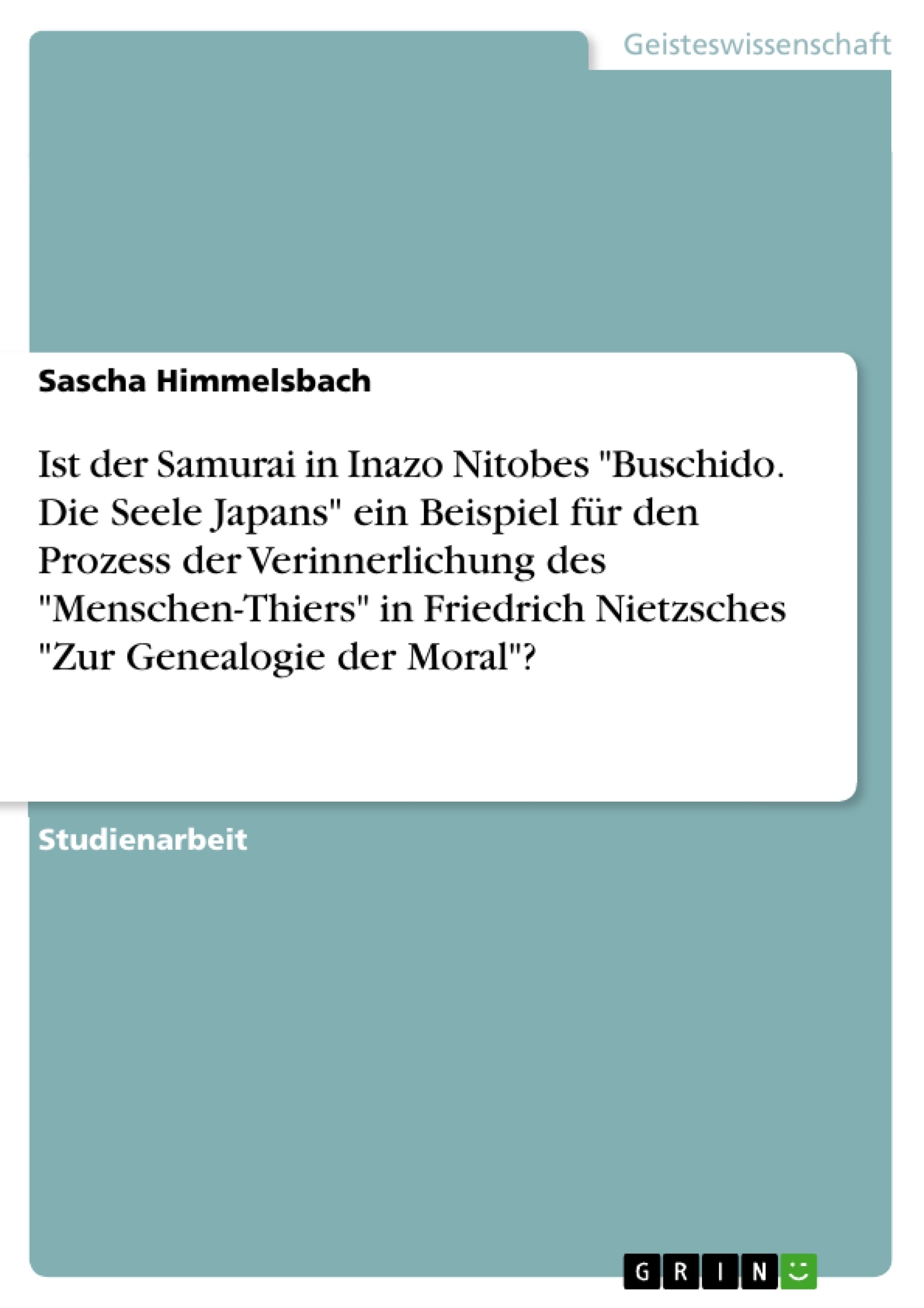Moralansichten des Einzelnen, Überzeugungen von Gemeinschaften, bis hin zu den heutzutage beinahe schon inflationär beschworenen westlichen Werten, die in jedem Europäer – was für Europäer in diesen Tagen direkt mit "jedem aufgeklärten Individuum" gleichzusetzen zu sein scheint, wenn man Talkshows, Zeitungsartikel oder bestimmte populistische Politiker verfolgt – zu "hausen" scheinen. Das Innenleben des Menschen, womit dieser Text immer die moralische Metapher, niemals den biologischen Aspekt meint, ist in der Gesellschaft aktueller denn je.
Manche religiösen Führer sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einer Notwendigkeit, beinahe einem nackten Kampf ums Überleben gleichkommend, solche moralischen Werte – wie auch immer diese geartet sein sollen – zu entwickeln.
Doch wie kam der Mensch überhaupt zu der Fähigkeit solch ein Innenleben beherbergen, geschweige denn reflektieren und an seine eigenen Bedürfnisse anpassen zu können? War der Prozess an sich als friedlich zu beschreiben, oder spielten gewisse Zwänge eine erwähnenswerte Rolle? Gab, beziehungsweise gibt, es zu diesem Vorgang der Verinnerlichung kulturabhängige Ansichten, die vielleicht nicht als deckungsgleich zu klassifizieren sind, sich aber dennoch mit dem gleichen Phänomen zu beschäftigen scheinen?
Mit diesen Fragen und weiteren Ausblicken wird sich die Seminararbeit auf den nächsten Seiten beschäftigen. Dabei werden zwei große philosophische Persönlichkeiten, aus verschiedenen Kulturen und ihre eigenen Schöpfungen zu Rate gezogen und hinsichtlich unserer Leitfrage – "Ist der Samurai von Inazo Nitobe ein geeignetes Beispiel für den Prozess der Verinnerlichung des Menschentiers in der 2. Abhandlung von "Zur Genealogie der Moral"?" – auf Gemeinsamkeiten und etwaige Unterschiede überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Samurai in Nitobes „Bushido - Die Seele Japans“
- Die Verinnerlichung des Menschenthiers in der 2. Abhandlung von „Zur Genealogie der Moral“
- Zusammenführung der Werke in Hinblick auf die Leitfrage
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Prozess der Verinnerlichung des Menschenthiers. Anhand des Beispiels des Samurais in Inazo Nitobes "Bushido - Die Seele Japans" wird die Frage untersucht, ob dieser ein geeignetes Beispiel für die in Friedrich Nietzsches "Zur Genealogie der Moral" beschriebene Verinnerlichung darstellt.
- Verinnerlichung des Menschenthiers
- Moralische Entwicklung und ihre kulturellen Prägungen
- Der Samurai als Repräsentant einer bestimmten Moralvorstellung
- Nietzsches Theorie der Genealogie der Moral
- Vergleich von Samurai-Ethik und Nietzsches Konzept
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Leitfrage der Seminararbeit vor und erläutert die Bedeutung des Themas Verinnerlichung des Menschenthiers im Kontext von Moralvorstellungen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie hebt die Wichtigkeit des Vergleichs zwischen dem Samurai und Nietzsches Theorie hervor.
Der Samurai in Nitobes „Bushido – Die Seele Japans“
Dieses Kapitel stellt den Autor Inazo Nitobe und sein Werk "Bushido - Die Seele Japans" vor. Es beleuchtet Nitobes multikulturelles Leben und seine Perspektive auf die Samurai-Ethik. Der Fokus liegt auf den Einflüssen von Buddhismus, Konfuzius und Shintoismus auf die Lebensweise der Samurai und wie diese durch die Ablösung des Feudalismus eine Verinnerlichung ihrer Werte erlebten.
Die Verinnerlichung des Menschenthiers in der 2. Abhandlung von „Zur Genealogie der Moral“
Dieses Kapitel widmet sich der zweiten Abhandlung von Nietzsches "Zur Genealogie der Moral" und seiner Theorie der Verinnerlichung des Menschenthiers. Es beleuchtet Nietzsches Ansatz, die Entstehung von Moral und Werten zu erklären, und bietet Einblicke in die psychologischen und sozialen Mechanismen der Verinnerlichung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Seminararbeit sind Verinnerlichung, Menschenthier, Moral, Samurai, Bushido, Nietzsche, Genealogie der Moral, Feudalismus, Japan, Kulturvergleich, Ethik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Verinnerlichung des Menschenthiers" bei Nietzsche?
In "Zur Genealogie der Moral" beschreibt Nietzsche den Prozess, durch den äußere Zwänge und soziale Normen in das Innenleben des Menschen verlagert werden, was zur Entstehung von Gewissen und Moral führt.
Wie stellt Inazo Nitobe den Samurai dar?
Nitobe beschreibt in "Bushido - Die Seele Japans" den Samurai als Träger eines strengen Ehrenkodex, der durch Buddhismus, Konfuzianismus und Shintoismus geprägt ist und tief verinnerlichte Werte verkörpert.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dem Bushido und Nietzsches Moraltheorie?
Ja, die Seminararbeit untersucht, ob die Disziplinierung und die moralische Strenge der Samurai als ein praktisches Beispiel für Nietzsches theoretisches Konzept der Verinnerlichung gelten können.
Welche Rolle spielte der Feudalismus für die Moral der Samurai?
Die feudale Struktur Japans schuf die äußeren Zwänge, die später in den Bushido-Kodex einflossen. Mit dem Ende des Feudalismus mussten diese Werte im Individuum verankert bleiben.
Ist der Prozess der Verinnerlichung kulturabhängig?
Die Arbeit prüft, ob westliche Konzepte (Nietzsche) und japanische Traditionen (Nitobe) sich trotz kultureller Unterschiede mit dem gleichen psychologischen Phänomen der Moralentwicklung beschäftigen.
- Citar trabajo
- Sascha Himmelsbach (Autor), 2016, Ist der Samurai in Inazo Nitobes "Buschido. Die Seele Japans" ein Beispiel für den Prozess der Verinnerlichung des "Menschen-Thiers" in Friedrich Nietzsches "Zur Genealogie der Moral"?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418762