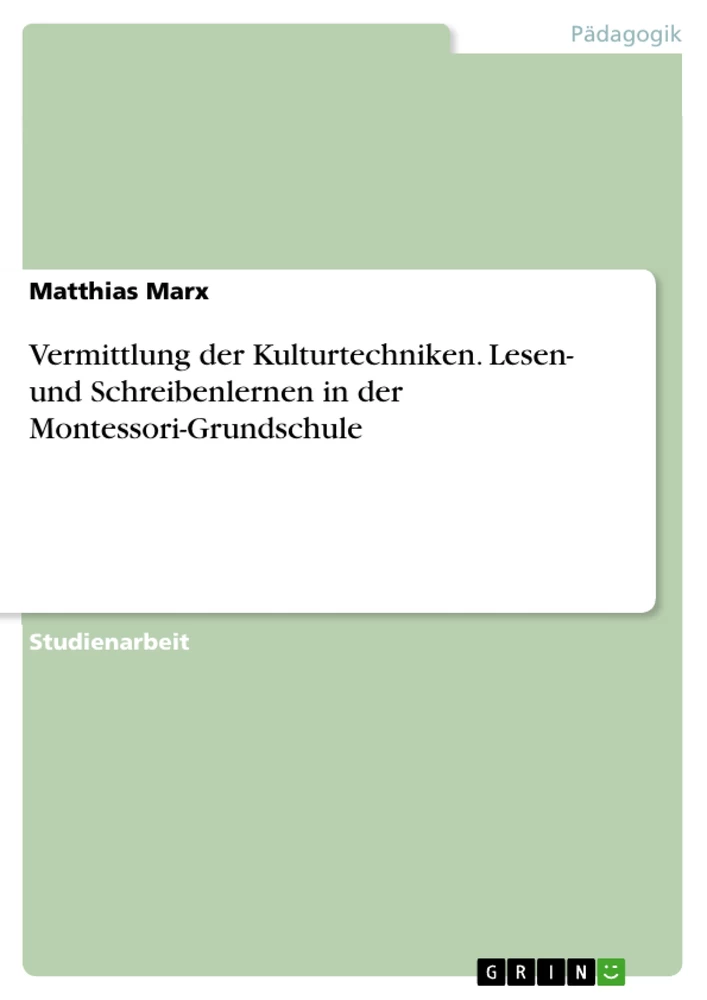„Lesen- und Schreibenlernen in der Montessori-Grundschule“: Ich widme mich dieser Themenstellung im Zuge meiner Hausarbeit aus mehreren Beweggründen. Zuallererst findet sich in einer anfänglichen Auseinandersetzung mit der Pädagogik Montessoris wenig Ausführliches zu einer konkreten Ausgestaltung der Sprachbildung im Primarbereich. Vielmehr staunt man über die Vielfalt der Didaktischen Materialien zur Mathematik, wie beispielsweise dem Wurzelbrett. Zudem ist auch in der Lehrerbildung für den Grundschulbereich ein sehr elementarer Bereich für die Wissenschaft des Schriftspracherwerbs vorgesehen, was mich zu der Frage führt, ob SchülerInnen und Schüler mit ausreichend Didaktischem Material dazu in der Lage sein können, ihre „eigene Wissenschaft des Schriftspracherwerbs“ zu entwerfen und aufgezwungene Schubladensysteme (zum Beispiel in Bezug auf standardisierte Kompetenzmodelle) zu überwinden. Als besonders interessant erscheint mir auch das immer wiederkehrende Vorurteil, dass gewisse Unterrichtsgegenstände eine mehr oder minder geschlossene Lehrform einfordern würden. Dieses Vorurteil findet man im Schriftspracherwerb dann beispielweise im Hinblick auf grammatikalisch korrekte Formulierungen, genormte Schriftbilder sowie Kinder, die sich erst ab der dritten Jahrgangsstufe für Schrift interessieren.
Wegen unter anderem den oben genannten Gründen möchte ich mich tiefer mit dem Schriftspracherwerb in der Montessoripädagogik auseinandersetzen. Dabei wird sich diese Arbeit in einer theoretischen Form (unter Einbezug des Gedankenguts von Maria Montessori) dem Thema annähern und soll auch mit praktischen Beispielen komplettiert werden. Abschließend werde ich mich an ein persönliches Fazit wagen, inwieweit der Weg zum Schreiben- und Lesenlernen in der Montessoripädagogik für Schülerinnen und Schüler eine wertvolle Alternative zum Schriftspracherwerb in der Regelschule darstellen kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Konkretisierung
2.1. Bedeutung von Sprache
2.2. Sprachlektion & Dreistufenlektion
2.3. Schreiben – und Lesenlernen
2.3.1. Schreiben
2.3.2. Lesen
2.4. Weiterführender Deutschunterricht
3. Praktische Annäherung
3.1. Didaktisches Material
3.2. Praktisches Beispiel
4. Fazit
5. Quellenverzeichnis
5.1. Literaturquellen
5.2. Bildquellen
-
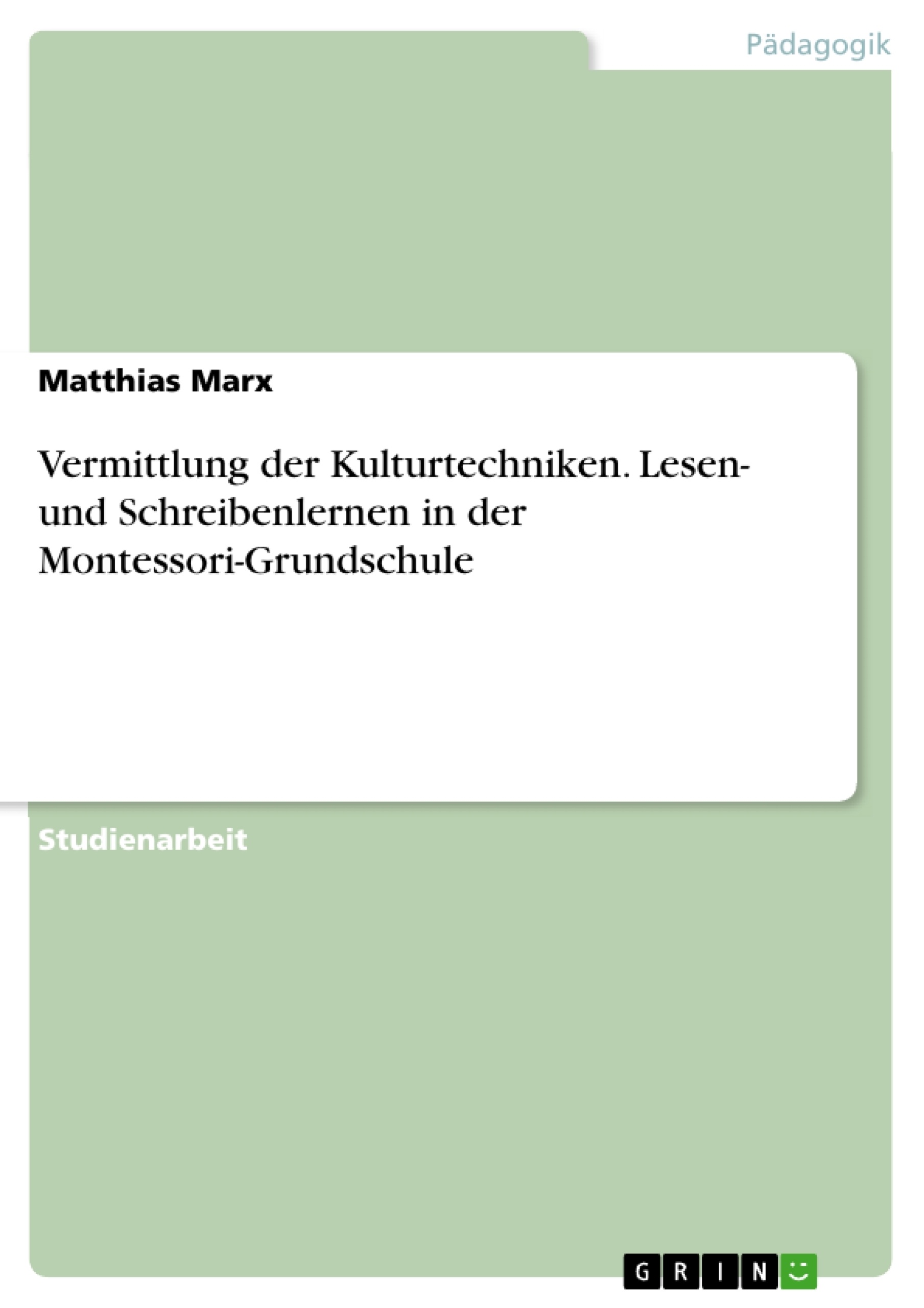
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.