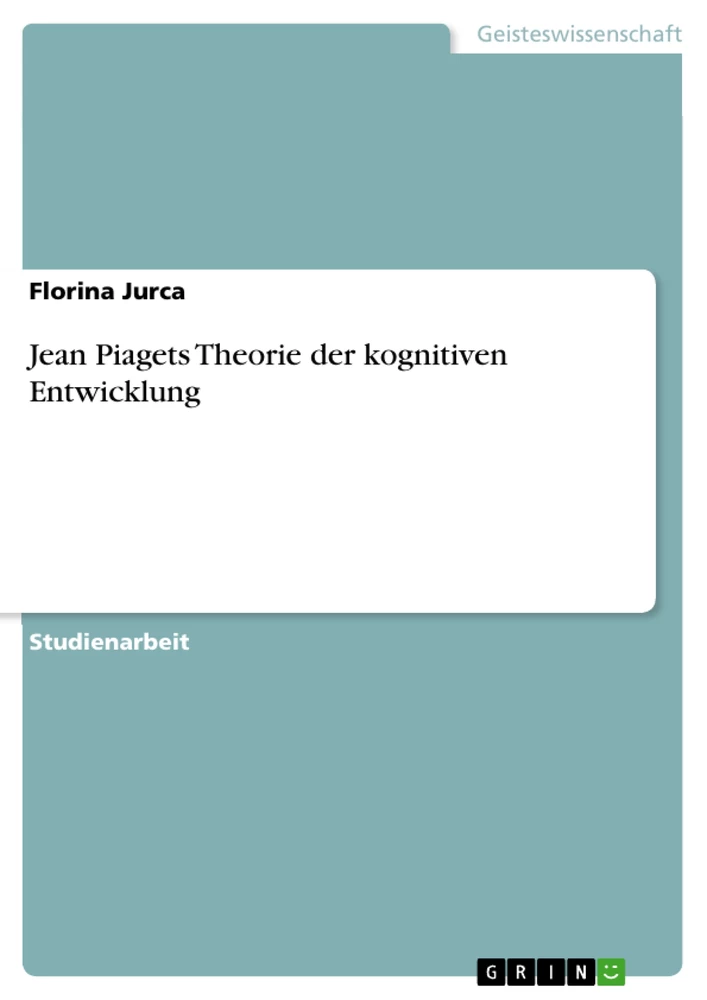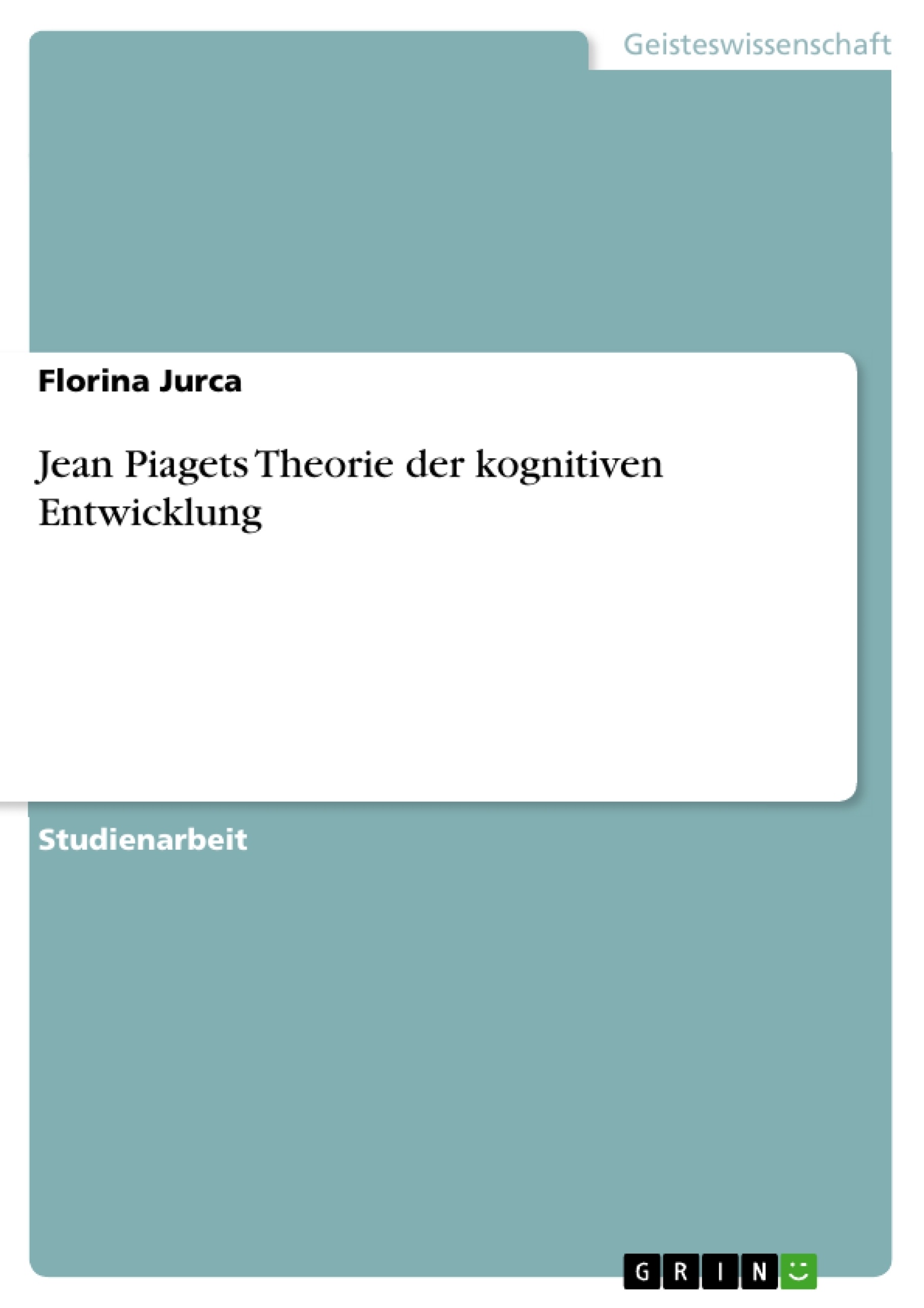A. Hinführung: Piagets Theorie im entwicklungspsychologischen Kontext Als Teilgebiet der Psychologie beschäftigt sich die Entwicklungspsychologie mit den ontogenetischen „Veränderungen in den psychischen Funktionen des Menschen“. Sie beobachtet den Entwicklungsverlauf des Individuums, analysiert psychische Veränderungen und versucht diese durch bestimmte Determinanten zu erklären. Durch Beobachtungen der unterschiedlichen Entwicklungsschritte eines Menschen zieht die Entwicklungspsychologie Rückschlüsse und trifft Vorhersagen auf den weiteren Verlauf seiner Entwicklung. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass man in die Entwicklung eingreifen und sie beeinflussen kann. Entwicklung kann somit als ist ein Prozess von Wachsen, Reifen und Lernen verstanden werden. Unter Wachsen wird die quantitative Veränderung des Organismus im Sinne der Vergrößerung der Masse in der Ontogenese verstanden. Reifung hingegen bezeichnet einen Prozess qualitativer Veränderungen des gesamten Organismus bzw. seiner Teile, deren biologische Strukturen und Funktionen sich gengesteuert in bestimmter Abfolge entfalten.
Entwicklungspsychologisch betrachtet, steht Lernen bzw. Anpassung für den individuellen und lebenslangen Erfahrungserwerb des Menschen aus der Umwelt und die ihm entsprechende Verhaltensmodifikation. Folglich kann die Persönlichkeitsentwicklung als ein Prozess von Denken, Sprechen und Handeln beschrieben werden, „in dem biologische Reifung, individuelles Lernen und Sozialisation in komplexer Weise ineinandergreifen“. Darunter wird auch die ontogenetische Veränderung verschiedenartiger menschlicher Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Körpermotorik, Sprache, Emotion, soziale Kognition, Moralentwicklung und Motivation erfasst. Im Laufe der Zeit haben sich vier verschiedene Sichtweisen der Entwicklungstheorie herausgebildet, die die Entwicklung des Menschen mittels bestimmter Determinanten zu erklären versuchen.
Die endogenetische Theorie führt die Entwicklung des Menschen auf bereits vorhandene ontogenetisch vermittelte Anlagen zurück und analysiert diese auf der Grundlage von Gemeinsamkeiten innerhalb einer Altersgruppe. Dieser Sichtweise zufolge, wirkt das Subjekt nicht aktiv an seiner Entwicklung mit. Die exogenetische Position geht ebenso davon aus, dass der Mensch selbst nicht aktiv zu seiner Entwicklung beiträgt, sondern lediglich durch die Umwelt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Hinführung: Piagets Theorie im entwicklungspsychologischen Kontext
- B. Jean Piagets, Theorie der kognitiven Entwicklung'
- 1. Grundannahmen und Zentrale Begriffe in Piagets Theorie
- 1.1. Die Entwicklungskomponenten
- 1.2. Die Entwicklungsfaktoren
- 2. Piagets Stadienmodell
- 2.1. Die sensomotorische Periode (Geburt bis 2 Jahre)
- 2.2. Die präoperationale Periode (2 bis 7 Jahre)
- 2.3. Die Periode der konkreten Operationen (7 bis 11 Jahre )
- 2.4. Die Periode der formalen Operationen (11 – 15 Jahre)
- C. Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit Jean Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und stellt diese im Kontext der Entwicklungspsychologie vor. Sie beleuchtet die Grundannahmen und zentralen Begriffe der Theorie, analysiert das von Piaget entwickelte Stadienmodell und diskutiert kritisch die Relevanz und Bedeutung der Theorie in der heutigen Forschung.
- Grundannahmen und Zentrale Begriffe in Piagets Theorie
- Das Stadienmodell der kognitiven Entwicklung
- Kritik an Piagets Theorie
- Relevanz von Piagets Theorie für die heutige Forschung
- Die Entwicklung von Denkstrukturen und kognitiven Fähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- A. Hinführung: Piagets Theorie im entwicklungspsychologischen Kontext: Dieses Kapitel führt in die Arbeit ein und stellt Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung im Kontext der Entwicklungspsychologie vor. Es wird erläutert, warum Piagets Theorie für das Verständnis der kognitiven Entwicklung von Kindern so wichtig ist und welche Bedeutung sie für die heutige Forschung hat.
- B. Jean Piagets, Theorie der kognitiven Entwicklung: Dieses Kapitel analysiert die Grundannahmen und zentralen Begriffe von Piagets Theorie. Es werden die Entwicklungskomponenten und -faktoren, die Piaget als entscheidend für die kognitive Entwicklung betrachtet, vorgestellt. Des Weiteren wird Piagets Stadienmodell der kognitiven Entwicklung detailliert beschrieben und die einzelnen Stadien sowie deren charakteristische Merkmale erläutert.
- C. Kritische Würdigung: Das letzte Kapitel bietet eine kritische Würdigung von Piagets Theorie. Es werden die Schwächen und Einschränkungen der Theorie beleuchtet und die Relevanz von Piagets Theorie für die heutige Forschung diskutiert.
Schlüsselwörter
Kognitive Entwicklung, Jean Piaget, Stadienmodell, Entwicklungskomponenten, Entwicklungsfaktoren, sensomotorische Periode, präoperationale Periode, konkrete Operationen, formale Operationen, Assimilation, Akkommodation, Adaptation, Kritik, Relevanz.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die vier Stadien der kognitiven Entwicklung nach Piaget?
Die Stadien sind: 1. Sensomotorisch (0-2 Jahre), 2. Präoperational (2-7 Jahre), 3. Konkret-operational (7-11 Jahre) und 4. Formal-operational (ab 11 Jahren).
Was bedeuten Assimilation und Akkommodation?
Assimilation ist die Einordnung neuer Erfahrungen in bestehende Schemata; Akkommodation ist die Anpassung der Schemata, wenn neue Informationen nicht hineinpassen.
Wie unterscheidet sich Piagets Theorie von der exogenetischen Theorie?
Piaget sieht das Kind als „aktiven Konstrukteur“ seines Wissens, während exogenetische Theorien den Menschen als passives Wesen betrachten, das nur durch Umweltreize geformt wird.
Was ist das Ziel der sensomotorischen Periode?
In dieser Phase lernt das Kind, sensorische Erfahrungen mit motorischen Handlungen zu koordinieren und entwickelt die Objektpermanenz.
Welche Kritikpunkte gibt es an Piagets Stadienmodell?
Kritiker bemängeln oft die starre Altersfestlegung der Stadien und dass die kognitiven Fähigkeiten von Kindern teilweise unterschätzt wurden.
- Quote paper
- M.A. Florina Jurca (Author), 2010, Jean Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/423948