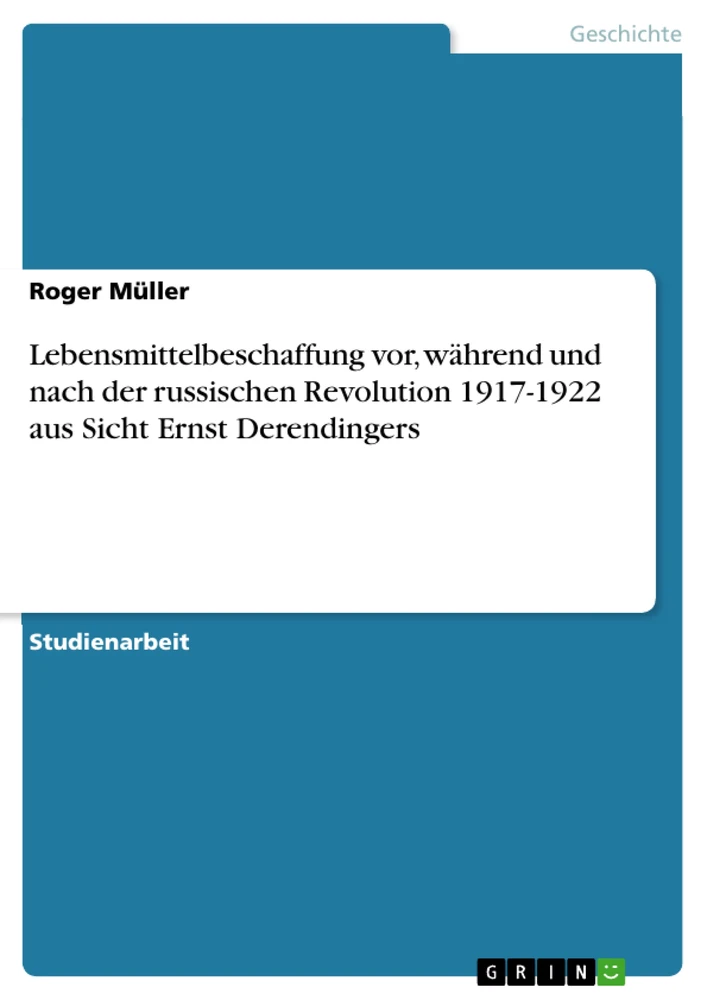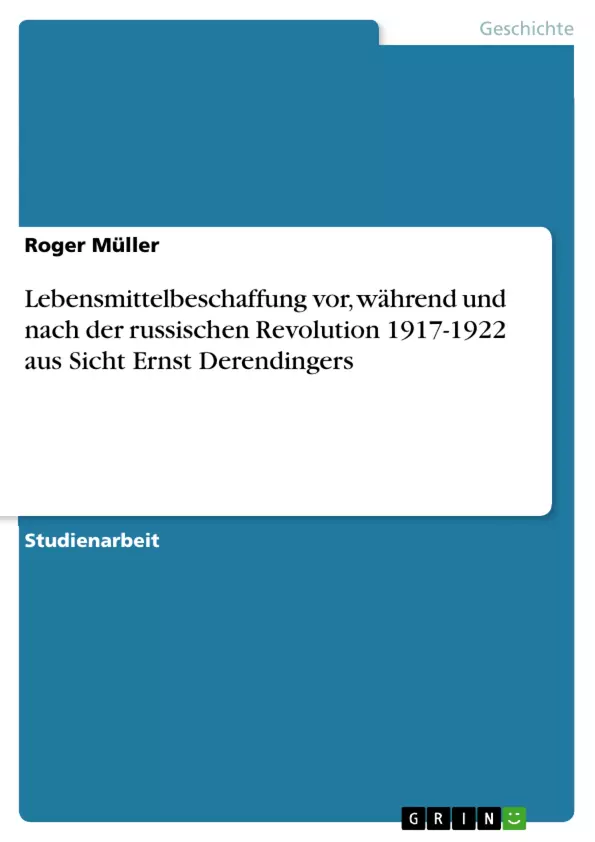Lebensmittelbeschaffung und die Ernährung des Volkes stellte in vielen Revolutionen einen entscheidenden Vorteil für die Initiierung von Umstürzen dar. Wer einen Systemwechsel bedingen wollte, musste als «neues System» dafür sorgen und beweisen, dass die Ernährung des Volkes gesichert werden konnte. Wer dies als revolutionäre Elite nicht schaffte, verlor das Vertrauen seiner neuen Ergebenen und damit verlor auch der geplante Umsturz an Fahrt. Wie wichtig, eine gute Lebensmittelversorgung für eine erfolgreiche Systemumstellung ist und wie viel Energie von den Revolutionären in dieses Ziel der optimalen Grundversorgung gesteckt wird, möchte ich anhand der Quelle «Derendinger – Seine Erzählungen als Graphiker in Moskau 1910-1938» aufzeigen und analysieren. Meine Forschungsfrage lautet: «Wie stellt Ernst Derendinger die Lebensmittelversorgung vor, während und nach der russischen Revolution im Jahre 1917-22 dar? ». Meine Hauptquellen sind dabei die Aufzeichnungen von Ernst Derendinger von seinem Aufenthalt in Russland/Sowjetunion zwischen 1910-1938. Als Sekundärliteratur diente mir hauptsächlich Literatur von Carsten Goehrke (Russland), sowie englischsprachige Literatur. Zuerst erläutere ich die Person von Ernst Derendinger und versuche den Wert seiner Aufzeichnungen als Quelle zu deuten. Eine Quellenkritik als Grundlage zur korrekten Deutung seiner Aufzeichnungen. Anschließend lege ich in drei Epochen die Lebensmittelbeschaffung/-versorgung anhand der Aufzeichnungen von Derendinger und Querverweis von Sekundärliteratur dar. Dies um eine chronologische Sicht der Lebensmittelversorgung zu erhalten, welche gut die Verläufe der Zufriedenheit der Bevölkerung abbildet. Zum Schluss versuche ich in einem Fazit die Zusammenhänge und die Beantwortung meiner Forschungsfrage zusammenzufassen, sowie einen kurzen Stellenwert zur allfälligen Weiterarbeit zu darzulegen. In der gegenwärtigen historischen Forschung scheint die Thematik der Lebensmittelbeschaffung in der russischen Revolution kein aktuelles Forschungsthema zu sein, wie meine Recherche auf www.jstor.com und im Internet ergaben. Meine Suchanfragen erzielten keine relevanten oder aktuellen Treffer.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ernst Derendinger - seine Person und sein Leben in Russland
- Lebensmittelversorgung in Russland vor 1917
- Lebensmittelversorgung während der Revolution und des Bürgerkrieges von 1917-1922
- Lebensmittelversorgung in Sowjetrussland nach 1922
- Fazit und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Lebensmittelversorgung in Russland während der russischen Revolution und ihren unmittelbaren Folgen von 1917 bis 1922. Die Arbeit analysiert die Darstellung der Lebensmittelversorgung aus Sicht des Schweizer Künstlers Ernst Derendinger, der in dieser Zeit in Russland lebte. Das Hauptziel ist es, die Erfahrungen Derendingers mit der Lebensmittelknappheit und den Versuchen der verschiedenen Regierungen, diese zu bewältigen, zu verstehen.
- Die Lebensmittelversorgung als Schlüsselfaktor in der Revolution
- Die Lebensmittelversorgung in Russland vor dem Ersten Weltkrieg und der Revolution
- Die Auswirkungen der Revolution und des Bürgerkriegs auf die Lebensmittelversorgung
- Die Maßnahmen der Sowjetregierung zur Bewältigung der Lebensmittelknappheit
- Die Rolle von Ernst Derendinger als Beobachter der Lebensmittelversorgung in Russland
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Relevanz der Lebensmittelversorgung im Kontext der russischen Revolution dar. Sie erläutert die Quellenlage und die Methode der Untersuchung.
- Ernst Derendinger - seine Person und sein Leben in Russland: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Ernst Derendingers Leben und seine Zeit in Russland. Es analysiert seine Position als Beobachter und die möglichen Einflüsse auf seine Wahrnehmung.
- Lebensmittelversorgung in Russland vor 1917: Dieses Kapitel befasst sich mit der Lebensmittelversorgung in Russland vor der Revolution und beleuchtet die bestehenden Probleme und die Ursachen für die spätere Krise.
- Lebensmittelversorgung während der Revolution und des Bürgerkrieges von 1917-1922: Dieses Kapitel beschreibt die dramatischen Folgen der Revolution und des Bürgerkriegs für die Lebensmittelversorgung. Es beleuchtet die verschiedenen Strategien zur Bewältigung der Krise und die Reaktionen der Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Lebensmittelversorgung, Revolution, Bürgerkrieg, Sowjetunion, Ernst Derendinger, Russland, Geschichte, Nahrungsmittelknappheit, Kriegskommunismus, NEP, Quellenkritik, Sekundärliteratur, historische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Ernst Derendinger?
Ein Schweizer Grafiker, der von 1910 bis 1938 in Moskau lebte und wertvolle Aufzeichnungen über den Alltag in Russland hinterließ.
Wie wichtig war die Lebensmittelversorgung für die Russische Revolution?
Sie war entscheidend: Wer die Ernährung des Volkes nicht sichern konnte, verlor schnell das Vertrauen und die Unterstützung der Bevölkerung.
Was beschreibt Derendinger über die Zeit des Bürgerkriegs (1917-1922)?
Er schildert eine dramatische Lebensmittelknappheit und die harten Versuche der Regierung, die Grundversorgung aufrechtzuerhalten.
Was änderte sich in der Lebensmittelversorgung nach 1922?
Nach dem Bürgerkrieg kam es zu einer gewissen Stabilisierung, unter anderem durch die Einführung der Neuen Ökonomischen Politik (NEP).
Wie war die Versorgungslage vor der Revolution 1917?
Bereits vor 1917 gab es aufgrund des Ersten Weltkriegs wachsende Probleme in der Logistik und Verteilung von Nahrungsmitteln.
Warum sind Derendingers Aufzeichnungen eine wichtige Quelle?
Als Außenstehender bietet er eine authentische, oft ungeschönte Sicht auf die realen Lebensbedingungen und die Zufriedenheit der Menschen.
- Arbeit zitieren
- Roger Müller (Autor:in), 2018, Lebensmittelbeschaffung vor, während und nach der russischen Revolution 1917-1922 aus Sicht Ernst Derendingers, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424187