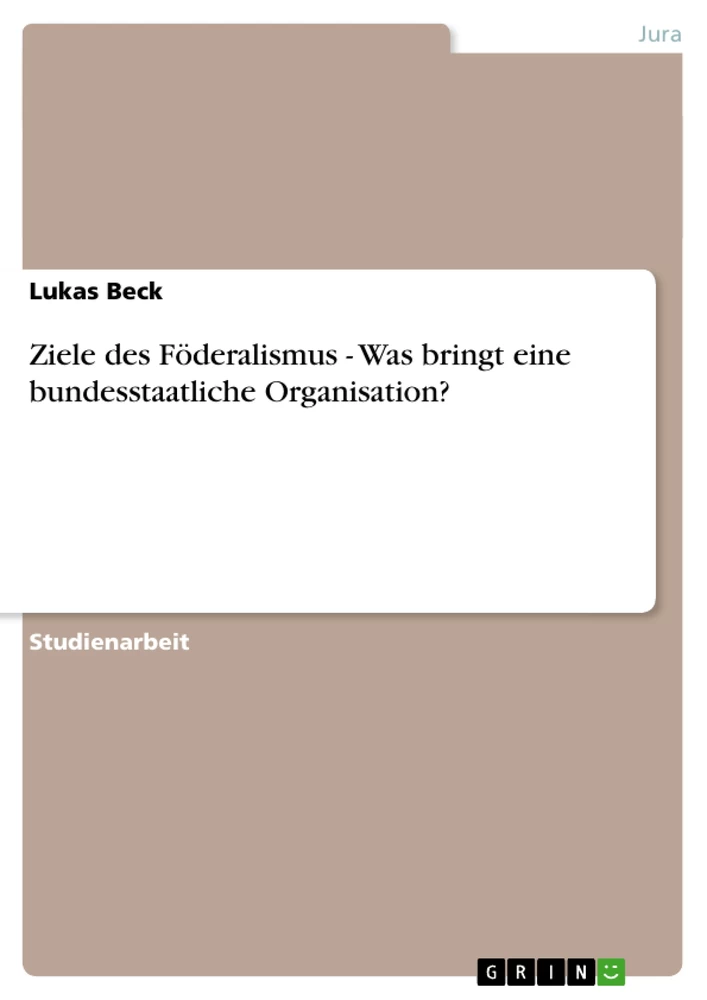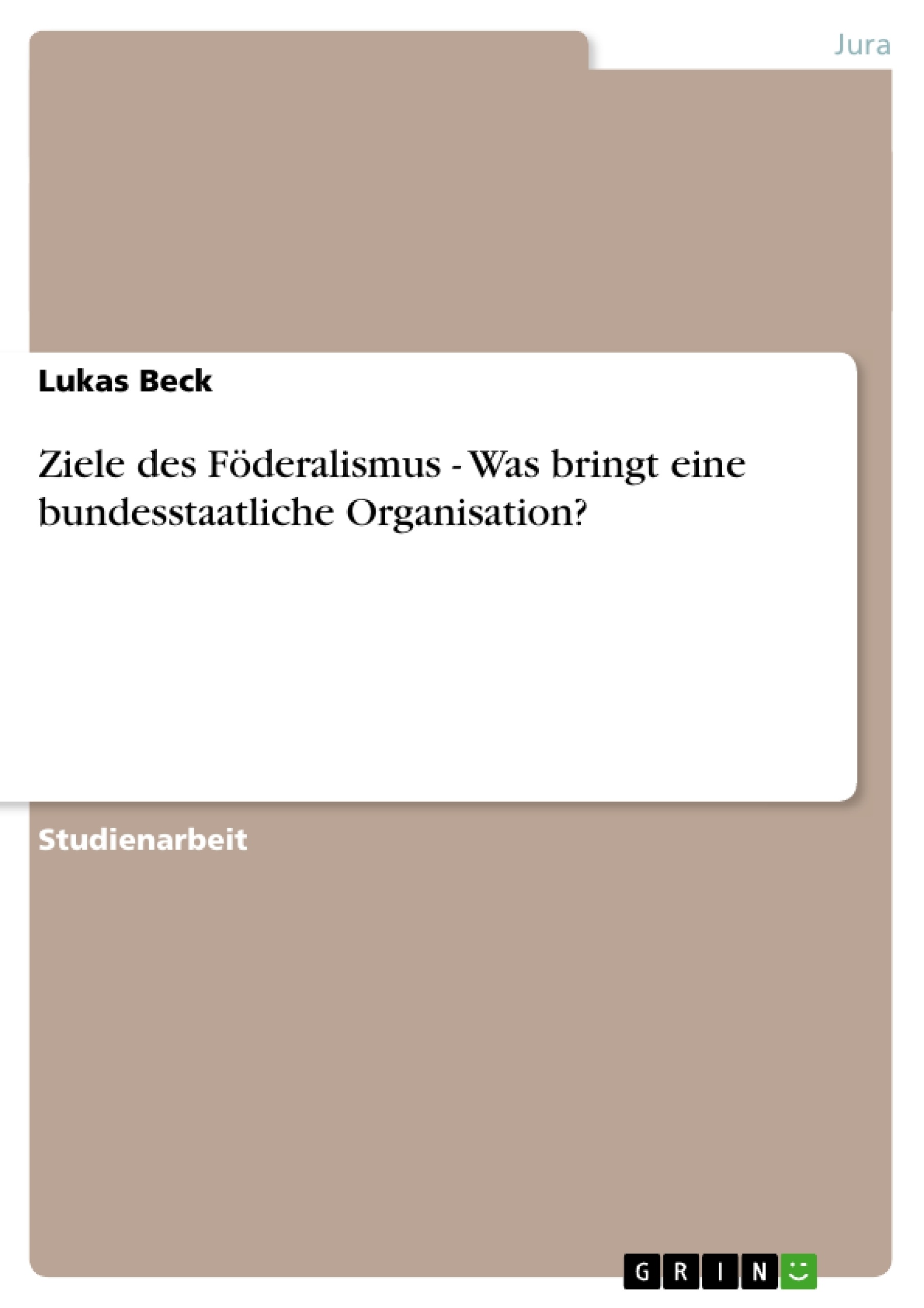Unter allen Staatszielbestimmungen die das deutsche Grundgesetz nennt, ist die Bundesstaatlichkeit die einzige, die durch Art. 79 Abs. 3 GG eine doppelte Verankerung in der Verfassung für sich beanspruchen kann. Dennoch hat es die föderale Ordnung schwer, die gleiche Anerkennung unter der Bevölkerung zu erreichen, wie etwa die Gebote der Demokratie oder der Rechtsstaatlichkeit. Dabei hat der Föderalismus einen hohen Traditionswert. Viele Staatsgebilde auf deutschem Boden hatten mehr oder weniger starke föderale Tendenzen. Doch Traditionspflege allein kann eine Staatsausformung nicht legitimieren. Sie muss sich vielmehr ständig neu beweisen. Die Bundesstaatlichkeit kann sich dieser Herausforderung stellen, denn ihre Vorzüge zeigen sich in einem hohen Potential an Freiheitssicherung und Bürgernähe, sowie schlicht in der Art und Weise der Staatsorganisation.
Vor allem in Zeiten des Wandels durch Reformen ist es unverzichtbar, sich die ursprünglichen Ziele des Föderalismus, die gleichzeitig seine Vorteile darstellen und auch heute unverändert aktuell sind, zu verdeutlichen. Denn nur wenn man das Ziel kennt, ist der Weg dorthin sinnvoll optimierbar.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- I. Weshalb diese Untersuchung?
- II. Begriffsabgrenzung – Gegenstand der Untersuchung
- B. Ziele des Föderalismus
- I. Historische Zielsetzungen am Beispiel des 19. und 20. Jahrhunderts
- 1. Sicherheit
- 2. Erhaltung des status quo
- 3. Erleichterung des Beitritts
- 4. Nach dem Schrecken: Die neue alte Ordnungsidee
- II. Föderalismus und Organisation
- 1. Die kleinen Einheiten
- a) Überschaubarkeit und Transparenz
- b) Effizienzgesichtspunkte
- c) Entlastungen
- 2. Einheit durch Vielfalt
- a) Die Gegensätze
- b) Die Synthese durch den Föderalismus
- c) Die Zufriedenheit der Teile mit dem Ganzen
- 3. Konflikt und Kompromiss
- 4. Experimentierfelder
- a) Sachliche Felder
- b) Personelle Felder
- 5. Wettbewerb
- III. Föderalismus und Demokratie
- 1. Zur Verwandtschaft der Prinzipien
- 2. Attraktivität der Teilhabe
- 3. Minderheitenschutz
- 4. Steigerung des politischen Bewusstseins
- IV. Föderalismus und Freiheit
- 1. Vertikale Gewaltenteilung
- a) Kompetenzaufteilung
- b) Die zweite Kammer
- c) Bundestreue
- d) Wirkung der vertikalen Gewaltenteilung
- 2. Innere Freiheit in Parteien und Verbänden
- 3. Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips als Ziel des Föderalismus?
- C. Zusammenfassung
- D. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ziele des föderalistischen Prinzips im deutschen Bundesstaat. Sie befasst sich mit der Kritik an der gegenwärtigen Ausgestaltung des Föderalismus und dem verbreiteten Unwissen über seine Vorzüge. Ziel ist es, die Ziele des Föderalismus aufzuzeigen und somit zu einem besseren Verständnis und einer fundierten Reformdiskussion beizutragen.
- Historische Entwicklung und Zielsetzungen des Föderalismus
- Der Föderalismus als Organisationsmodell
- Die Beziehung zwischen Föderalismus und Demokratie
- Der Föderalismus und die Frage der Freiheit
- Die Bedeutung des Föderalismus für den deutschen Bundesstaat
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Die Einleitung erläutert die Aktualität der Thematik Föderalismus im Kontext der Bundesrepublik Deutschland. Sie thematisiert die häufig geäußerte Kritik an seiner Ineffizienz und das mangelnde Verständnis des Prinzips in der Bevölkerung. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Ziele des Föderalismus herauszuarbeiten und somit zu seiner angemessenen Reform beizutragen. Die Bedeutung des Föderalismus für Deutschland und seine lange Tradition werden betont, mit dem Dritten Reich als Ausnahme. Der Fokus liegt auf der Klärung des Begriffs und der Untersuchung seiner Ziele als staatliche Ordnungsidee.
B. Ziele des Föderalismus: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Zielen des Föderalismus, die ihn vom Einheitsstaat unterscheiden. Es betont, dass Föderalismus keine Erfindung der Neuzeit ist und bereits historisch zur Erreichung verschiedener Ziele eingesetzt wurde. Der Abschnitt untersucht die generellen Ziele des Föderalismus im Zusammenhang mit Organisation, Demokratie und Freiheit. Die historischen Zielsetzungen werden am Beispiel des 19. und 20. Jahrhunderts untersucht, wobei Aspekte wie Sicherheit, Erhaltung des Status Quo, Erleichterung des Beitritts und die Bedeutung nach dem Zweiten Weltkrieg thematisiert werden.
Schlüsselwörter
Föderalismus, Bundesstaat, Deutschland, Ordnungspolitik, Demokratie, Freiheit, Vertikale Gewaltenteilung, Kompetenzaufteilung, Historische Entwicklung, Reform, Organisation, Einheit, Vielfalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Ziele des Föderalismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ziele des föderalistischen Prinzips im deutschen Bundesstaat. Sie analysiert die Kritik an der gegenwärtigen Ausgestaltung des Föderalismus und das verbreitete Unwissen über seine Vorzüge. Ziel ist es, die Ziele des Föderalismus aufzuzeigen und somit zu einem besseren Verständnis und einer fundierten Reformdiskussion beizutragen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung und Zielsetzungen des Föderalismus, den Föderalismus als Organisationsmodell, die Beziehung zwischen Föderalismus und Demokratie, den Föderalismus und die Frage der Freiheit sowie die Bedeutung des Föderalismus für den deutschen Bundesstaat. Es werden sowohl allgemeine Ziele als auch spezifische historische Beispiele (19. und 20. Jahrhundert) untersucht.
Welche Ziele des Föderalismus werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht Ziele wie Sicherheit, Erhaltung des Status Quo, Erleichterung des Beitritts, die Organisation in kleinen und überschaubaren Einheiten, die Synthese von Einheit und Vielfalt, Konflikt und Kompromiss, Experimentierfelder, Wettbewerb, Minderheitenschutz, Steigerung des politischen Bewusstseins, vertikale Gewaltenteilung (Kompetenzaufteilung, zweite Kammer, Bundestreue) und die Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in die Abschnitte Einführung, Ziele des Föderalismus, Zusammenfassung und Ausblick gegliedert. Die Einleitung erläutert die Aktualität des Themas und die Ziele der Arbeit. Der Hauptteil befasst sich detailliert mit den Zielen des Föderalismus unter verschiedenen Aspekten. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen, und der Ausblick gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Föderalismus, Bundesstaat, Deutschland, Ordnungspolitik, Demokratie, Freiheit, Vertikale Gewaltenteilung, Kompetenzaufteilung, Historische Entwicklung, Reform, Organisation, Einheit, Vielfalt.
Welche historischen Beispiele werden genannt?
Die Arbeit verwendet Beispiele aus dem 19. und 20. Jahrhundert, um die historischen Zielsetzungen des Föderalismus zu illustrieren. Es wird unter anderem der Einfluss des Zweiten Weltkriegs und die Bedeutung des Föderalismus nach dem Schrecken des Dritten Reichs thematisiert.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich mit dem Thema Föderalismus im deutschen Kontext auseinandersetzen möchten, insbesondere an Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die ein fundiertes Verständnis des föderalen Prinzips erlangen wollen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit lässt sich aus der Zusammenfassung der Kapitel entnehmen. Die Arbeit argumentiert für ein besseres Verständnis des Föderalismus und zielt auf eine fundierte Reformdiskussion ab, um die Vorzüge des Systems besser zu nutzen.
- Quote paper
- Lukas Beck (Author), 2005, Ziele des Föderalismus - Was bringt eine bundesstaatliche Organisation?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42484