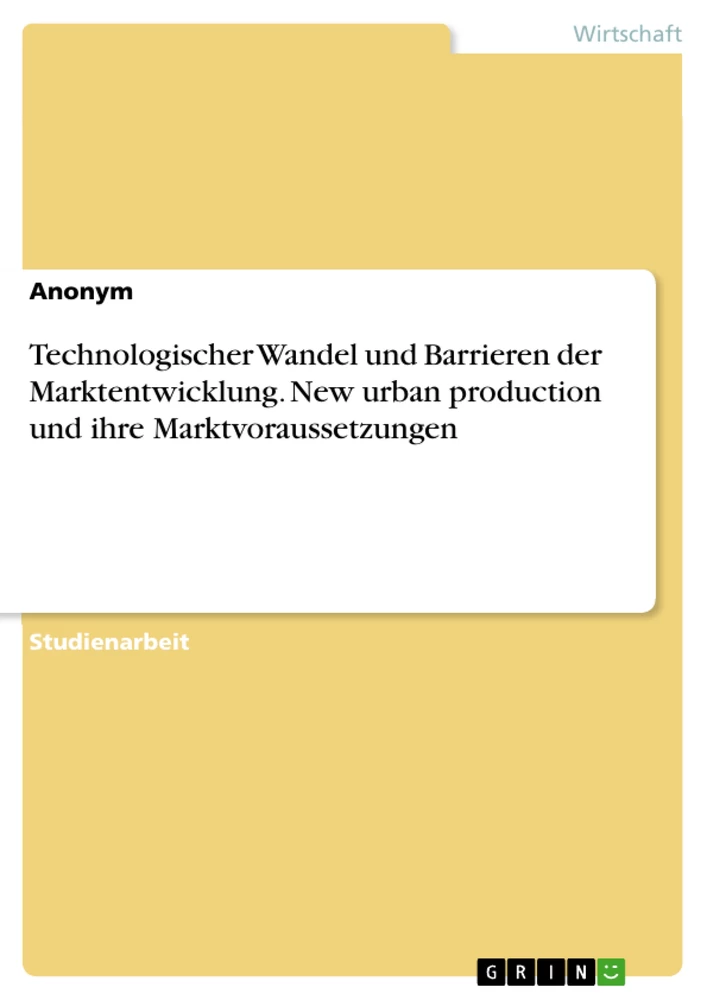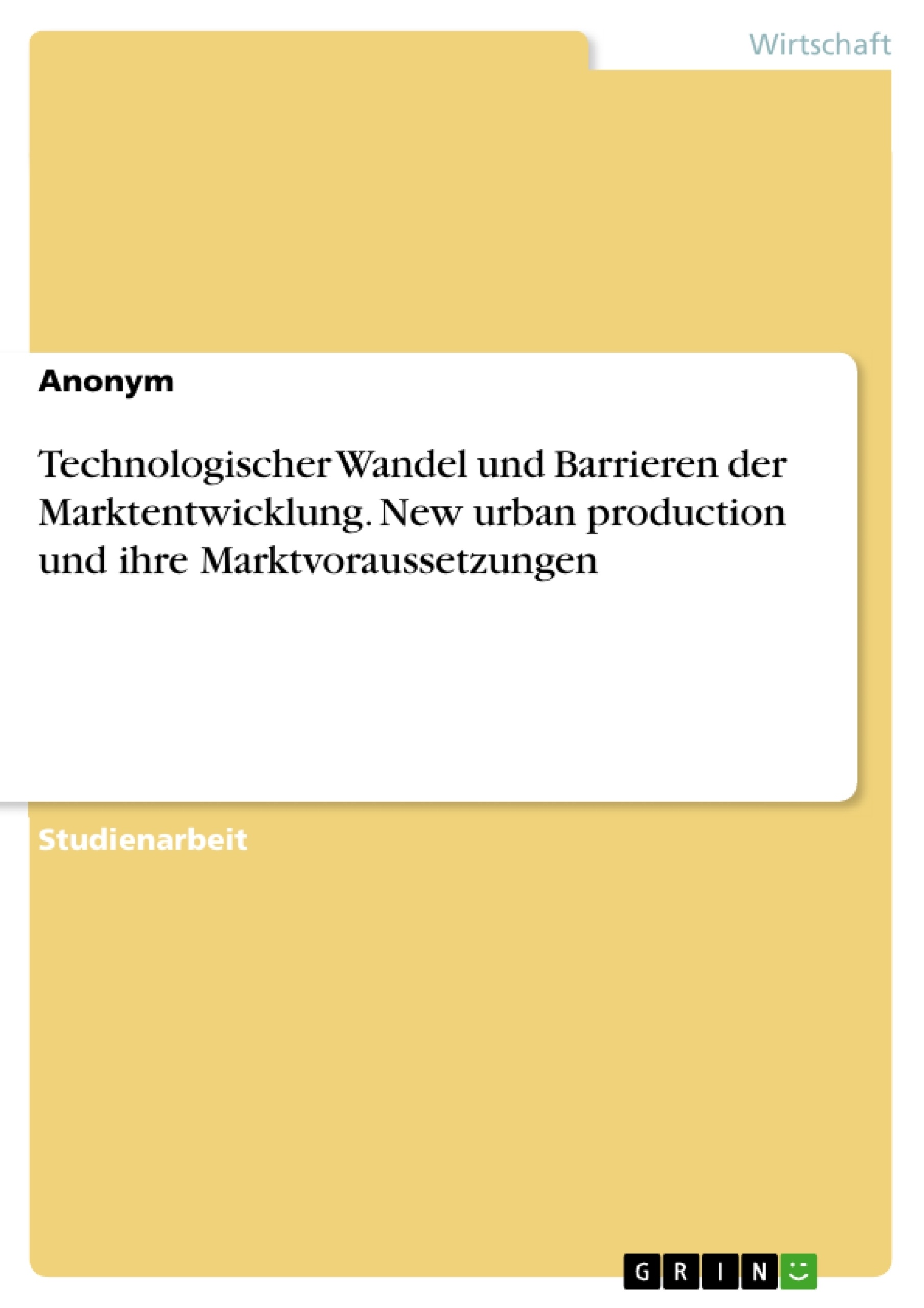Globale Megatrends wie die Urbanisierung der Lebens- und Wirtschaftsräume, der Klimawandel oder die Digitalisierung zwingen Unternehmen immer mehr zu einer Anpassung der bisherigen Produktionsstandorte und -netzwerke. Durch eine stetig fortschreitende Globalisierung, eine hohe Volatilität des Marktgeschehens und kürzer werdende Produktlebenszyklen steigen insbesondere die Anforderungen an die Flexibilität des Ressourceneinsatzes. Berücksichtigt man aktuelle Studien, wird sich das Umfeld der produzierenden Unternehmen auch weiterhin drastisch verändern, wenn nicht entsprechend auf die Trends reagiert wird.
So soll bis zum Jahr 2050 die Weltbevölkerung um etwa 2,3 Milliarden Menschen ansteigen, sodass der Ressourcenbedarf das aktuelle Angebot unseres Planeten um etwa das 2,9-fache übersteigen würde, wenn man den aktuellen Lebensstandard bei unveränderten industriellen Strukturen beibehält. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass sich der Bevölkerungsanteil der in der Stadt lebenden Menschen nahezu verdoppelt. Diese Entwicklungen machen deutlich, dass ein nachhaltiges wirtschaftliches Handeln, insbesondere unter Berücksichtigung des städtischen Umfeldes künftig unabdingbar ist, um den aufgeführten Herausforderungen für die Produktion der Zukunft Rechnung zu tragen. Unternehmen werden sich neben der zunehmenden Dynamik der Absatzmärkte also auch den steigenden Anforderungen des Innovationsgeschehens in Hinblick auf den Energie- und Ressourceneinsatz stellen müssen, um langfristig wettbewerbsfähig am Markt agieren zu können.
Ausgehend von den geschilderten Herausforderungen für produzierende Unternehmen wird im Rahmen der Arbeit das Konzept der urbanen Produktion als möglicher Lösungsansatz betrachtet. Ziel ist es, eine differenzierte Einschätzung der Treiber dieser Entwicklung, der potenziellen Effekte und der Herausforderungen der urbanen Produktion vorzunehmen. Dazu sollen die nachfolgenden Forschungsfragen zu einem tieferen Verständnis der „new urban production“ führen:
Inwiefern dient die Digitalisierung und Industrie 4.0 als Treiber einer urbanen Produktion und ermöglicht damit eine Re-Integration der Produktion in den Stadtraum? Welche Wertschöpfungspotenziale erhofft man sich durch urbane Produktion und welche Barrieren hemmen die Entwicklungen aktuell noch, gibt es Lösungsansätze?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Globale Trends und deren Folgen für produzierende Unternehmen
- Urbane Produktion als Lösungsansatz
- Zielsetzung und Forschungsfragen
- Methodik und Aufbau der Arbeit
- Urbane Produktion: Industrie und Stadt als symbiotische Verbindung
- Hintergründe der urbanen Produktion
- Begriffsannäherung
- Urbane Produktion im Kontext der Digitalisierung
- Die industrielle Produktion im digitalen Wandel
- Räumliche Wirkung neuer Produktionstechnologien
- Mit der Digitalisierung zur urbanen Produktion
- Potenziale und Barrieren der urbanen Produktion
- Potenziale der Wertschöpfung im städtischen Umfeld
- Aktuelle Barrieren und Lösungsansätze
- Flächennutzungskonflikte zwischen Industrie und Wohnen
- Technische und städtische Infrastruktur
- Produkteignung
- Zwischenfazit
- Urbane Produktion am Beispiel der Gläsernen Manufaktur in Dresden
- Stadtregion Dresden
- Elemente der urbanen Produktion in der Gläsernen Manufaktur
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der urbanen Produktion, einem Lösungsansatz für die Herausforderungen, die globale Trends für produzierende Unternehmen mit sich bringen. Die Studie analysiert die Hintergründe und die Relevanz der urbanen Produktion, untersucht ihre Einbettung in den Kontext der Digitalisierung und erörtert die Potentiale sowie Barrieren, die mit diesem Produktionsmodell verbunden sind.
- Globale Trends und ihre Folgen für produzierende Unternehmen
- Urbane Produktion als Lösungsansatz
- Potenziale und Barrieren der urbanen Produktion
- Die Rolle der Digitalisierung in der urbanen Produktion
- Fallstudie der Gläsernen Manufaktur in Dresden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der urbanen Produktion ein und beleuchtet die globalen Trends, die diese Entwicklung vorantreiben. Es werden die Zielsetzung und die Forschungsfragen der Arbeit definiert, sowie die Methodik und der Aufbau der Untersuchung erläutert.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Hintergründen und der Begriffsannäherung der urbanen Produktion. Dabei werden die verschiedenen Aspekte dieses Produktionsmodells beleuchtet und die Verbindung zwischen Industrie und Stadt als symbiotische Einheit aufgezeigt.
Kapitel 3 untersucht die Rolle der Digitalisierung im Kontext der urbanen Produktion. Es werden die Auswirkungen des digitalen Wandels auf die industrielle Produktion und die räumliche Wirkung neuer Produktionstechnologien diskutiert.
Kapitel 4 analysiert die Potentiale und Barrieren der urbanen Produktion. Es werden sowohl die Vorteile der Wertschöpfung im städtischen Umfeld als auch die Herausforderungen, wie Flächennutzungskonflikte, technische und städtische Infrastruktur sowie Produkteignung, beleuchtet.
Kapitel 5 präsentiert die Gläserne Manufaktur in Dresden als Beispiel für die Umsetzung der urbanen Produktion. Es werden die Besonderheiten der Stadtregion Dresden sowie die Elemente der urbanen Produktion in diesem Produktionsbetrieb dargestellt.
Schlüsselwörter
Urbane Produktion, Digitalisierung, Industrie 4.0, Wertschöpfung, Stadtentwicklung, Flächennutzung, Infrastruktur, Produktionstechnologien, Gläserne Manufaktur, Dresden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Technologischer Wandel und Barrieren der Marktentwicklung. New urban production und ihre Marktvoraussetzungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/425444