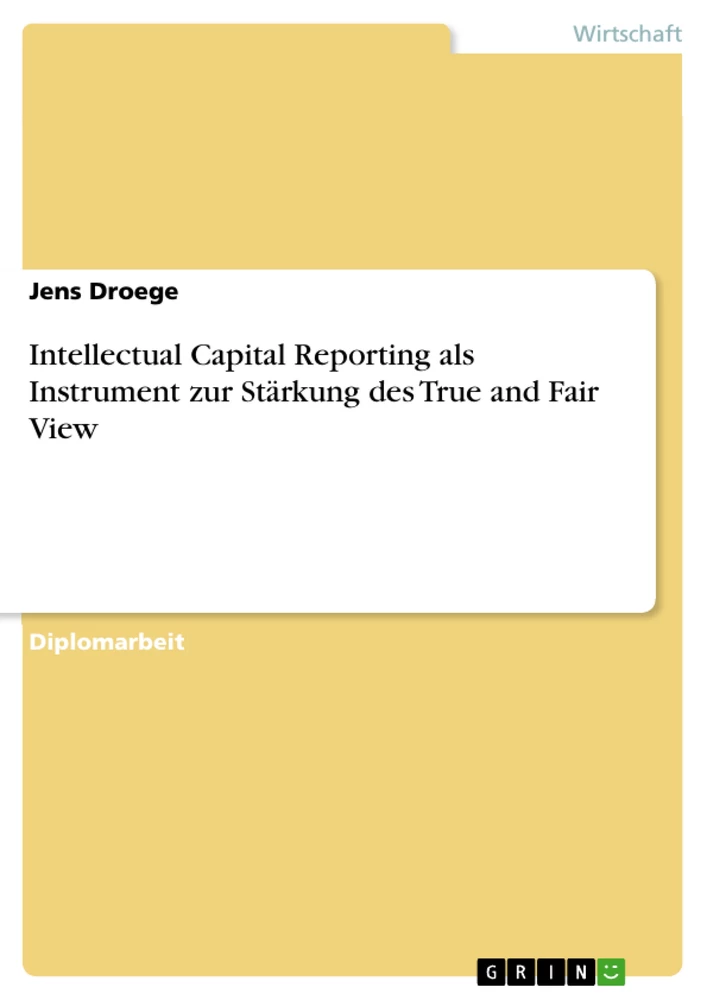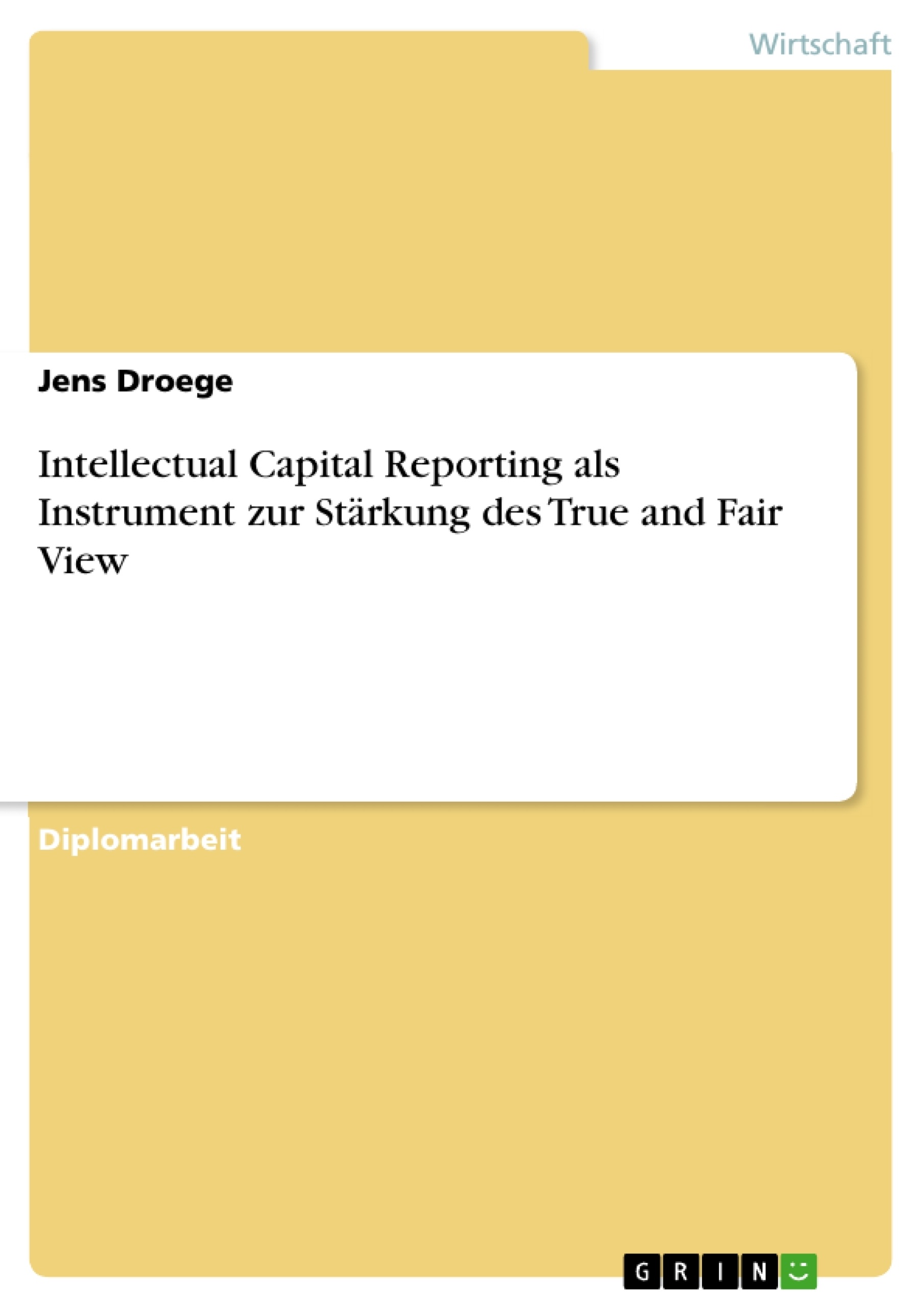Seit in Kraft treten des HGB am 1.1.1900 hat dieses mehrfache Reformen erfahren. Dennoch ist die in der Bundesrepublik Deutschland übliche externe Rechnungslegung nach handelsrechtlichen Vorschriften nach wie vor geprägt von der klassischen Fremdfinanzierung durch die Aufnahme fremder Mittel. Ziel des Handelsrechts ist in erster Linie der Schutz der Gläubiger vor falschen Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens. Zieht man jedoch in Betracht, dass durch den Wandel von einer Industriegesellschaft hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft die Wertschöpfung in zunehmendem Maße von immateriellen Vermögensgegenständen abhängt und vielfach über die Kompetenz und das Know-how der Mitarbeiter erfolgt, so mutet die Aussagefähigkeit einer Handelsbilanz anachronistisch an.
Wenngleich die Rechnungslegung nach International Financial Reporting Standards durch den ‚fair value’-Gedanken und eine vergleichsweise stärkere Ausrichtung an Investoreninteressen einen wesentlich höheren Informationsgehalt über die finanzielle Situation eines Unternehmens (financial position, changes in financial position) und über die im Unternehmen erbrachten Leistungen aufweist, werden auch bei der Bilanzierung nach IAS/IRFS immaterielle strategische Erfolgsfaktoren originären Ursprungs nicht erfasst. Fragen, wie diese Werte in gesteigerten Ertrag umgewandelt werden können, wie diese gesteuert und über den bilanziellen Gewinn hinaus quantifizierbar gemacht werden können, bleiben unbeantwortet.
Insbesondere durch die steigende Bedeutung des tertiären Sektors sowie Hochtechnologieunternehmen an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung zeigt sich, dass der Wert und die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens nicht mehr allein anhand des traditionellen Zahlenmaterials bewertet werden können; vielmehr verlangt das Zusammenwachsen der Märkte für Investitionen, Wissen und Mitarbeiter nach internationaler Standardisierung und Vergleichbarkeit vorhandener immaterieller Ressourcen. Hinzu kommen Bilanzierungsskandale und Unternehmenszusammenbrüche, wie etwa die von Enron in den USA oder die italienische Parmalat , welche die Kapitalmärkte hinsichtlich der Verlässlichkeit der durch das Unternehmen publizierten und kommunizierten Informationen verunsichert haben. Hier haben die Gesetzgeber zwar bereits reagiert, gleichzeitig aber wachsen die Informationsanforderungen der Kapitalmarktteilnehmer an die Bewertungsrelevanz der verfügbaren Informationen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Einführung in die Aufgabenstellung
- Aufbau der Arbeit
- Intellectual Capital
- Begriffsbestimmung
- Bedeutung von Intellectual Capital
- Human Capital
- Organisational Capital
- Intellectual Capital als kritischer Erfolgsfaktor
- Intellectual Capital als Bestandteil des immateriellen Anlagevermögens
- Begriff des Vermögensgegenstands
- Vermögensgegenstand nach HGB
- Vermögensgegenstand nach IAS/IFRS
- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Klassifizierung immaterieller Vermögenswerte
- Immaterielle Vermögensgegenstände nach HGB
- Immaterielle Vermögenswerte im Sinne des IAS/IFRS 38
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Zugehörigkeit zum Anlagevermögen nach HGB
- Zugehörigkeit zum Anlagevermögen nach IAS/IFRS
- Intellectual Capital als immaterieller Vermögenswert des Anlagevermögens
- Begriff des Vermögensgegenstands
- Bilanzielle Ansatzfähigkeit von Intellectual Capital
- Handelsrechtlicher Ansatz
- Ansatz nach IAS/IFRS 38
- Ausweismöglichkeit von Intellectual Capital im Jahresabschluss
- Handelsrechtliche Möglichkeiten
- Ausweismöglichkeiten nach IAS/IFRS
- Bewertungsmöglichkeiten von Intellectual Capital
- Klassifizierung von Bewertungsverfahren
- Ansätze zur Bewertung von Intellectual Capital
- Cost-Approach
- Market Approach
- Marktwert – Buchwert - Relationen
- Tobin's q
- Calculated Intangible Value (CIV)
- Analytical Approach
- Balanced Scorecard nach Kaplan/Norton
- Skandia Navigator nach Edvinsson
- Intellectual Asset Monitor (IAM) nach Sveiby
- Income Approach
- Intellectual Capital Reporting
- True and Fair View in der Rechnungslegung
- Entwicklung und Unterscheidung von traditionellen Instrumenten der Rechnungslegung
- Bedeutung für das Management und die Unternehmensberichterstattung
- Aufbau
- Kategorisierung des Intellectual Capital
- Selektion der relevanten Informationen
- Aufarbeitung und Darstellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Intellectual Capital als Instrument zur Stärkung des True and Fair View in der Rechnungslegung eingesetzt werden kann. Sie analysiert die Definition und Bedeutung von Intellectual Capital, seine bilanzielle Ansatzfähigkeit und Ausweismöglichkeiten sowie die Bewertungsmöglichkeiten. Darüber hinaus wird die Bedeutung von Intellectual Capital Reporting für das Management und die Unternehmensberichterstattung untersucht.
- Definition und Bedeutung von Intellectual Capital
- Bilanzielle Ansatzfähigkeit von Intellectual Capital
- Ausweismöglichkeiten von Intellectual Capital im Jahresabschluss
- Bewertungsmöglichkeiten von Intellectual Capital
- Bedeutung von Intellectual Capital Reporting
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung stellt die Aufgabenstellung der Diplomarbeit vor und erläutert den Aufbau der Arbeit.
- Intellectual Capital: Dieses Kapitel beleuchtet die Definition und Bedeutung von Intellectual Capital. Es werden die verschiedenen Formen von Intellectual Capital, wie Human Capital und Organisational Capital, sowie die Bedeutung für den Unternehmenserfolg dargestellt.
- Intellectual Capital als Bestandteil des immateriellen Anlagevermögens: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Einordnung von Intellectual Capital im Rahmen des immateriellen Anlagevermögens. Es werden die rechtlichen Grundlagen für die Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte im deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) erläutert.
- Bilanzielle Ansatzfähigkeit von Intellectual Capital: In diesem Kapitel wird die bilanzielle Ansatzfähigkeit von Intellectual Capital nach handelsrechtlichen und IAS/IFRS-Gesichtspunkten betrachtet. Es werden die jeweiligen Anforderungen an die Ansatzfähigkeit immaterieller Vermögenswerte diskutiert.
- Ausweismöglichkeit von Intellectual Capital im Jahresabschluss: Dieses Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten, Intellectual Capital im Jahresabschluss auszuweisen. Es werden die handelsrechtlichen und IAS/IFRS-relevanten Ausweismöglichkeiten vorgestellt und diskutiert.
- Bewertungsmöglichkeiten von Intellectual Capital: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Ansätze zur Bewertung von Intellectual Capital. Es werden verschiedene Bewertungsansätze, wie der Cost-Approach, Market Approach und Income Approach, vorgestellt und im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit für Intellectual Capital bewertet.
- Intellectual Capital Reporting: Das letzte Kapitel beleuchtet das Konzept von Intellectual Capital Reporting. Es werden die Bedeutung für das Management und die Unternehmensberichterstattung sowie die Herausforderungen und Chancen von Intellectual Capital Reporting diskutiert.
Schlüsselwörter
Intellectual Capital, immaterielles Anlagevermögen, True and Fair View, Rechnungslegung, Bilanzierung, Bewertung, Reporting, Management, Unternehmensberichterstattung, IAS/IFRS, HGB, Balanced Scorecard, Skandia Navigator, Intellectual Asset Monitor.
- Arbeit zitieren
- Jens Droege (Autor:in), 2004, Intellectual Capital Reporting als Instrument zur Stärkung des True and Fair View, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42605