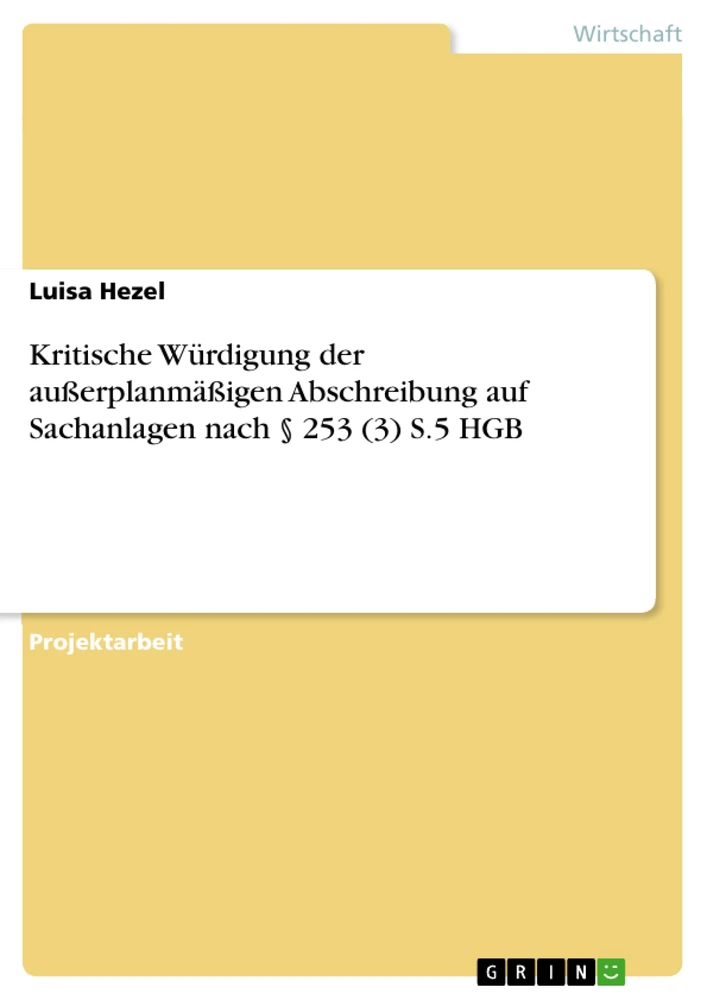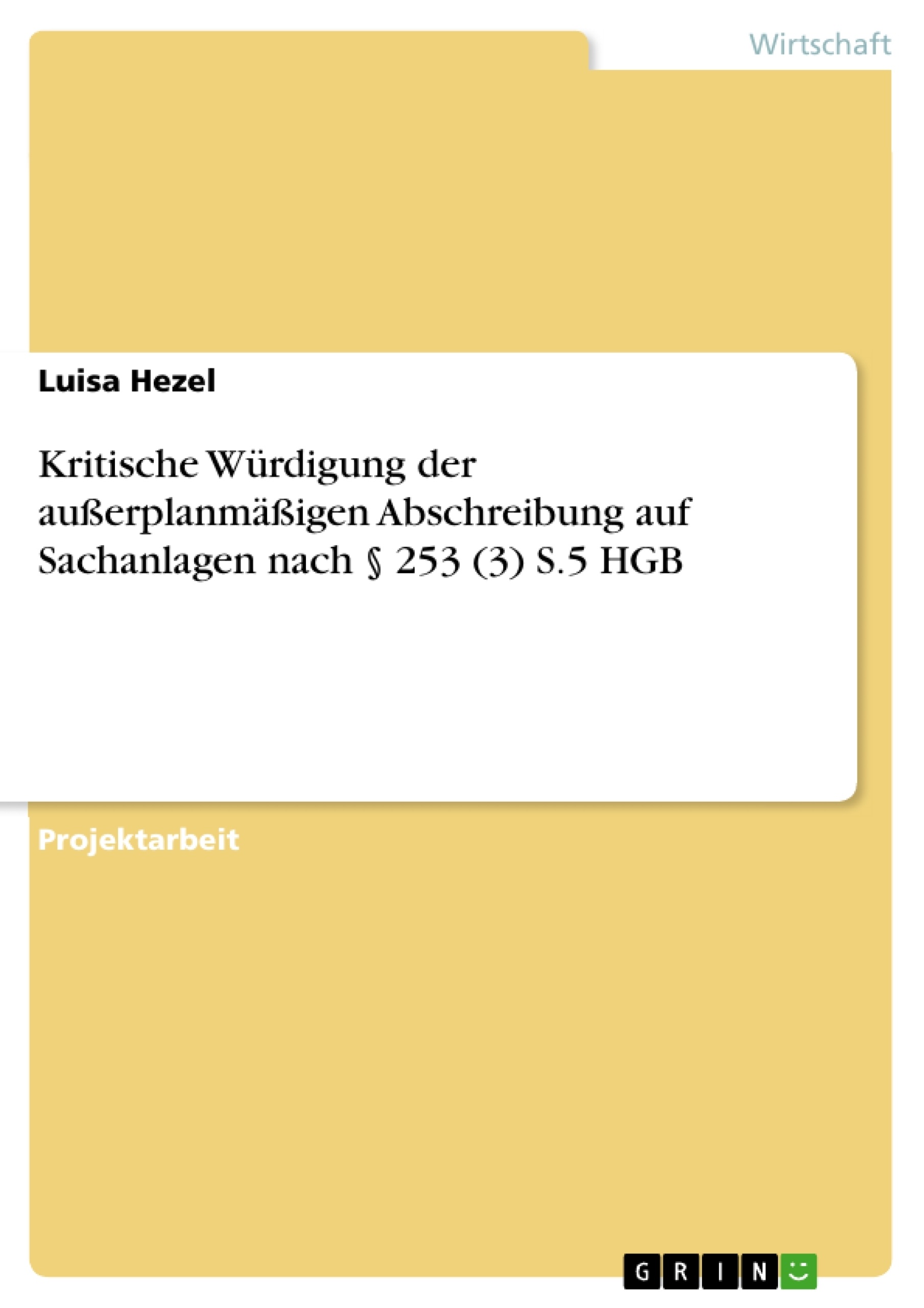Ziel dieser Arbeit ist die kritische Würdigung der außerplanmäßigen Abschreibung auf Sachanlagen nach § 253 (3) S. 5 HGB.
Zu Beginn werden vor allem die GoB sowie die gesetzlich beabsichtigten Zwecke des Jahresabschlusses, nämlich die Informations- und Zahlungsbemessungsfunktion beleuchtet. Im weiteren Verlauf werden die Grundlagen der Bilanzierung des Sachanlagevermögens dargestellt.
Spezieller wird die Folgebewertung der Vermögensgegenstände betrachtet und an Hand der jeweiligen GoB analysiert, um danach auf die sich ergebenden Konsequenzen für die beiden Hauptzwecke des Jahresabschlusses einzugehen.
Nicht Gegenstand dieser Arbeit ist die Behandlung der außerplanmäßigen Abschreibung des Sachanlagevermögens nach den Steuergesetzen , da die umgekehrte Maßgeblichkeit bereits mit dem BilMoG abgeschafft wurde.
Dennoch wird Bezug auf einzelne BFH-Urteile genommen, da in diesen der BFH die GoB des Handelsgesetzbuches aufgreift und interpretiert. Es ergibt sich hieraus eine Relevanz für die Berücksichtigung der außerplanmäßigen Abschreibung in der Handelsbilanz.
Nicht behandelt wird des Weiteren der vierte Posten des § 266 (2) A. II. HGB, die Anzahlungen und Anlagen im Bau.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Zwecke des Jahresabschlusses und relevante GoB
- 3. Grundlagen der Bilanzierung des Sachanlagevermögens
- 3.1 Definition und Ausweis
- 3.2 Ansatz
- 3.3 Bewertung
- 3.3.1 Zugangsbewertung
- 3.3.2 Einzelbewertungsgrundsatz
- 3.3.3 Komponentenansatz
- 3.3.4 Folgebewertung
- 4. Kritische Würdigung der außerplanmäßigen Abschreibung im Lichte der relevanten GoB
- 4.1 Möglichkeit der außerplanmäßigen Abschreibung
- 4.2 Dauerhaftigkeit der Wertminderung
- 4.3 Feststellung des niedrigeren beizulegenden Wertes
- 4.3.1 Problematik beizulegender Wert
- 4.3.2 Wiederbeschaffungswert
- 4.3.3 Einzelveräußerungspreis
- 4.3.4 Ertragswert
- 4.3.5 Abschreibungskorrekturwert
- 4.4 Verhältnis planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibung
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Projektarbeit analysiert die außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen nach § 253 (3) S. 5 HGB. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen und die praktische Anwendung dieser Abschreibungsmethode im Lichte der relevanten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die Problematik der Ermittlung des niedrigeren beizulegenden Werts und das Verhältnis von planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibung.
- Rechtliche Grundlagen der außerplanmäßigen Abschreibung
- Anwendbarkeit der Abschreibungsmethode im Rahmen der GoB
- Ermittlung des niedrigeren beizulegenden Werts
- Bedeutung der Dauerhaftigkeit der Wertminderung
- Verhältnis von planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein und skizziert den Gang der Untersuchung. Kapitel 2 behandelt die Zwecke des Jahresabschlusses und die relevanten GoB. Kapitel 3 erläutert die Grundlagen der Bilanzierung des Sachanlagevermögens, einschließlich Definition, Ansatz und Bewertung. Kapitel 4 widmet sich der kritischen Würdigung der außerplanmäßigen Abschreibung im Lichte der GoB. Dabei werden die Voraussetzungen für die Anwendung der Abschreibungsmethode, die Problematik der Wertminderungsermittlung und das Verhältnis zu planmäßigen Abschreibungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Außerplanmäßige Abschreibung, Sachanlagen, § 253 (3) S. 5 HGB, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), niedrigerer beizulegender Wert, Dauerhaftigkeit der Wertminderung, Wiederbeschaffungswert, Einzelveräußerungspreis, Ertragswert, Abschreibungskorrekturwert, planmäßige Abschreibung.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt § 253 (3) S. 5 HGB?
Er regelt die außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen im Falle einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.
Was ist der Unterschied zwischen planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibung?
Planmäßige Abschreibungen verteilen die Anschaffungskosten über die Nutzungsdauer. Außerplanmäßige Abschreibungen erfassen unvorhergesehene Wertminderungen.
Wann gilt eine Wertminderung als „dauerhaft“?
Eine Wertminderung ist dauerhaft, wenn der beizulegende Wert für einen erheblichen Teil der Restnutzungsdauer unter dem Buchwert liegt.
Wie wird der „niedrigere beizulegende Wert“ ermittelt?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze wie den Wiederbeschaffungswert, den Einzelveräußerungspreis oder den Ertragswert der Anlage.
Welche Zwecke verfolgt der Jahresabschluss laut GoB?
Die Hauptzwecke sind die Informationsfunktion (für Gläubiger und Eigner) und die Zahlungsbemessungsfunktion (als Basis für Steuern und Dividenden).
- Quote paper
- Luisa Hezel (Author), 2017, Kritische Würdigung der außerplanmäßigen Abschreibung auf Sachanlagen nach § 253 (3) S.5 HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429075