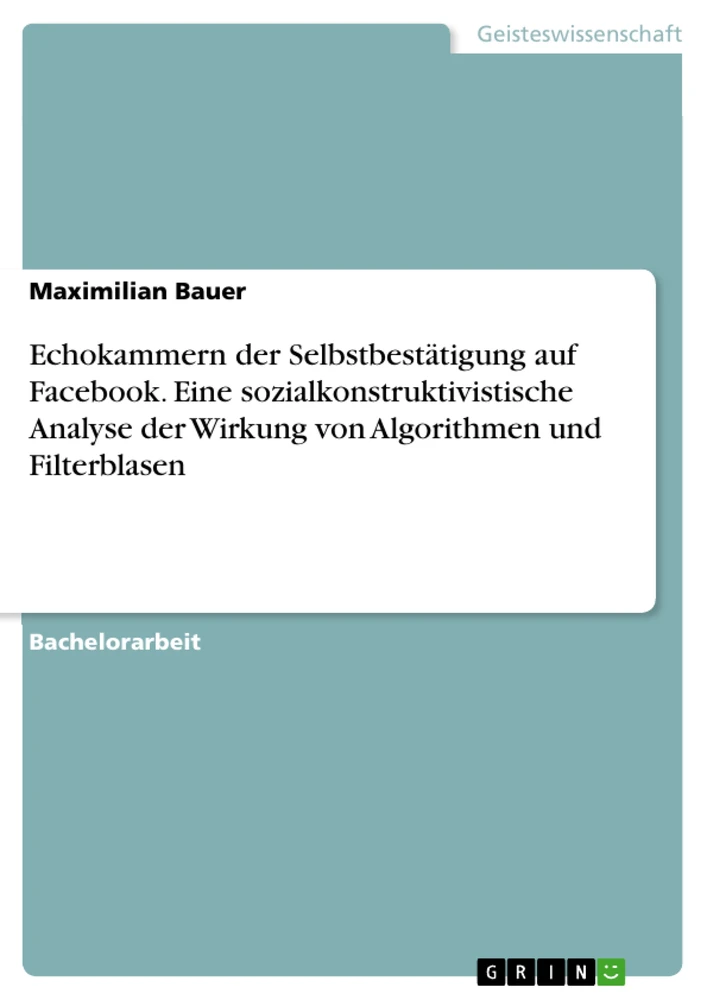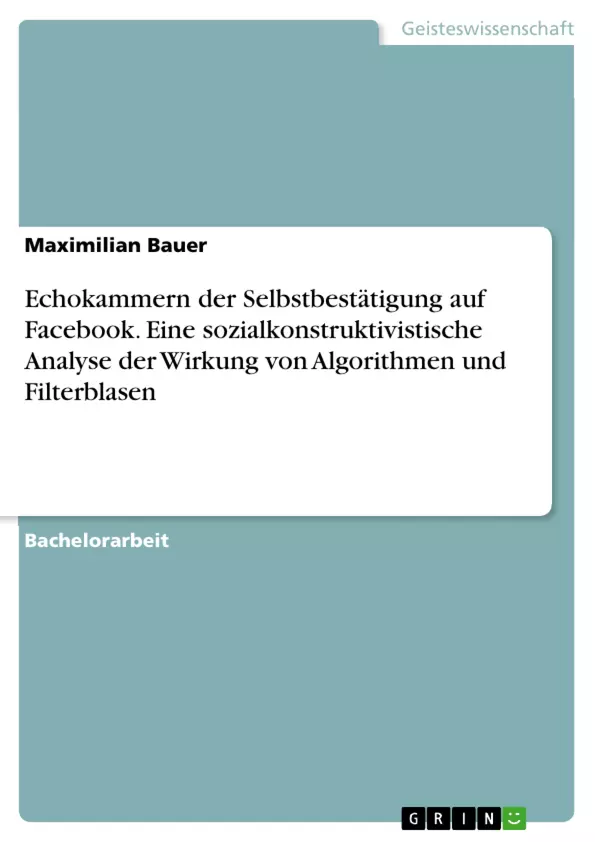Zwei Milliarden Nutzer sind auf Facebook unterwegs, rezipieren Inhalte und tauschen sich aktiv aus. Doch wie wird bestimmt, was welche Nutzer sieht? Facebooks Algorithmus ist ein wohl behütetes Geschäftsgeheimnis, und die Theorie der Filterblasen oder "Echokammern der Selbstbestätigung" kursieren in den Medienwissenschaften. Hierzu gibt es allerdings wenig Forschung und kaum Studien oder den Versuch abseits von Spekulation Licht ins Dunkel zu bringen. Dennoch zeigen die jüngsten Skandale, wegen denen sich Mark Zuckerberg vor diversen Ausschüssen rechtfertigen muss, welch gravierende Relevanz ein Netzwerk in der Größenordnung von Facebook hat.
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit den Auswirkungen der algorithmischen Selektion von Inhalten auf die Wahrnehmung der Welt der Individuen, und schlussendlich deren kommunikatives Zusammenwirken. Im Rahmen der Forschung wurden 2.400 Kommentare analysiert, 240 Profile untersucht und Rückschlüsse auf theoretische Basis des Sozialkonstruktivismus geschlossen. Zunächst werden die theoretischen soziologischen Rahmenbedingungen gesponnen: Wie konstituiert sich unsere Gesellschaft und ihr Wissen? Dieser Frage wird von den Ursprüngen der "gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit" bis in die heutige Zeit nachgegangen. Anschließend wird Facebook analysiert und Rückschlüsse auf diese spezifische Plattform vorgenommen.
Die Studien kommen hierbei großteils aus den Vereinigten Staaten oder Asien, oder sind von Facebook selbst herausgegeben wurden. Es gilt die medienpsychologische Motivation hinter der Architektur des Algorithmus zu ergründen. Anschließend erfolgt eine qualitative Untersuchung zum Diskurs auf Facebook, beziehungsweise dessen Vielfältigkeit und Polarisierungspotenzial. Zuletzt werden gesellschaftliche Prognosen getroffen, was Algorithmen für eine Demokratie und ihre Diskurse bedeuten könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1. Eigenschaften des Sozialkonstruktivismus
- 1.2. Wissen und Alltagswirklichkeit
- 1.2.1. Entstehung subjektiver Realität
- 1.2.2. Interaktion und Kommunikation
- 1.2.3. Von Worten zu Wissen
- 1.3. Gesellschaftliche Ausprägungen
- 1.3.1. Institutionalisierung
- 1.3.2. Legitimation
- 1.4. Internalisierung und Identität
- 1.4.1. Primäre und sekundäre Sozialisation
- 1.4.2. Identitätsbildung
- 1.5. Die Kommunikationsgesellschaft
- 2. Facebook als soziale Plattform
- 2.1. Facebook: Zahlen und Relevanz
- 2.2. Inhalte, Aufbau und Rezeption
- 2.2.1. Aufbereitung versus Herkunft
- 2.3. Algorithmen als Gatekeeper
- 2.3.1. Bewusstsein über den Algorithmus
- 2.4. Forschungsstand und Status quo
- 2.4.1. Emotionsbeeinflussung über Facebook
- 2.4.2. Filterfunktion des Algorithmus
- 3. Qualitative Untersuchung möglicher Filterblasen
- 3.1. Forschungshypothese und Verfahren
- 3.1.1. Qualitative Sozialforschung
- 3.2. Praktische Umsetzung und Leitfaden
- 3.3. Explorative Untersuchung auf Facebook
- 3.3.1. Die Alternative für Deutschland (AfD)
- 3.3.2. Die Linke
- 3.3.3. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- 3.3.4. Fazit und Ergebnisse
- 4. Interpretation und Deutung
- 4.1. Medienpsychologie und Algorithmus-Architektur
- 4.2. Bildung und Demokratie
- 4.3. Sozialkonstruktivismus in den Filterblasen
- 4.3.1. Das politische Spektrum auf Facebook
- 4.4. Effektivität und Grenzen
- 5. Fazit und Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen, die potenzielle Filterblasen und Echokammern algorithmischer Natur in sozialen Netzwerken und auf gesellschaftlicher Ebene haben könnten.
- Die Arbeit analysiert den Einfluss von Algorithmen auf die Informationsselektion und -präsentation.
- Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Filterblasen die Meinungsbildung und den Diskurs beeinflussen.
- Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Sozialkonstruktivismus in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Filterblasen.
- Die Arbeit diskutiert die Auswirkungen von Filterblasen auf Bildung und Demokratie.
- Die Arbeit analysiert das politische Spektrum auf Facebook und die Rolle von Fake News.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Grundzüge des Sozialkonstruktivismus und bezieht sich dabei auf die Werke von Berger und Luckmann sowie Knoblauch. Das Kapitel beleuchtet die Entstehung subjektiver Realität und die Rolle von Kommunikation und Interaktion in der Konstruktion der Wirklichkeit. Das zweite Kapitel stellt Facebook als soziale Plattform vor und analysiert die Plattform in Bezug auf ihre Relevanz, Inhalte, Aufbau und Rezeption sowie die Rolle von Algorithmen als Gatekeeper. Das dritte Kapitel beschreibt die Forschungsmethode der qualitativen Sozialforschung und die Durchführung einer explorativen Untersuchung auf Facebook-Seiten von verschiedenen politischen Parteien. Das vierte Kapitel interpretiert und deutet die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden medienpsychologische Theorien zur Erklärung von Filterblasen herangezogen und die Auswirkungen von Filterblasen auf Bildung und Demokratie diskutiert. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Auswirkungen von Filterblasen auf die Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Sozialkonstruktivismus, Filterblasen, Echokammern, Algorithmen, Facebook, Kommunikation, Interaktion, Medienpsychologie, Bildung, Demokratie, Fake News, politische Rechte.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Echokammern auf Facebook?
Echokammern entstehen, wenn Nutzer durch Algorithmen vorwiegend Inhalte sehen, die ihre eigene Meinung bestätigen, was zu einer einseitigen Weltwahrnehmung führt.
Wie funktionieren Facebook-Algorithmen als Gatekeeper?
Der Algorithmus selektiert Inhalte basierend auf dem bisherigen Nutzerverhalten, um die Verweildauer zu erhöhen, wodurch kritische oder gegensätzliche Meinungen oft ausgeblendet werden.
Was bedeutet "Sozialkonstruktivismus" im Kontext sozialer Medien?
Nach Berger und Luckmann konstruieren Menschen ihre Wirklichkeit durch Interaktion. Facebook-Filterblasen schaffen somit eine spezifische "subjektive Realität" für den Nutzer.
Gefährden Filterblasen die Demokratie?
Die Arbeit diskutiert, ob die algorithmische Selektion zu einer Polarisierung der Gesellschaft führt und den sachlichen Diskurs zwischen verschiedenen politischen Lagern erschwert.
Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärsozialisation?
Primärsozialisation findet in der Familie statt, während die Sekundärsozialisation (z.B. durch soziale Medien) Identitäten und Wissen im späteren Leben prägt.
- Quote paper
- Maximilian Bauer (Author), 2018, Echokammern der Selbstbestätigung auf Facebook. Eine sozialkonstruktivistische Analyse der Wirkung von Algorithmen und Filterblasen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429217