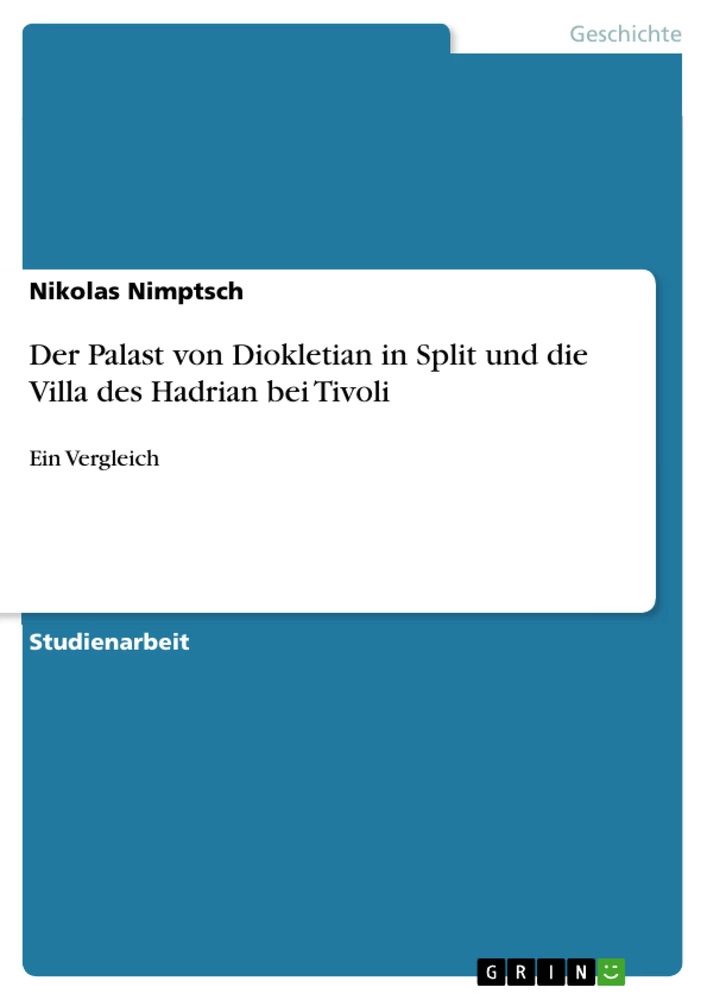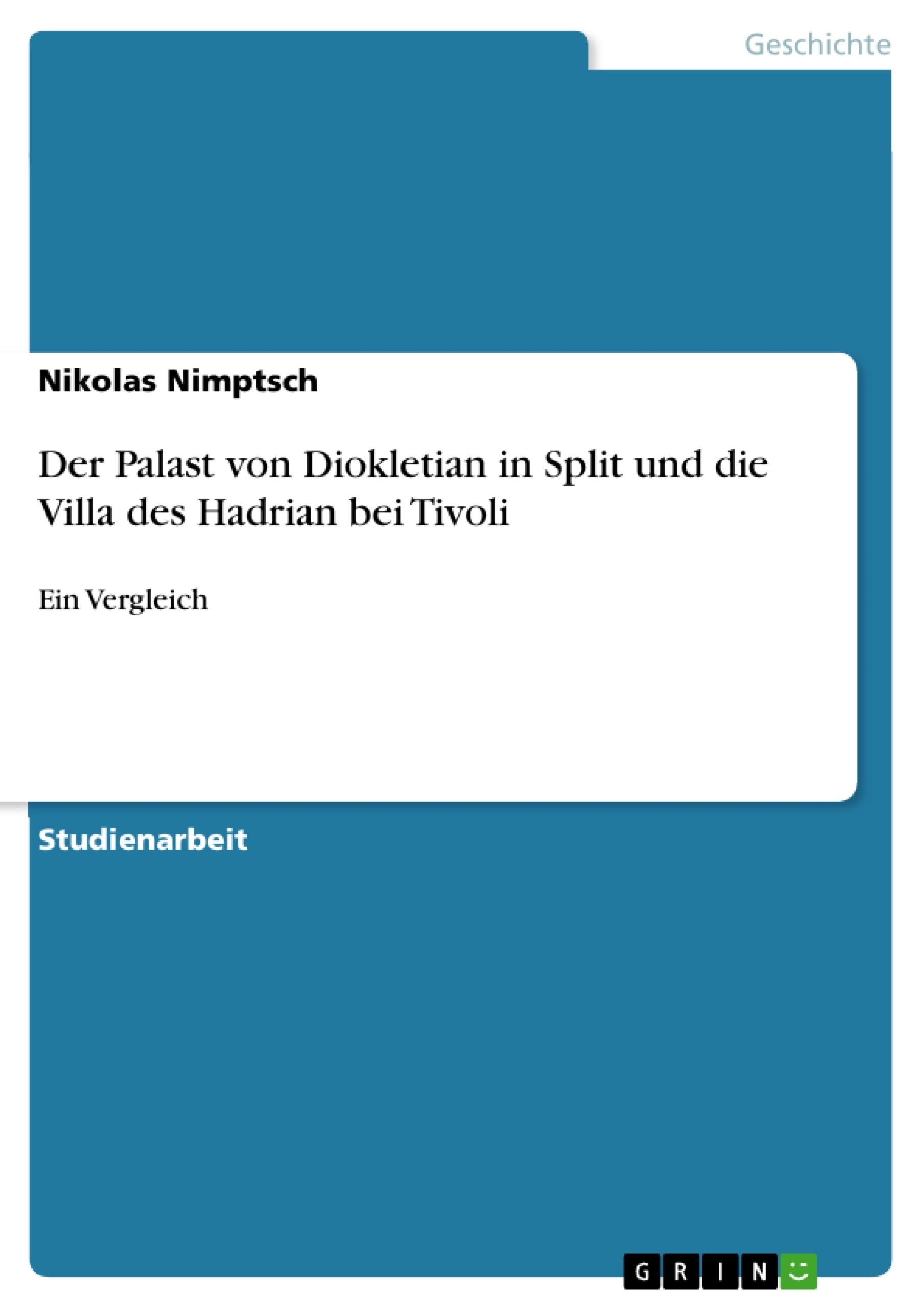In der heutigen Zeit wird der Eindruck einer Stadt bzw. einer Region vor allem durch neu-moderne Architektur geprägt. Gebäude einer vergangenen Zeit stellen dabei meist eine besondere Sehenswürdigkeit dar. Gerade antike Bauwerke locken viele Menschen an. Der Palast von Diokletian in Split und Hadrians Villa bei Tivoli sind exemplarische Beispiele dafür. Als „Kern“ ihrer Region sind beide Repräsentanten für die Baukunst des Römischen Reiches. Beide Kaiser brachten mit ihrem jeweiligen Monument die eigene Machtstellung zum Ausdruck und schufen sich ein Denkmal für die Nachwelt.
Hadrian, der von 76 n. Chr. bis 138 n. Chr. lebte, wurde 117 n. Chr. im Alter von 42 Jahren römischer Kaiser. Seine Kompetenz als militärische Führungsperson hat er schon zu Zeiten seines Vorgängers Trajan bewiesen. Ebenso faszinierten ihn aber auch Literatur, Kunst und Architektur. Neben weiteren Baulichkeiten ließ er sich einen Landsitz bei Tivoli errichten. Bis zu seinem Tod übte Hadrian seine Funktion als Kaiser aus. Diokletian hingegen schied 305 n. Chr. als einziger römischer Kaiser freiwillig aus seinem Amt aus. Nach seiner Abdankung bewohnte er seine kaiserliche Residenz in Split. Selbst nach seinem Tod zwischen den Jahren 313 und 316 blieb der Palast weiterhin im Besitz römischer Kaiser. Der letzte Kaiser des Weströmischen Reiches, Julius Nepos, soll sogar im Jahr 475 im Palast Zuflucht gefunden haben. Ebenso bot das Objekt einem Teil der fliehenden Bevölkerung Schutz, nachdem im 7. Jahrhundert Awaren und Slawen in das umliegende Gebiet eingedrungen waren.
Beide Bauwerke besitzen Gemeinsamkeiten, welche auf den ersten Blick nicht unbedingt herausragen. Vielmehr fallen dem Betrachter ohne Vorwissen direkt einige Unterschiede auf. In der vorliegenden Arbeit soll dem genauer auf den Grund gegangen und die beiden römischen Residenzen in einem Vergleich gegenübergestellt werden. Zuvor wird noch ein allgemeiner Überblick über beide Baukomplexe gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. RÖMISCHE RESIDENZEN
- 2.1 DER PALAST VON DIOKLETIAN IN SPLIT
- 2.2 DIE VILLA DES HADRIAN BEI TIVOLI
- 3. PALAST UND VILLA IM VERGLEICH
- 4. RESÜMEE
- 5. ABBILDUNGEN
- 6. QUELLENVERZEICHNIS
- 6.1 LITERATURQUELLEN
- 6.2 BILDQUELLEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht den Palast von Diokletian in Split und die Villa des Hadrian bei Tivoli. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden römischen Residenzen herauszuarbeiten und sie im Kontext der römischen Baukunst und der Machtdemonstration der jeweiligen Kaiser zu analysieren.
- Architektur und Bauweise der beiden Residenzen
- Die Funktion der Paläste als Ausdruck kaiserlicher Macht
- Der Einfluss der geografischen Lage auf die Gestaltung der Bauwerke
- Die spätere Nutzung und Bedeutung der Bauwerke
- Vergleich der Bauherren und ihrer Regierungszeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und hebt die Bedeutung antiker Bauwerke als touristische Attraktionen hervor. Sie stellt den Palast von Diokletian in Split und die Villa des Hadrian bei Tivoli als repräsentative Beispiele römischer Baukunst vor und benennt die beiden Kaiser als Bauherren, die mit ihren Monumentalbauten ihre Macht demonstrierten. Die Arbeit kündigt einen detaillierten Vergleich der beiden Residenzen an, wobei zunächst ein Überblick über beide Baukomplexe gegeben werden soll. Die verwendeten Literaturquellen werden kurz genannt.
2. Römische Residenzen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die beiden römischen Residenzen. Es gliedert sich in zwei Unterkapitel, die sich jeweils einem der Bauwerke widmen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Architektur, der Geschichte und der Bedeutung der Gebäude im Kontext der römischen Geschichte. Die Kapitel behandeln die Baugeschichte, die architektonischen Besonderheiten und den Stellenwert beider Bauwerke im römischen Reich und darüber hinaus, bis hin zur modernen Nutzung und touristischen Bedeutung.
Schlüsselwörter
Diokletian, Hadrian, Palast von Split, Villa Hadrians Tivoli, Römische Architektur, Kaiserresidenz, Machtdemonstration, Baugeschichte, Vergleichende Architekturgeschichte, Römisches Reich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Vergleich des Palastes von Diokletian in Split und der Villa des Hadrian bei Tivoli
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht den Palast des Diokletian in Split und die Villa des Hadrian bei Tivoli. Der Fokus liegt auf der Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider römischer Residenzen im Kontext römischer Baukunst und kaiserlicher Machtdemonstration.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Architektur und Bauweise beider Residenzen, ihre Funktion als Ausdruck kaiserlicher Macht, den Einfluss der geografischen Lage auf die Gestaltung, die spätere Nutzung und Bedeutung der Bauwerke sowie einen Vergleich der Bauherren und ihrer Regierungszeiten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Römische Residenzen (mit Unterkapiteln zum Palast von Diokletian und der Villa des Hadrian), Palast und Villa im Vergleich, Resümee, Abbildungen und Quellenverzeichnis (mit Literatur- und Bildquellen).
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, hebt die Bedeutung antiker Bauwerke als touristische Attraktionen hervor und stellt den Palast von Diokletian und die Villa des Hadrian als repräsentative Beispiele römischer Baukunst vor. Sie benennt die Kaiser als Bauherren und kündigt einen detaillierten Vergleich an.
Was beinhaltet das Kapitel "Römische Residenzen"?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über beide Residenzen. Es beschreibt Architektur, Geschichte und Bedeutung der Gebäude im Kontext der römischen Geschichte, inklusive Baugeschichte, architektonischer Besonderheiten und moderner Nutzung/touristischer Bedeutung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Diokletian, Hadrian, Palast von Split, Villa Hadrians Tivoli, Römische Architektur, Kaiserresidenz, Machtdemonstration, Baugeschichte, Vergleichende Architekturgeschichte, Römisches Reich.
Wo finde ich das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis befindet sich zu Beginn des Dokuments und listet alle Kapitel und Unterkapitel auf.
Welche Quellen wurden verwendet?
Das Quellenverzeichnis am Ende des Dokuments listet sowohl die Literatur- als auch die Bildquellen auf.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Palast von Diokletian und der Villa des Hadrian herauszuarbeiten und diese im Kontext der römischen Baukunst und der Machtdemonstration der jeweiligen Kaiser zu analysieren.
- Quote paper
- Nikolas Nimptsch (Author), 2018, Der Palast von Diokletian in Split und die Villa des Hadrian bei Tivoli, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432168