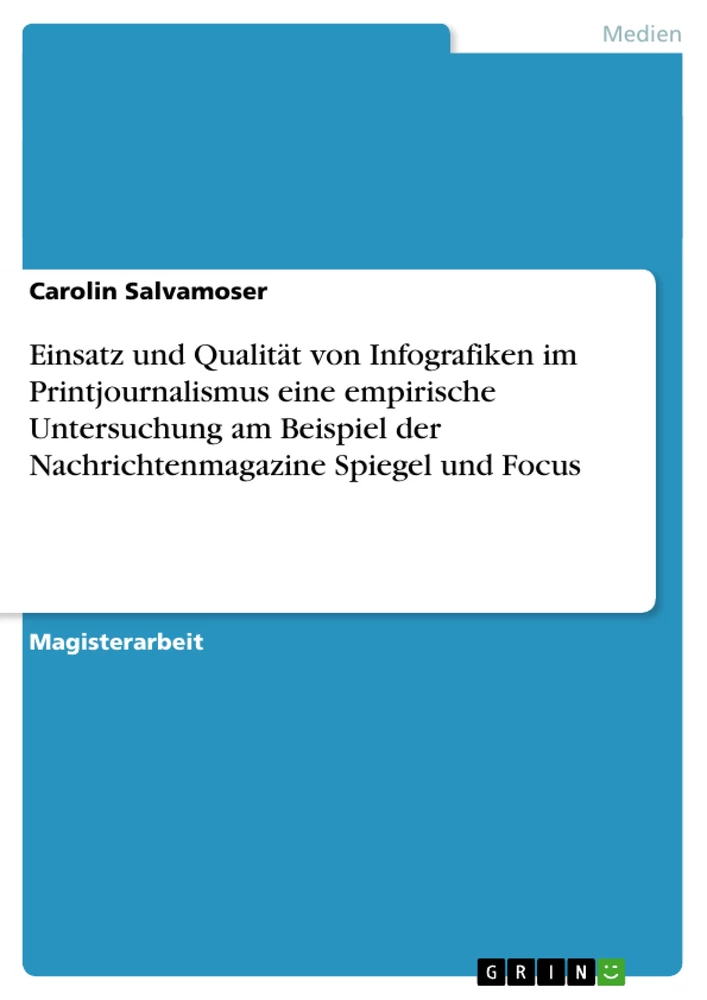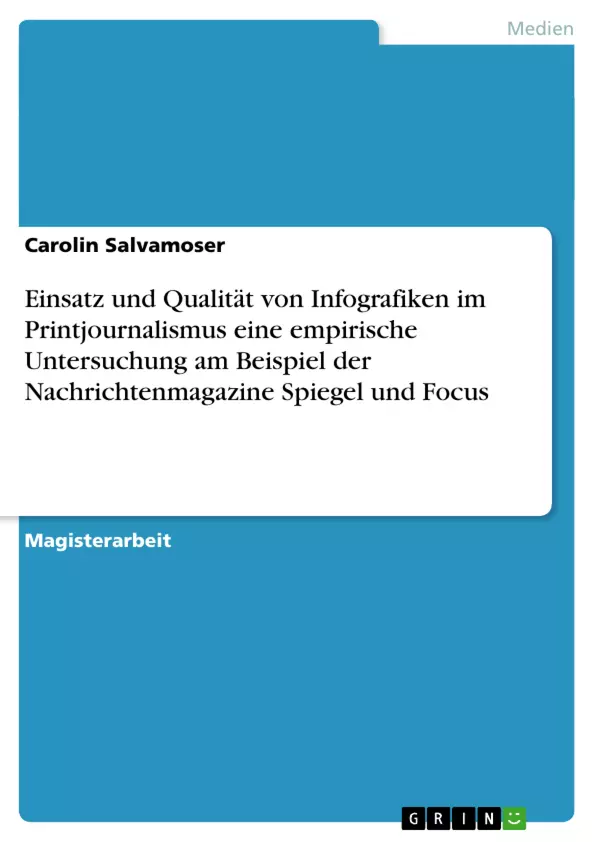Seit über zweihundert Jahren werden Infografiken in Printmedien eingesetzt, seit zehn bis fünfzehn Jahren ist ihr Stellenwert dort erheblich gestiegen, doch noch immer gibt es kaum eine wissenschaftliche Begleitung dieses Phänomens. Der Infografik-Trend der neunziger Jahre kam sowohl für Produzenten als auch für das Publikum überraschend. Die Infografiken machten sich in den Medien breit, ohne dass zuvor bestimmte Ansprüche an ihre Herstellung oder die Qualität der Informationsvermittlung gestellt werden konnten. Die Entwicklung der Zeitung zu einem visuell gestalteten Medium ging so rasant vor sich, dass alle Beteiligten stärker damit beschäftigt waren, dem Trend zu folgen als darüber zu reflektieren. Infografiken wurden so zum selbstverständlichen Bestandteil der Medien, begleitet lediglich von einigen aufgeregten öffentlichen Diskussionen unter Befürwortern und Gegnern, die jedoch wenig Ergebnisse hervorbrachten. In der Bevölkerung werden die Infografiken aufgrund ihrer breiten Präsenz zwar wahrgenommen, doch kaum jemand bemerkt den neuen Stellenwert, den sie mittlerweile in der Berichterstattung erreicht haben. Auch der Begriff Infografik gehört kaum zum aktiven Wortschatz und ist nur unklar definiert. Deutschland gehört damit eher zu den Nachzüglern im Infografik-Boom. Nicht nur in den USA und im lateinamerikanischen Raum wird dieses Thema wesentlich höher bewertet, sondern auch in Europa gibt es Beispiele dafür, Vorreiter sind dort vor allem Spanien und die skandinavischen Länder.
Auch wenn die Infografiken also keine ganz neue Entwicklung mehr darstellen, bietet sich der Zeitpunkt vor allem in Deutschland doch für eine genauere Analyse an. Es ist mittlerweile möglich, auf einen Zeitraum von etwa fünfzehn Jahren zurück zu blicken und daraus eine fundierte Bewertung abzuleiten. Die größte Aufregung um die Neuerungen in den Printmedien, vor allem visueller Art, hat sich mittlerweile gelegt, so dass nun ausreichend Abstand für eine überlegte Betrachtung gegeben ist. Auch unter Fachleuten gilt das Thema noch als aktuell. So äußerte beispielsweise Walter Longauer, selbst Grafiker und Mitbegründer der deutschen Abteilung der „Society for Newspaper Design“ auf Anfrage die Einschätzung, dass im deutschsprachigen Raum die Infografik selbst in Journalistenkreisen nicht ihrer Rolle gemäß wahrgenommen und diskutiert wird. Erst seit ein paar Jahren scheint sich dieses Defizit zu verringern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. VON DER BLEIWÜSTE ZUR BUNTEN BILDERWELT
- 2.1 Die Informationsgesellschaft als treibende Kraft
- 2.2 Zeitungsdesign im Wandel der Zeit
- 2.3 Der Visualisierungs-Boom in den Printmedien
- 3. INFOGRAFIKEN AUS HISTORISCHER PERSPEKTIVE
- 3.1 Vom Altertum bis zur Renaissance
- 3.2 Die Ideengeber des 18. und 19. Jahrhunderts
- 3.3 Einzug in die Printmedien
- 4. SYSTEMATIK DER VIELFALT – WAS IST EINE INFOGRAFIK?
- 4.1 Statistische Infografiken
- 4.2 Kartografische Infografiken
- 4.3 Erklärende Infografiken
- 5. DIE FRAGE NACH DER QUALITÄT
- 5.1 Aus statistischer Sicht
- 5.2 Aus mediengestaltender Sicht
- 5.3 Aus wahrnehmungspsychologischer Sicht
- 6. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG – EINSATZ UND QUALITÄT
- 6.1 Einordnung in den Forschungskontext
- 6.2 Forschungsfragen und Operationalisierung
- 6.3 Ergebnisse und Interpretation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit dem Einsatz und der Qualität von Infografiken im Printjournalismus, insbesondere im Kontext der Nachrichtenmagazine Spiegel und Focus. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung von Infografiken in den Printmedien zu beleuchten und deren Bedeutung in der heutigen Informationsgesellschaft zu analysieren.
- Die Entwicklung des Infografik-Trends in den Printmedien und dessen Bedeutung in der Informationsgesellschaft.
- Die historische Entwicklung von Infografiken, von ihren Anfängen bis zum Einzug in die Printmedien.
- Die systematische Definition und Einteilung von Infografiken in verschiedene Arten und Kategorien.
- Die Beurteilung der Qualität von Infografiken aus verschiedenen Perspektiven: statistischer, mediengestaltender und wahrnehmungspsychologischer.
- Eine empirische Untersuchung des Einsatzes und der Qualität von Infografiken in den Nachrichtenmagazinen Spiegel und Focus.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine umfassende Einführung in das Thema, indem es die Informationsgesellschaft als treibende Kraft für die Veränderungen im Journalismus beleuchtet und die Entwicklung des Zeitungsdesigns im Wandel der Zeit nachzeichnet. Dabei wird insbesondere der "Visualisierungs-Boom" in den Printmedien thematisiert, der den Einsatz von Infografiken begünstigt hat.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der historischen Entwicklung von Infografiken, beginnend vom Altertum bis hin zum Einzug in die Printmedien. Es stellt die wichtigsten Entwicklungsschritte und die prägenden Einflüsse auf die Entstehung von Infografiken dar.
In Kapitel 4 wird die Systematik von Infografiken beleuchtet. Hier werden die verschiedenen Arten und Kategorien von Infografiken anhand ihrer Merkmale und Einsatzbereiche definiert und beschrieben.
Kapitel 5 widmet sich der Frage der Qualität von Infografiken. Dabei werden verschiedene Perspektiven beleuchtet, darunter die statistische Sichtweise, die mediengestalterische Sichtweise und die wahrnehmungspsychologische Sichtweise. Die Kapitel zeigt die Komplexität der Qualitätsbeurteilung von Infografiken auf und verdeutlicht deren Bedeutung für die Informationsvermittlung.
Das sechste Kapitel befasst sich mit der empirischen Untersuchung des Einsatzes und der Qualität von Infografiken in den Nachrichtenmagazinen Spiegel und Focus. Es beinhaltet eine Einordnung in den Forschungsstand, die Formulierung von Forschungsfragen und die Operationalisierung der Untersuchung. Die Ergebnisse der empirischen Analyse werden vorgestellt und interpretiert.
Schlüsselwörter
Infografiken, Printjournalismus, Nachrichtenmagazine, Spiegel, Focus, Informationsgesellschaft, Visualisierung, Zeitungsdesign, Qualität, Empirische Untersuchung, Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Seit wann werden Infografiken in Printmedien eingesetzt?
Infografiken finden seit über zweihundert Jahren Verwendung, erlebten jedoch in den 1990er Jahren einen massiven "Visualisierungs-Boom" im Journalismus.
In welche Kategorien lassen sich Infografiken einteilen?
Man unterscheidet primär zwischen statistischen Infografiken (Diagramme), kartografischen Infografiken (Karten) und erklärenden Infografiken (Schemazeichnungen/Abläufe).
Wie wird die Qualität einer Infografik beurteilt?
Die Qualität wird aus drei Perspektiven bewertet: statistisch (Korrektheit der Daten), mediengestalterisch (Ästhetik/Layout) und wahrnehmungspsychologisch (Verständlichkeit für den Leser).
Welche Nachrichtenmagazine wurden in der empirischen Untersuchung verglichen?
Die Untersuchung analysiert den Einsatz und die Qualität von Infografiken in den deutschen Magazinen "Der Spiegel" und "Focus".
Welchen Stellenwert hat Deutschland im internationalen Infografik-Boom?
Deutschland gilt eher als Nachzügler. Vorreiter in der Bewertung und Nutzung von Infografiken sind vor allem die USA, Spanien und skandinavische Länder.
- Quote paper
- Carolin Salvamoser (Author), 2004, Einsatz und Qualität von Infografiken im Printjournalismus eine empirische Untersuchung am Beispiel der Nachrichtenmagazine Spiegel und Focus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43234