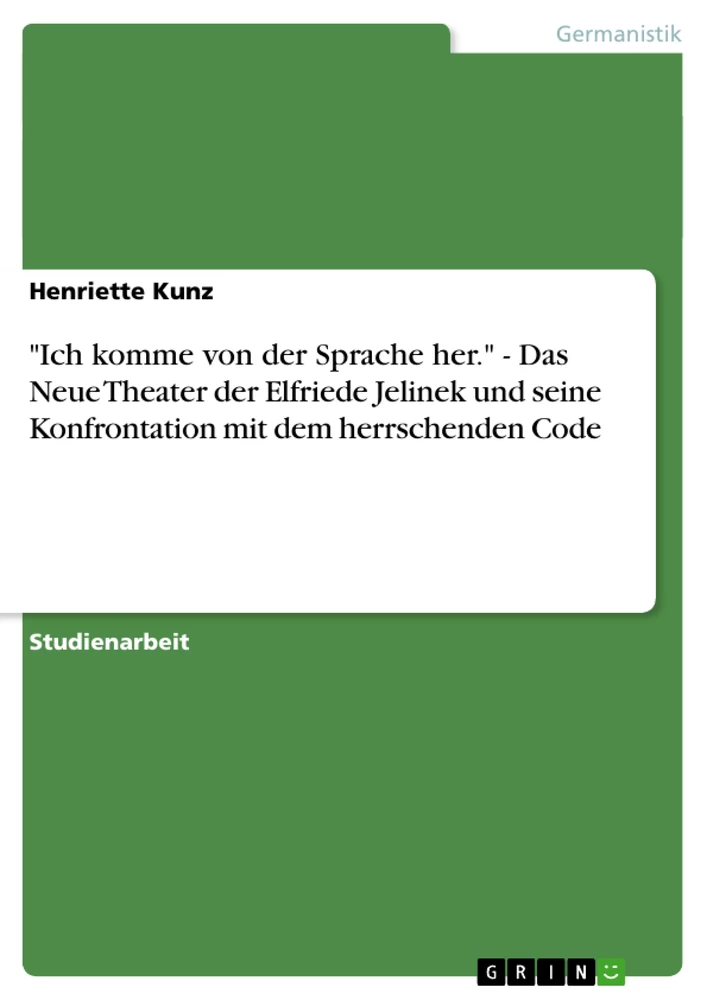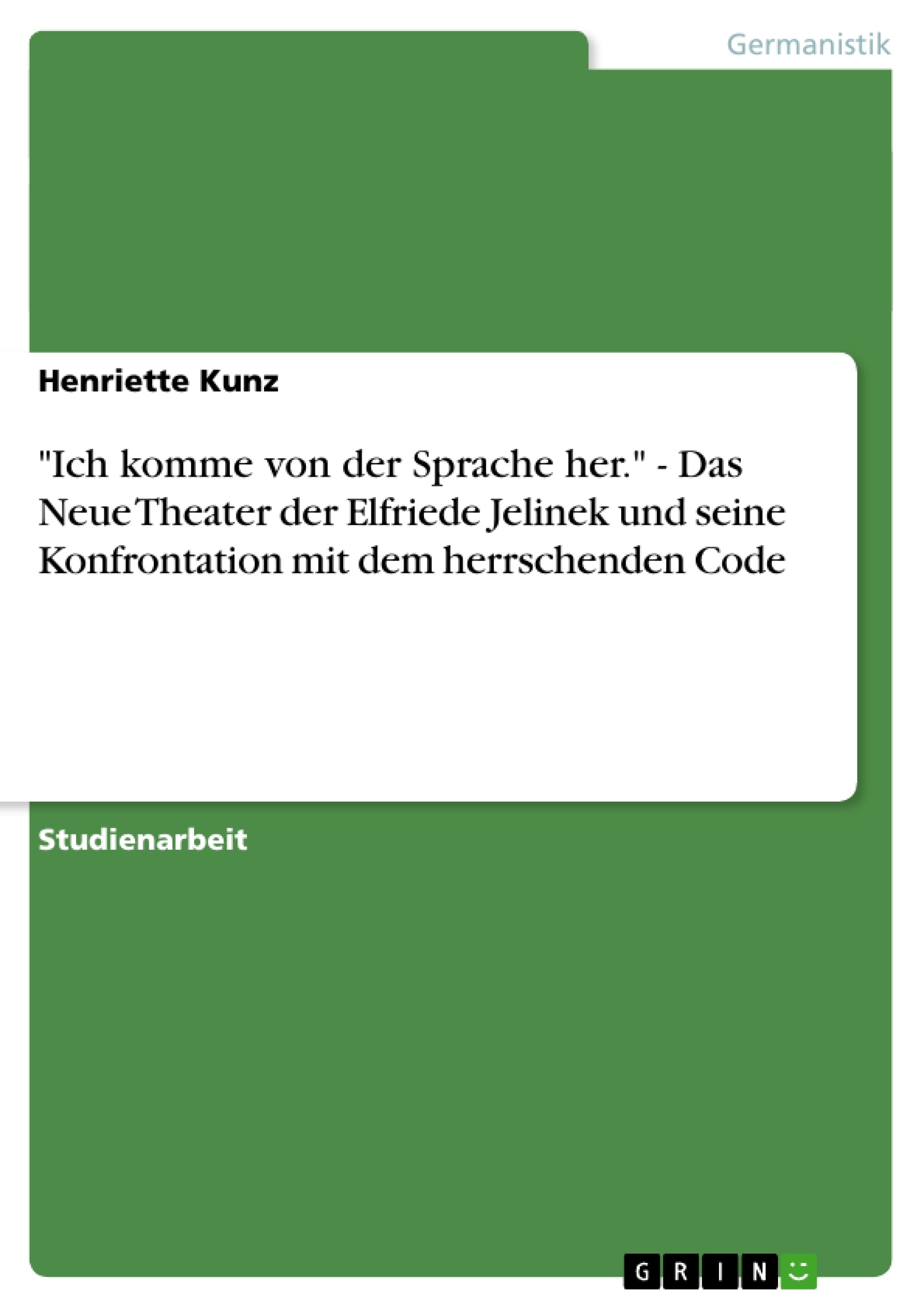Die vorliegende Arbeit wird versuchen, Reibungspunkte zwischen dem Neuen Theater Elfriede Jelineks und dem traditionellen herrschenden Code, deren Nichtbeachtung einige wichtige Initiativen ihrer theatralischen Texte vereinnahmend schluckt, anhand des Beispiels "Krankheit oder Moderne Frauen" [Jelinek, Elfriede: Krankheit oder Moderne Frauen. In: dies.: Theaterstücke. Herausgegeben von Regine Friedrich. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2004, S. 192-265] aufzuzeigen. Dazu werden in den ersten beiden Kapiteln des Hauptteils vorerst beide Theaterentwürfe einander theoretisch gegenübergestellt.
Daran anschließend finden ausgewählte Elemente der neuen Dramatik bezüglich des erwähnten Stückes exemplarische Darstellung, was schließlich in die ebenso exemplarische Illustration der Schwierigkeiten bei der szenischen Umsetzung dieses speziellen Textes nach herkömmlichen Methoden mündet. Ein wiederum allgemeingültig gehaltenes Kapitel behandelt schlussendlich mögliche Lösungen der angesprochenen Problematik.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der gegenwärtige Theatercode
- 3. Das Neue Theater der Elfriede Jelinek
- 4. Das Beispiel KRANKHEIT ODER MODERNE FRAUEN
- 1. Die Elemente des Neuen Theaters im Stück
- 2. Die Reibungspunkte mit dem herrschenden Code
- 5. Mögliche Lösungen
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reibungspunkte zwischen dem „Neuen Theater“ Elfriede Jelineks und dem traditionellen Theatercode. Sie analysiert, wie Jelineks Stücke die etablierten Strukturen herausfordern und welche Schwierigkeiten sich aus dieser Konfrontation für die szenische Umsetzung ergeben. Die Arbeit konzentriert sich auf das Beispiel „Krankheit oder Moderne Frauen“ um die theoretischen Überlegungen zu illustrieren.
- Konfrontation von Jelineks Theater mit dem herrschenden Code
- Analyse der Elemente des „Neuen Theaters“ in Jelineks Stücken
- Schwierigkeiten bei der szenischen Umsetzung von Jelineks Texten
- Mögliche Lösungen für die Problematik der Aufführung von Jelineks Stücken
- Jelineks Kritik an bestehenden Theaterstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Elfriede Jelinek als Dramatikerin vor, deren Werke lange Zeit von deutschen und österreichischen Bühnen abgelehnt wurden, da sie sich den Mitteln des existierenden Theaterapparats widersetzen. Der Aufsatz untersucht die Gründe für diese Ablehnung und die späteren Erfolge ihrer Stücke, die auf eine „geistlose“ Geschichte des Theaterbetriebs zurückgeführt werden, welcher die Stücke nur der Abgrenzung wegen spielt. Die Arbeit fokussiert sich auf die Reibungspunkte zwischen Jelineks „Neuem Theater“ und dem traditionellen Code, anhand des Beispiels „Krankheit oder Moderne Frauen“.
2. Der gegenwärtige Theatercode: Dieses Kapitel beschreibt den gegenwärtigen Theatercode als illusionistisches System, das auf der Zuordnung von Signifikat und Signifikant basiert, wobei der Schauspielkörper als zentraler Bedeutungsträger fungiert. Es wird argumentiert, dass die enge Verbindung zwischen Schauspielkörper und dargestelltem Material die künstlerische Heterogenität einschränkt. Der Fokus liegt auf der Unmöglichkeit eines „physischen Null-Zustands“ und den Schwierigkeiten, ein nicht-symbolisches, etablierte Einheiten zersetzendes Programm im Theater umzusetzen.
3. Das Neue Theater der Elfriede Jelinek: Dieses Kapitel behandelt Jelineks metatheaterisches Werk „Ich möchte seicht sein“ und ihre Abneigung gegen die bestehenden Theaterstrukturen. Es wird ihr Ansatz eines „Neuen Theaters“ skizziert, der im Gegensatz zum traditionellen Code steht und neue Impulse für das Theater sucht. Die Diskussion konzentriert sich auf Jelineks Kritik an den bestehenden Normen und dem Bestreben nach gesellschaftlicher Relevanz des Theaters durch die Anwendung eines neuen Codes.
4. Das Beispiel KRANKHEIT ODER MODERNE FRAUEN: Dieses Kapitel analysiert Jelineks Stück „Krankheit oder Moderne Frauen“ als Beispiel für ihr „Neues Theater“. Es untersucht die spezifischen Elemente, die den traditionellen Code herausfordern, und zeigt die Reibungspunkte mit den herkömmlichen Aufführungsmethoden auf. Die Kapitelteile analysieren die Elemente des neuen Theaters im Stück und die Reibungspunkte mit dem herrschenden Code. Es verdeutlicht die Schwierigkeiten, das Stück mit traditionellen Mitteln aufzuführen und die Notwendigkeit, neue Wege der Inszenierung zu finden.
Schlüsselwörter
Elfriede Jelinek, Neues Theater, Theatercode, Krankheit oder Moderne Frauen, Illusionistisches Theater, Szenische Umsetzung, Metatheater, Gesellschaftliche Kritik, Dramaturgie.
Häufig gestellte Fragen zu "Das Neue Theater der Elfriede Jelinek"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Reibungspunkte zwischen dem „Neuen Theater“ Elfriede Jelineks und dem traditionellen Theatercode. Sie analysiert, wie Jelineks Stücke die etablierten Strukturen herausfordern und welche Schwierigkeiten sich aus dieser Konfrontation für die szenische Umsetzung ergeben. Der Fokus liegt auf dem Stück „Krankheit oder Moderne Frauen“ als Beispiel für Jelineks Ansatz.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Konfrontation von Jelineks Theater mit dem herrschenden Code; Analyse der Elemente des „Neuen Theaters“ in Jelineks Stücken; Schwierigkeiten bei der szenischen Umsetzung von Jelineks Texten; mögliche Lösungen für die Problematik der Aufführung von Jelineks Stücken; Jelineks Kritik an bestehenden Theaterstrukturen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Der gegenwärtige Theatercode, Das Neue Theater der Elfriede Jelinek, Das Beispiel KRANKHEIT ODER MODERNE FRAUEN (mit Unterkapiteln zu den Elementen des Neuen Theaters und den Reibungspunkten mit dem herrschenden Code), Mögliche Lösungen und Zusammenfassung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Schlüsselwörter.
Was ist der „gegenwärtige Theatercode“?
Der gegenwärtige Theatercode wird als illusionistisches System beschrieben, das auf der Zuordnung von Signifikat und Signifikant basiert, wobei der Schauspielkörper als zentraler Bedeutungsträger fungiert. Die enge Verbindung zwischen Schauspielkörper und dargestelltem Material schränkt die künstlerische Heterogenität ein. Es wird die Unmöglichkeit eines „physischen Null-Zustands“ und die Schwierigkeiten, ein nicht-symbolisches, etablierte Einheiten zersetzendes Programm im Theater umzusetzen, betont.
Was zeichnet Jelineks „Neues Theater“ aus?
Jelineks „Neues Theater“ steht im Gegensatz zum traditionellen Code und sucht nach neuen Impulsen. Es zeichnet sich durch Metatheater, Kritik an bestehenden Normen und dem Bestreben nach gesellschaftlicher Relevanz des Theaters durch die Anwendung eines neuen Codes aus. Ihr Werk „Ich möchte seicht sein“ wird als Beispiel für ihren metatheaterischen Ansatz genannt.
Welche Rolle spielt „Krankheit oder Moderne Frauen“ in der Arbeit?
„Krankheit oder Moderne Frauen“ dient als Fallbeispiel für die Analyse von Jelineks „Neuem Theater“. Das Kapitel untersucht die spezifischen Elemente, die den traditionellen Code herausfordern, und zeigt die Reibungspunkte mit den herkömmlichen Aufführungsmethoden auf. Es verdeutlicht die Schwierigkeiten, das Stück mit traditionellen Mitteln aufzuführen und die Notwendigkeit, neue Wege der Inszenierung zu finden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Elfriede Jelinek, Neues Theater, Theatercode, Krankheit oder Moderne Frauen, Illusionistisches Theater, Szenische Umsetzung, Metatheater, Gesellschaftliche Kritik, Dramaturgie.
Warum wurden Jelineks Stücke lange abgelehnt?
Die Einleitung erwähnt, dass Jelineks Werke lange Zeit von deutschen und österreichischen Bühnen abgelehnt wurden, da sie sich den Mitteln des existierenden Theaterapparats widersetzen. Die spätere Akzeptanz wird auf eine „geistlose“ Geschichte des Theaterbetriebs zurückgeführt, welcher die Stücke nur der Abgrenzung wegen spielt.
Welche Lösungen werden für die Aufführung von Jelineks Stücken vorgeschlagen?
Die Arbeit skizziert mögliche Lösungen für die Aufführung von Jelineks Stücken, geht aber nicht explizit auf konkrete Vorschläge ein. Die Notwendigkeit neuer Inszenierungswege wird jedoch hervorgehoben.
- Quote paper
- Henriette Kunz (Author), 2005, "Ich komme von der Sprache her." - Das Neue Theater der Elfriede Jelinek und seine Konfrontation mit dem herrschenden Code, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43347