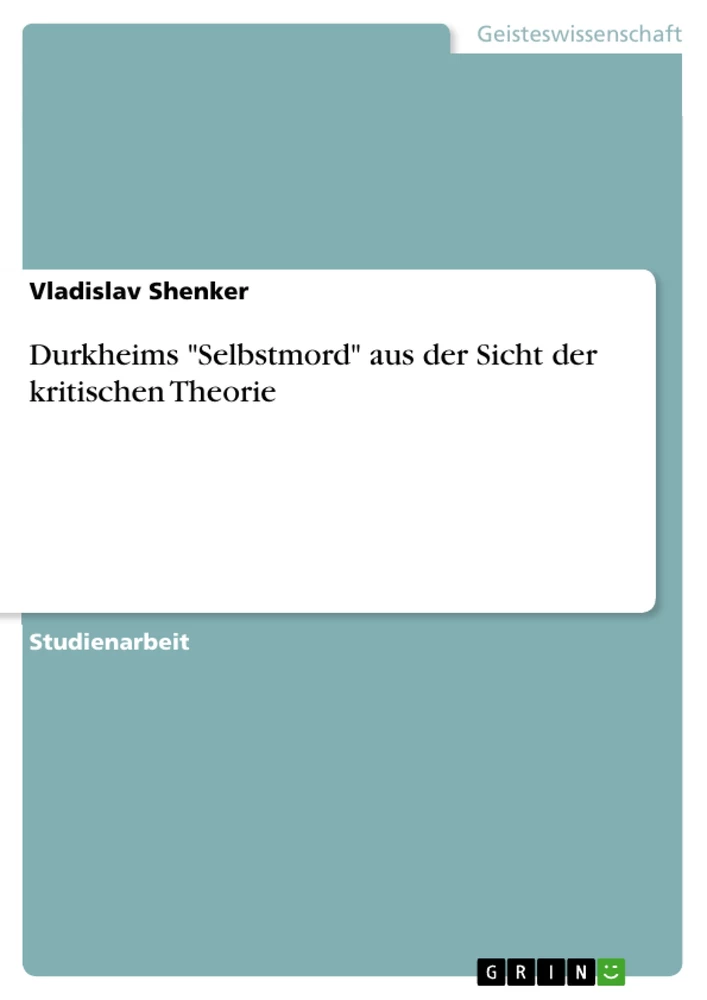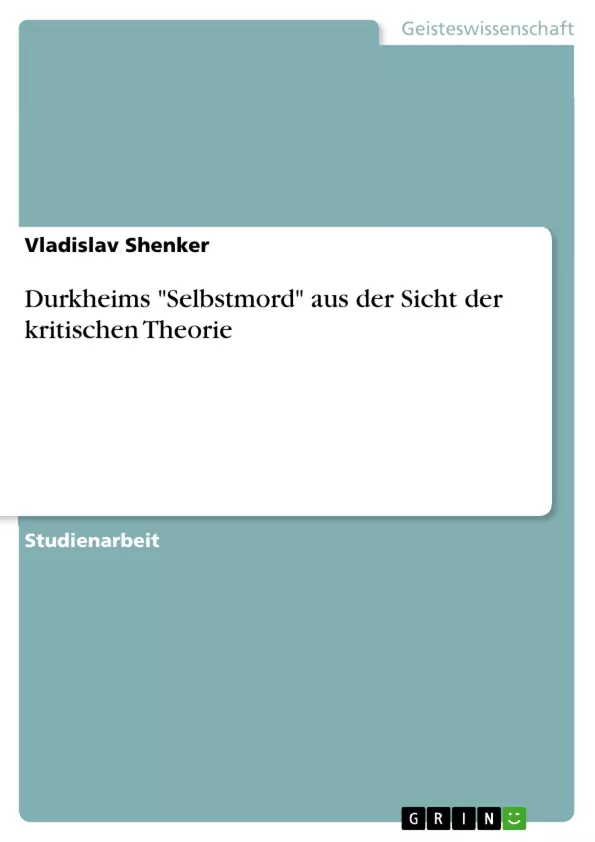Durkheims 'Der Selbstmord' ist eine überwiegend empirische Untersuchung des gleichnamigen Phänomens. Zurecht wird Durkheim deshalb als Mitbegründer einer „positiven Soziologie“ bezeichnet. Obwohl und weil Durkheim nur begrenzte Daten für die Untermauerung seiner These hatte, ist sein Verdienst vor allem ein methodologischer. In 'Der Selbstmord' geht Durkheim nach den Regeln seiner vorher aufgestellten Methode vor und liefert auf der Basis von Selbstmordstatistiken eine vollständige Interpretation des Phänomens.
Diese Hausarbeit ist ein Versuch einer theoretischen Auseinandersetzung mit 'De[m] Selbstmord' Durkheims. Im Fokus soll die Kritik seiner positivistischen Methode stehen, welche im Schluss sozialen Tatsachen eine außerindividuelle, dingliche Autorität verleiht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Durkheims 'Selbstmord'
- Zusammenfassung der ersten zwei Bücher
- Drittes Buch: Vom Selbstmord als sozialer Erscheinung im Allgemeinen
- Kritische Betrachtung von Durkheims 'Selbstmord'
- Die kritische Theorie und Adornos Gesellschaftsbegriff
- Kritik Adornos an Durkheim
- Mangel an Dialektik
- Reaktionäre Ideologie
- Falsches Bewusstsein
- Ein Vermittlungsversuch
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Durkheims Werk „Der Selbstmord" im Kontext der kritischen Theorie, insbesondere unter Berücksichtigung von Adornos Gesellschaftskritik. Der Fokus liegt auf der kritischen Analyse der positivistischen Methode, die Durkheim in seiner Untersuchung einsetzt und die soziale Tatsachen als unabhängige und außerindividuelle Kräfte darstellt.
- Durkheims positivistische Methode und die Konzeption sozialer Tatsachen
- Die kritische Theorie Adornos und die Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft
- Adornos Kritik an Durkheims Gesellschaftsbegriff
- Vermittlungsansätze zwischen Durkheims und Adornos Positionen
- Die Bedeutung von Durkheims 'Selbstmord' für die moderne Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit stellt Durkheims 'Der Selbstmord' als eine empirische Untersuchung des gleichnamigen Phänomens vor und beleuchtet die Kritik an seiner positivistischen Methode, die sozialen Tatsachen eine überindividuelle Autorität verleiht.
- Durkheims 'Selbstmord': Die ersten beiden Bücher des Werkes werden zusammengefasst. Durkheims Definition des Selbstmordes, die Bestimmung der sozialen Selbstmordrate und die Abgrenzung gegenüber psychologistischen Positionen werden dargestellt. Die drei Selbstmordtypen (altruistisch, egoistisch und anomisch) werden vorgestellt.
- Kritische Betrachtung von Durkheims 'Selbstmord': Die kritische Theorie und Adornos Gesellschaftsbegriff werden erläutert. Adornos Kritik an Durkheims positivistischer Methode, seiner reaktiven Ideologie und dem falschen Bewusstsein wird detailliert dargestellt.
- Ein Vermittlungsversuch: Dieser Abschnitt soll die Positionen von Durkheim und Adorno miteinander in Beziehung setzen und einen Vermittlungsversuch anbieten.
Schlüsselwörter
Durkheim, Selbstmord, Soziologie, kritische Theorie, Adorno, positivistische Methode, soziale Tatsachen, Kollektivbewusstsein, Individualismus, Dialektik, Gesellschaftskritik, Normativität, Moral, Machtverhältnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Durkheims Werk "Der Selbstmord"?
Es ist eine empirische Untersuchung, die Selbstmord nicht als individuelles, sondern als soziales Phänomen (soziale Tatsache) analysiert.
Welche drei Selbstmordtypen unterscheidet Durkheim?
Durkheim unterscheidet zwischen dem altruistischen, dem egoistischen und dem anomischen Selbstmord.
Was kritisiert die Kritische Theorie (Adorno) an Durkheim?
Adorno kritisiert Durkheims positivistische Methode, da sie sozialen Tatsachen eine dingliche Autorität verleiht und die Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft vernachlässigt.
Warum wird Durkheim als Mitbegründer einer „positiven Soziologie“ bezeichnet?
Weil er strikt nach einer wissenschaftlichen Methode vorging und soziale Erscheinungen wie "Dinge" behandelte, die durch Statistiken belegbar sind.
Was bedeutet "anomischer Selbstmord"?
Dieser Typ tritt auf, wenn gesellschaftliche Normen und Regeln (Anomie) zerfallen oder sich so schnell ändern, dass das Individuum den Halt verliert.
Was ist das Ziel des Vermittlungsversuchs in dieser Arbeit?
Die Arbeit versucht, die gegensätzlichen Positionen von Durkheims Positivismus und Adornos Dialektik miteinander in Beziehung zu setzen.
- Arbeit zitieren
- Vladislav Shenker (Autor:in), 2017, Durkheims "Selbstmord" aus der Sicht der kritischen Theorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/433516