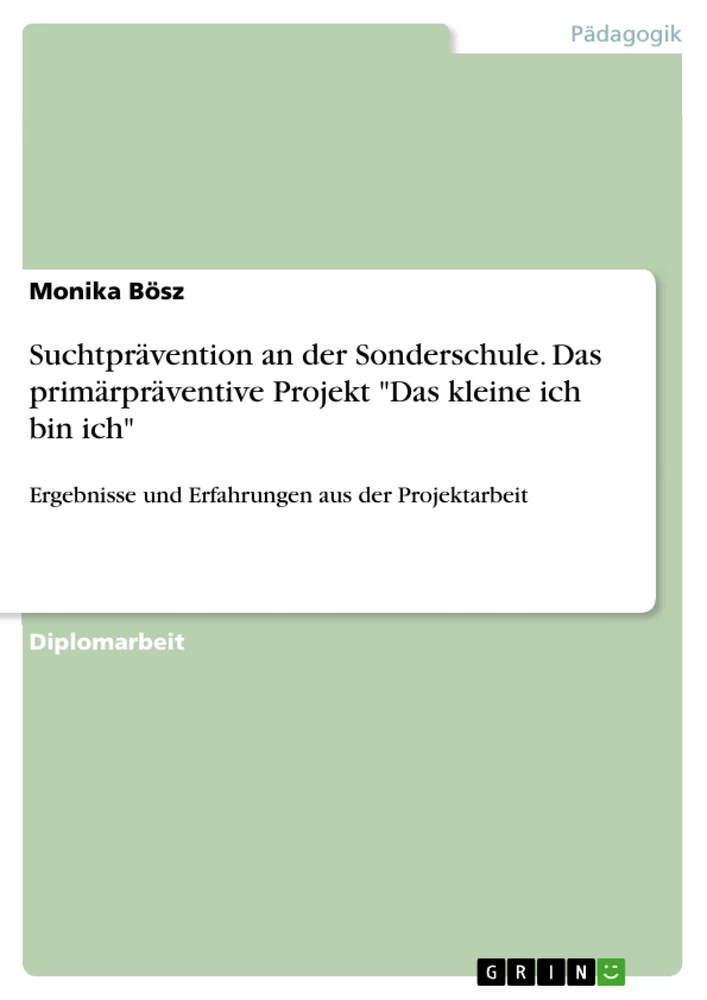Im Rahmen meines Praktikums im Suchthilfezentrum Wiesbaden war ich vor die Aufgabe gestellt, ein suchtpräventives Projekt an einer Lernhilfeschule über ein Schuljahr zu begleiten. Während der Vorbereitung dieses Projekts mußte ich feststellen, daß weder spezifische Materialien zur Durchführung suchtpräventiver Projekte an Sonderschulen noch Erfahrungsberichte über bereits durchgeführte Projekte an dieser Schulform zugänglich sind. In der überwiegenden Mehrheit der Literatur zum Thema Sucht und Suchtprävention finden Sonderschüler keine Beachtung. Dies legt die Vermutung nahe, daß die Notwendigkeit, Suchtprävention auch an der Schule für Lernhilfe mittels für diese Schulform geeigneter Materialien durchzuführen, bisher nicht gesehen wurde. Das Anliegen dieser Arbeit ist deshalb zum einen zu untersuchen, inwieweit dieser Ausschluß lernbehinderter Schüler aus den Bemühungen zur Suchtprävention gerechtfertigt ist. Dazu ist es zunächst notwendig, herauszuarbeiten, wie und unter welchen Bedingungen Sucht entsteht (2.1.2) und welche Faktoren das Risiko einer Suchtentstehung begünstigen (2.2.1 – 2.2.3). Um nun beurteilen zu können, in welchem Umfang lernbehinderte Kinder und Jugendliche vom Risiko einer Suchtentwicklung betroffen sind, muß geprüft werden, inwieweit die Risikofaktoren für die Entstehung von Suchtverhalten auch auf diese Schülergruppe zutreffen (2.2.4) und in welchem Ausmaß Sonderschüler Suchtmittel konsumieren (2.2.5).
Zum anderen stellte sich mir aufgrund der fehlenden Materialien bzw. Erfahrungsberichte zur Durchführung suchtpräventiver Projekte an der Sonderschule die Frage, wie Suchtprävention an der Schule für Lernhilfe wirksam realisiert werden kann. In Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Suchtprävention in Wiesbaden und einer Lehrerin der Lernhilfeschule wurde deshalb von mir der Versuch gemacht, das für die Grundschule konzipierte Projekt „Das kleine ich bin ich“ an die Anforderungen und Bedürfnisse lernbehinderter Kinder anzupassen und im Zeitraum eines Schuljahres durchzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Drogen, Sucht und Abhängigkeit
- Begriffsklärungen
- Modelle zur Entwicklung und Aufrechterhaltung des Substanzmißbrauchs
- Trias-Modell
- Lerntheoretische Ansätze
- Entwicklungspsychologische Konzepte
- Sozialisationstheoretische Konzepte
- Gesundheits- und Suchtverhalten in der Kindheits- und Jugendphase
- Entwicklungsaufgaben und Risikofaktoren in der Kindheit
- Entwicklungsaufgaben und Risikofaktoren in der Jugendphase
- Rahmenbedingungen des Konsums
- Risikofaktor Lernbehinderung?
- Konsumverhalten lernbehinderter Kinder und Jugendlicher
- Suchtprävention
- Begriffsklärung
- Ziele personalkommunikativer Primärprävention
- Suchtprävention als Teil der Gesundheitsförderung
- Konzepte primärer Prävention über personale Kommunikation
- Drogenerziehung und Informationsvermittlung
- Affektive Erziehung
- Konzepte der alternativen Erlebnisformen
- Standfestigkeitstraining gegen negative soziale Beeinflussung
- Vermittlung allgemeiner Bewältigungsfertigkeiten (life skills, Lebenskompetenzprogramme [LKP])
- Präventionsbereich Schule
- Das Projekt „Das kleine ich bin ich“
- Projektbeschreibung
- Projektdokumentation
- 1. Baustein: Aufwärmen – Kennenlernen - Vertrauen schaffen
- 2. Baustein: Kontakt – Wahrnehmung – Identität
- 3. Baustein: Kommunikation – Körper – Vertrauen
- 4. Baustein: Gefühle wahrnehmen und ausdrücken - Freunde
- 5. Baustein: Schule - Klasse - Kooperation
- 6. Baustein: Alltagsmuster
- Untersuchungsplan
- Untersuchungsverfahren
- Befragung der Schüler
- Befragung der Eltern
- Befragung der Lehrkraft
- Beobachtungen der Honorarkraft
- Untersuchungsergebnisse
- Analyse der Befragung der Schüler
- Analyse der Befragung der Eltern
- Analyse der Befragung der Lehrkraft
- Analyse der Beobachtungen der Honorarkraft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Suchtprävention an der Sonderschule, insbesondere mit dem primärpräventiven Projekt „Das kleine ich bin ich“ an der Schule für Lernhilfe. Die Arbeit analysiert die Ergebnisse und Erfahrungen aus der Projektarbeit und untersucht deren Auswirkungen auf das Suchtverhalten von lernbehinderten Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit soll einen Beitrag zur Entwicklung von effektiven Präventionsmaßnahmen für diese Zielgruppe leisten.
- Die Bedeutung von Suchtprävention an der Sonderschule
- Die Rolle von Lernbehinderung als Risikofaktor für Sucht
- Das Projekt „Das kleine ich bin ich“ als Modell für primärpräventive Suchtprävention
- Die Auswirkungen des Projekts auf das Suchtverhalten der Schüler
- Die Evaluation des Projekts und die Ableitung von Handlungsempfehlungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung fest. Es definiert die Begriffe Drogen, Sucht und Abhängigkeit und beleuchtet verschiedene Modelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung des Substanzmissbrauchs. Darüber hinaus werden Entwicklungsaufgaben und Risikofaktoren in der Kindheits- und Jugendphase beleuchtet, wobei der Schwerpunkt auf der Situation lernbehinderter Kinder und Jugendlicher liegt.
- Im zweiten Kapitel wird das Projekt „Das kleine ich bin ich“ vorgestellt. Es werden die Projektbeschreibung, die Projektdokumentation, die verwendeten Untersuchungsmethoden und die Ergebnisse der Evaluation dargestellt. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen des Projekts auf die Schüler, die Eltern und die Lehrkräfte.
Schlüsselwörter
Suchtprävention, Sonderschule, Lernbehinderung, primärpräventiv, Projekt „Das kleine ich bin ich“, Gesundheitsförderung, Risikofaktoren, Lebenskompetenzprogramme, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Suchtprävention an Sonderschulen besonders wichtig?
Lernbehinderte Kinder und Jugendliche sind oft mit spezifischen Risikofaktoren konfrontiert, die eine Suchtentwicklung begünstigen können, werden aber in der Standardliteratur häufig vernachlässigt.
Was ist das Projekt "Das kleine ich bin ich"?
Es handelt sich um ein primärpräventives Projekt, das ursprünglich für Grundschulen konzipiert wurde und hier speziell an die Bedürfnisse von Schülern an Lernhilfeschulen angepasst wurde.
Welche Ziele verfolgt die primäre Suchtprävention?
Ziele sind die Förderung der Lebenskompetenz (Life Skills), die Stärkung des Selbstwertgefühls, die Wahrnehmung von Gefühlen und die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit, um Suchtverhalten vorzubeugen.
Gilt Lernbehinderung als eigenständiger Risikofaktor für Sucht?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die Lebensbedingungen und sozialen Herausforderungen, die mit einer Lernbehinderung einhergehen, das Risiko eines Substanzmissbrauchs erhöhen.
Wie wurde das Projekt evaluiert?
Die Evaluation erfolgte durch Befragungen von Schülern, Eltern und Lehrkräften sowie durch systematische Beobachtungen während der Projektdurchführung.
- Quote paper
- Monika Bösz (Author), 2002, Suchtprävention an der Sonderschule. Das primärpräventive Projekt "Das kleine ich bin ich", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43676